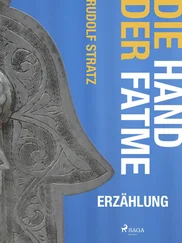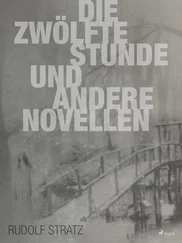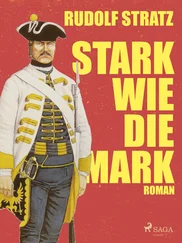1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 Die Leipziger Strasse hinab kam ein langer Zug. Der Berliner Osten kam. Der Norden. Die Welt der Fabrikhöfe, der Hinterhäuser, der Laubenkolonien. Männer, Frauen, Mädchen in Arbeitskleidung, je viere nebeneinander. Sie schritten langsam. Sie schritten stumm. Sie sahen feierlich vor sich hin. Rote Fahren nickten, grell in der grauen Luft, über den stillen Köpfen. Diese Köpfe wollten nicht enden. Weit hinauf, bis zum Spittelmarkt, sah man noch die wandernden Wellen von Filzhüten und Umschlagtüchern, und der dicke kleine Herr mit goldenem Zwicker und Biberpelz, der das vorderste rote Banner trug, war schon am Potsdamer Platz.
Auf dem Platz standen die lachenden, aufgeregten Menschen in Massen. Weisse Taubenschwärme umflatterten die vorbeikeuchenden, mit Feldgrau, Matrosenblau, Schwarz der Bürgerröcke gespickten, flintenstarrenden Kraftwagen. Es waren die in Stössen von oben unter die Menge gestreuten Aufrufe der neuen Machthaber. Harte, hallende Hufschläge. Reitende Garde-Feldartilleristen mit abgeschirrten Strängen in gestrecktem Galopp über den Asphalt. Eine aus dem Sattel Hochgeschwungene, wehende rote Fahne. Ein wi des, kriegerisches Bild, wie man es draussen im Felde nie gesehen.
Und darüber der stille, graue Novemberhimmel. Die stummen, kahlen Bäume des Tiergartens. Bruno Lotheisen schritt an dessen Rand entlang. Es dämmerte schon stark. Schattenhaft, eilig, durch die trockenen Nebel des neunten Novembertags, nahte über Deutschland, die Nacht. Die Strasse der Reichen, die Tiergartenstrasse, hätte heute durch Pompejis. Todesschweigen führen können. Keine lebende Seele war zu sehen. Wie ausgestorben lagen die prunkvollen Villen mit geschlossenen Gittertoren, herabgelassenen Rolläden. Hinter wenigen der hohen Fensterscheiben glomm ein ängstlicher Lichtpunkt. Dumpfer, unheimlicher Trommelschlag ratterte im Takt durch die Stille. Aus der Viktoriastrasse, vom Oberbefehlshaber in den Marken her, marschierte ein langsamer Schattenzug im Zwielicht. Der düstere Umriss eines bewaffneten Autos rollte hochragend, wie eine Guillotine auf Rädern, zwischen den verschwimmenden Gruppen der Männer und Frauen.
Der eintönige, gespenstige Trommelwirbel hallte Bruno Lotheisen noch lange im Ohr. Zwischen den Bäumen neben der Strasse pirschten sich ein blonder Sanitäter und seine junge Frau vorsichtig dahin. Sie schienen Angst zu haben. Der Architekt Lotheisen fragte sich: Wovor? Die beiden waren die einzigen Menschen, denen er in diesem plötzlich zum Schattenreich gewordenen Goldenen Viertel des Berliner Westens auf dem weiten Weg bis zum Kurfürstendamm begegnete. Da endlich waren wieder Leute. Da standen auf einmal wieder an den Strassenkreuzungen, schon beinahe selbstverständlich, an Stelle der Schutzmänner die Ordnung haltenden Arbeiter mit umgehängtem Gewehr. Die Laternen leuchteten. Es war Nacht.
Ein alter Herr kaufte sich schmunzelnd eine grosse geräucherte Flunder und knöpfte sie, sich schuldbewusst umschauend, unter den Mantel. Dieses Fischlädchen war offen. Sonst dunkelte es hinter den Schaufenstern der meisten Geschäfte. Wenige Menschen, hasteten an den Häusern hin, hatten es eilig, heimzukommen. Es war eine lähmende Stille nach dem Sturm. Berlin hielt den Atem an. Wartete, was weiter werden sollte . . .
Und in dem Heute wandelt schon das Morgen . . . Es ist geschehen. Was bringt der nächste Tag? Das nächste Jahr? Das nächste Jahrzehnt? Alle Geister sind gerufen? Wer ist ihr Meister? Wer beschwört mit gebieterischer Hand die zwiefach über Deutschland lohende Feuersbrunst: den heute entfachten Flammensturm im Innern, den wütend seit Monaten nahenden Weltbrand vor den Toren? Schicksal, rette Deutschland! Aber wie noch? Wie?
Bruno Lotheisen konnte nicht weiter denken. Er war betäubt. Er schritt in dumpfer Ruhe den Kurfürstendamm entlang. Er wurde sich langsam wieder seiner selbst bewusst. Sein Ich, ausgelöscht durch die letzten Stunden, kehrte ihm wieder. Er sagte sich . . . Ich? . . . Was ist jetzt ein Mensch? . . . Aber ich bin doch da . . . Ich atme . . . ich lebe . . . ich leide . . . Ich muss meinen Leidensweg zu Ende gehen.
Er war vor seinem Hause angelangt. Im ersten Stockwerk, in seiner Wohnung, war Licht. Er stand. Er sah empor. Er dachte: Lonny ist daheim. Natürlich. Wo sollte sie sonst an diesem Abend sein. Ich muss jetzt stark sein. Ich muss hinaufgehen. Ich muss vor sie treten, ob sie auch vor meinem Geist erschrickt. Ich muss das Rätsel meiner Ehe lösen.
Oben in ihrem Salon sass Lonny Lotheisen und telephonierte mit heller, lauter Stimme an eine Freundin: „. . . also lasse tüchtig Wasser in die Badewanne laufen und schau, dass du Kerzen im Haus hast! . . . Man weiss nicht, wie’s morgen ausschaut! Woher ich diese Weisheit hab’? Dr. Grimm ist eben noch rasch mal zu mir gekommen! . . . Die Frieda und die Else sitzen auch noch von Mittag her da! Die Else übernachtet bei der Frieda — zwei Häuser von hier! Grimm bringt sie gleich jetzt nach Hause. Wie? Ob ich mich fürchte? Nee . . . Und ihr? Ihr habt so Angst wegen des Schiebers, der unter euch wohnt? Ja, lieber Gott, da könnt ihr doch nichts dafür . . . Es heisst, zu uns wollten sie heute nacht auch kommen und mal die Speisekammern am Kurfürstendamm revidieren! Na — bei mir werden sie staunen . . . So was an Leere . . .“
„Da unten vor dem Hause steht schon solch eine Bassermannsche Gestalt“, sagte, während Lonny abhängte, ängstlich am Fenster die hustende Kriegerwitwe aus dem Schwarzen Kabinett zu der kleinen Frontkämpferfrau mit den kaputten Nerven.
„Ein Bewaffneter?“
„Nein. Ein Gewehr hat er nicht. Es scheint ein Russe zu sein, mit Pelzmütze und blondem Schopf und hohen Stiefeln. Der unheimliche Mensch schaut immer gerade zu uns herauf.“
„Leise! Die Lonny ist schon wieder an der Strippe . . . der lassen ihre Freundinnen heute keine Ruh’!“
„Herrgott — mir geht’s gerad’ so, Bertal“ rief Lonny ungeduldig in das Hörrohr. „Ich kann auch keinen Tausendmarkschein gewechselt kriegen! Wie? Ob man uns nun alle umbringt? Ach — ich hoffe doch nicht! Wir hier beurtei en die Lage optimistischer! Wer denn — wir? Dr. Grimm natürlich! Er ist eben da! Was? So? — Na! — Ja — wenn dein Mann klüger als Dr. Grimm sein will . . . Werner Grimm sagt, seit heute sei erst der Weg zu Wilson frei, und alles würde jetzt gut! Adieu! Grüsse deinen Mann! Nein — grüsse ihn nicht! Jch ärgere mich zu sehr über ihn. Er soll sich erst zu Wilson bekehren! Schluss!“
Lonny Lotheisen sprang von dem Apparat auf. Sie warf einen Blick zur Decke, als wollte sie den lieben Gott um Nachsicht mit allen geistig Armen bitten, lief durch das Zimmer, schlug, sich setzend, ein Bein über das andere, dass sich unter dem kurzen Rock die zarte, schmächtige Wadenlinie fast bis zum Knie abzeichnete, verschränkte die weissen Hände über dem Knie und hob die langen, dunkelblonden Wimpern andächtig zu Werner Grimm empor, der, Abschied nehmend, vor ihr stand und ihr so gleichmütig bestätigte, als spräche er vom Wetter: „Unsere Feinde wären ja verrückt, wenn sie uns niedertrampelten, statt uns auf die Beine zu helfen und tüchtig für die in ganz Europa zerschlagenen Fensterscheiben zahlen zu lassen! Vom Waffenstillstand darf man nichts erwarten. Der nimmt das Schlimmste vorweg. Da rasselt noch der blinde Säbel. Aber wenn sich dann die geistig intakt gebliebenen Europäer unter Wilsons Leitung mit dem Rechenbleistift zusammensetzen . . .“
„Wie wild der Russe auf der Strasse zu uns heraufglotzt“, raunte am Fenster die Kriegerwitwe. „Immer gerade zu uns.“
„Der Kerl ärgert sich, dass wir hier oben stehen! Gott sei dank, dass Dr. Grimm uns die paar Häuser weit bringt.“
Lonnys grosse, kluge Augen, von unbestimmter Farbe, leuchteten still bewundernd zu Werner Grimm empor.
„Sie imponieren mir wirklich, lieber Freund! Wie kriegen Sie es nur fertig, so gelassen zu sein — in dieser Stunde?“
Читать дальше