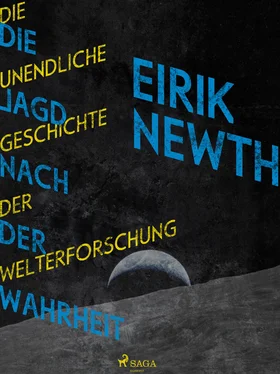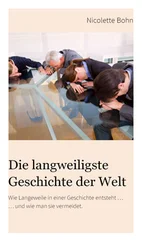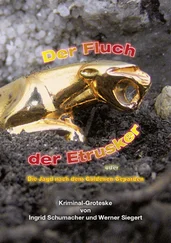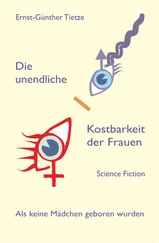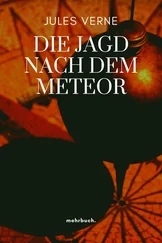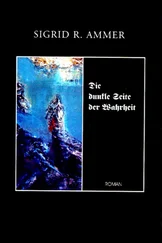Aber die Forscher sehen das alles ganz anders. Wenn sie erklären wollen, was sie in der Natur sehen, dann brauchen sie dazu Theorien. Deshalb gehört es zur Aufgabe der Forscher, solche Theorien zu entwickeln. Wir können durchaus behaupten, die Jagd nach der Wahrheit sei eine Jagd nach neuen Theorien.
Zwischen einer Theorie und einer Idee besteht ein großer Unterschied. Wir alle können Ideen über das, was sich in der Natur abspielt, jederzeit aus dem Ärmel schütteln. Es ist kein Problem, eine andere Erklärung für Mondfinsternisse zu finden als die, die Aristoteles uns hinterlassen hat. Ich kann zum Beispiel sagen: „Eine Mondfinsternis findet statt, wenn eine große Vogelschar am Mond vorbeifliegt.“
Das ist eine lustige Idee, aber keine Theorie. Wenn andere Forscher meine Idee ernst nehmen sollen, muss ich Fragen beantworten können wie: „Warum bleiben die Vögel stumm, wenn sie am Mond vorbeifliegen? Warum fliegt die Vogelschar immer in Kreisformation, wenn sie sich über den Mond bewegt? Vogelscharen fliegen normalerweise dicht über unseren Köpfen. Wie ist es also möglich, dass die Menschen an verschiedenen Orten die dunkle Fläche vor dem Mond gleichzeitig sehen?“
Wenn meine Idee als Theorie durchgehen soll, muss ich all diese Fragen und noch viele weitere beantworten können. Und wenn meine Theorie eine Überlebenschance haben soll, muss ich andere Forscher überzeugen, dass meine Vogelschar-Idee eine bessere Erklärung für Mondfinsternisse bietet als die Theorie des Aristoteles.
Eine Theorie zu entwickeln lässt sich mit dem Bau eines Hauses vergleichen (und unter Forschern ist wirklich vom „Aufbau einer Theorie“ die Rede). Es ist eine mühselige Arbeit. Wie ein Maurer die Steine so aufeinander legen muss, dass ein solides Haus entsteht, so muss ein Forscher dafür sorgen, dass viele verschiedene Fragen eine Antwort finden. Und dabei hilft ihm die Logik des Aristoteles. Sie hilft Forschern, die Gedanken ihrer Theorie in die richtige Reihenfolge zu bringen und eventuelle Fehler und Mängel zu entdecken.
Oft heißt es, die Naturforschung habe mit Aristoteles eingesetzt. Aber sie hat auch mit ihm aufgehört – für nahezu achtzehnhundert Jahre. Denn Aristoteles war so bedeutend, dass viele spätere Philosophen nicht glauben mochten, dass er sich jemals geirrt haben könnte. Sie vergaßen ganz einfach, dass Aristoteles gesagt hat: „Wahrheit ist der Gedanke, der am ehesten mit der Natur übereinstimmt.“ Sie dachten stattdessen: „Wahrheit ist der Gedanke, der am ehesten mit Aristoteles übereinstimmt.“
Das führte dazu, dass sich tüchtige Philosophen, die anderer Ansicht waren als Aristoteles, mit ihren Ideen nicht durchsetzen konnten. Ein solcher Fall war Aristarchos von Samos, der um das Jahr 320 v. Chr. geboren wurde. Wie Aristoteles hatte er beobachtet, dass sich Sonne, Mond und Planeten über den Himmel bewegen. Aber er hatte dafür eine ganz andere Erklärung als der berühmte Aristoteles.
Aristoteles glaubte, die Erde stehe im Zentrum des Universums, während Sonne, Planeten und Sterne, an großen, durchsichtigen Kugeln befestigt, um sie kreisten. Diese Vorstellung lag durchaus nahe, denn der Himmel scheint sich wirklich um die Erde zu drehen. Die Sonne geht jeden Tag im Osten auf und im Westen unter, und das gilt auch für die Sterne und alle anderen Himmelskörper.
Aristarchos glaubte aber, dass sich die Sonne im Zentrum des Universums befindet und die Erde und die anderen Planeten sich um sie drehen. Der Himmel scheint sich von Osten nach Westen zu bewegen, weil sich die Erde in die Gegenrichtung dreht, von Westen nach Osten. Davon kann man sich selber ein Bild machen.
Man richte seinen Blick auf einen Gegenstand, zum Beispiel auf ein Bild an der Wand, und drehe den Kopf von rechts nach links. Das Bild scheint sich nach rechts zu bewegen. Man dreht seinen Kopf in eine Richtung, und das, was man sieht, wandert in die Gegenrichtung. Genauso ist es am Himmel, meinte Aristarchos. Die Erde dreht sich von Westen nach Osten, und der Himmel scheint in die Gegenrichtung zu rotieren.
Aristarchos versuchte auch, unsere Entfernung zu Sonne und Mond zu berechnen. Er kam zu dem Ergebnis, die Sonne sei zwanzigmal weiter von der Erde entfernt als der Mond. Diese Zahl ist etwa zwanzigmal zu klein, aber wenn man bedenkt, dass Aristarchos kein Fernrohr und keine modernen Instrumente hatte, war es doch eine beeindruckende Leistung.
Obwohl Aristarchos seine Ansicht mit ebenso guten Argumenten untermauern konnte wie Aristoteles, wissen wir doch fast nichts über ihn. Die Philosophen, die nach ihm kamen, haben seine Schriften nicht aufbewahrt. Er interessierte sie nicht weiter, weil er anderer Ansicht war als Aristoteles. Fast achtzehnhundert Jahre mussten vergehen, ehe seine Gedanken wieder auftauchten, diesmal an einem ganz anderen Ort in Europa.
Nach heutigen Maßstäben gemessen, führten die meisten Menschen im alten Griechenland ein beklagenswertes Leben. Nur wohlhabende Männer durften wählen, sich ausbilden lassen und zu Philosophen werden. Frauen und Sklaven wurden kaum höher geachtet als Tiere, und für alle armen Menschen spielte es vermutlich kaum eine Rolle, ob die Philosophen glaubten, dass alles aus Wasser oder aus Atomen bestand.
Heutzutage gehen wir davon aus, dass unsere Kenntnisse über die Natur auch praktische Anwendung finden sollen. Wenn ein Forscher eine neue Entdeckung macht, ist eine der ersten Fragen, die dann gestellt werden: Welchen Nutzen bringt uns dieses Wissen? In Griechenland dachte man nicht so. Viele Philosophen waren reiche Männer, die körperliche Arbeit verachteten. Sie kamen gar nicht auf die Idee, dass ein philosophischer Gedanke das Los der Bäuerinnen, die sich auf den Feldern abmühten, oder der Sklaven, die sich in den Bergwerken zu Tode schufteten, verbessern könnte.
Für Philosophen wie Aristoteles wird oft als Entschuldigung angeführt, so wie er hätten damals „alle“ gedacht. Das ist nicht ganz falsch. Wir können schließlich nicht erwarten, dass ein Reicher, der in einer Gesellschaft mit vielen Sklaven aufgewachsen ist, Sklaverei für ein Übel hält. Oder können wir es vielleicht doch? Ist es nicht die Aufgabe von Philosophen und Wissenschaftlern, neu zu denken? Das ist eine schwierige Frage, und ich erwähne sie hier, weil sie noch immer alle Forscher auf der ganzen Welt betrifft. Es wird sich zeigen, dass auch später solche Fragen immer wieder eine Rolle gespielt haben.
Außerdem war Griechenland wirklich in jeder Hinsicht die „Wiege unserer Kultur“. Viele der negativen Seiten unserer Gesellschaft haben unsere Vorfahren von den Griechen übernommen. Dass die Griechen keine Philosophinnen zulassen wollten, hat zum Beispiel dazu geführt, dass erst in unserer Zeit Frauen forschen dürfen. Noch heute gibt es viel mehr Wissenschaftler und Philosophen als Wissenschaftlerinnen und Philosophinnen.
Ein Ausnahmephilosoph, der sich für das Wohlergehen von einfachen Menschen interessierte, war Hippokrates. Er wurde im Jahr 460 v. Chr. auf der Insel Kos geboren, und er ist eine ebenso geheimnisvolle Gestalt wie Thales. Im Grunde wissen wir über Hippokrates nur eins sicher: Die alten Methoden, mit denen Kranke behandelt wurden, passten ihm nicht.
Jahrtausendelang hatten die Menschen Krankheiten für eine Strafe der Götter gehalten, und oft war der einzige „Arzt“ ein „Medizinmann“, der versuchte, die Götter gnädig zu stimmen. Die Krankheit Epilepsie zum Beispiel wurde als „göttliche Krankheit“ bezeichnet. Die Menschen glaubten, böse Geister oder Götter riefen die unerklärlichen Anfälle der Epileptiker hervor. Aber ein Schüler des Hippokrates schrieb über diese Krankheit: „Sicher hat sie, wie jede andere Krankheit, ihre ganz natürliche Ursache.“
Hippokrates und seine Schüler waren der Meinung, dass die Götter die Gesundheit der Menschen nicht beeinflussten. Eine Krankheit habe eine natürliche Erklärung und beruhe auf einer Art Ungleichgewicht im Körper. Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden, und das können nur ausgebildete Ärzte. Hippokrates forderte die Medizinstudenten auf, ihre Patienten zu untersuchen und ihren Befund mit dem zu vergleichen, was sie gelernt hatten. Heutzutage nennen wir das „eine Diagnose stellen“. Der Patient muss den Ratschlägen des Arztes folgen, er muss Medizin nehmen, sich vernünftig ernähren und sich bewegen. Der Körper muss sich selber heilen, und dazu ist die Hilfe des Arztes vonnöten. Es kann durchaus besser sein, nichts zu unternehmen, als dem Patienten Medizin zu verabreichen.
Читать дальше