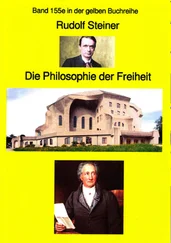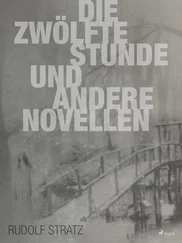„Das Bataillon lässt überall, wo es war, ein paar Grabkreuze hinter sich!“ sagte er ruhig.
„Ja ... und die, die krank werden?“ Jetzt brach deutlich die Angst in ihrer Stimme durch: „... sind nicht auch Kranke vom Bataillon in El-Ariana zurückgeblieben?“
„Einer liegt jetzt noch dort ... schon seit einem Vierteljahr ... Ein junger Soldat aus dem Elsass ...“
„Und ist das vielleicht ...“ Sie trat auf ihn zu. Ihre Augen waren gross vor Angst. „... Ich bin nämlich seine Schwester ... für den Fall, dass er Gaston Roland heisst ... Wir entstammen einer elsässischen Familie ...“
Er erwiderte: „Jawohl, Mademoiselle Roland — das ist Ihr Bruder, den ich meine ...“
„Und Sie kennen ihn?“
„Ich kenne ihn und besuche ihn zuweilen, wenn ich in diese Oase komme, weil mir der arme Mensch leid tut. Ich war erst vorgestern bei ihm.“
„Und wie geht es ihm?“
Der Jäger zögerte eine Weile mit der Antwort. Dann sagte er langsam: „Nicht sehr gut, Mademoiselle Roland. Den Typhus hat er ja so ziemlich überstanden. Aber es ist keine rechte Lebenskraft in ihm. Er wird schwächer und schwächer — ohne dass man viel dagegen tun kann.“
„Sie meinen, sein Leben ist in Gefahr?“
„Ich bin kein Arzt, sondern nur Bauer und Jäger. Aber ich glaube, so wie die Dinge liegen, sollten Sie sich beeilen, nach El-Ariana zu kommen.“
Das hübsche Mädchengesicht, das sich so bräunlich von dem weissen Dämmern der Sonnenhüllen abgehoben hatte, war jetzt sehr blass geworden. Einen Augenblick stand sie stumm und sorgenvoll da, dann sagte sie mit schwankender Stimme: „Ich danke Ihnen sehr für Ihre Auskunft, Monsieur!“ Und er erwiderte: „Tragen Sie es mir, bitte, nicht nach, dass sie nicht besser lauten konnte.“
Sie hörte seine Worte kaum noch. Sie war trotz der Gluthitze in die Karawanserei und in das Zimmer ihrer Reisegefährtinnen zurückgeeilt. Dort sassen die beiden Missionarinnen, zwei sommersprossige, rotbackige Engländerinnen zwischen dreissig und vierzig Jahren, auf ihrer Bibelkiste neben dem Aluminiumkocher und unterhandelten eben in fliessendem Arabisch und unter erbittertem Gebärden- und Mienenspiel mit dem vor ihnen stehenden Karawansereiwächter über den Ankauf eines Kaninchens, als die junge Französin hereintrat und hastig in ihrem gebrochenen Englisch bat: „Fragen Sie doch, bitte, den Mann, ob er den Europäer kennt, mit dem ich eben gesprochen habe. Es ist ein Jäger. Er hat ein weisses Pferd im Stall ...“
„Gewiss ...“ Der lange finstere Kerl im Burnus nickte. Er kannte den Steppenreiter wohl.
„Und ist der zuverlässig? Kann man alles glauben, was er sagt?“ Wieder bejahte der Moslem. Das sei einer der eingesessenen Franzosen, zu dem sogar die Einheimischen Zutrauen hätten.
„Und wer ist es denn?“
Der Burnusträger zuckte die Achseln und machte mit den ausholenden Armen eine jener vielsagenden orientalischen Bewegungen, die etwa ausdrücken mochte: Wissen wir, woher ihr alle kommt, ihr Europäer? — Dieser da war als Soldat ins Land gekommen. Hier war seine Dienstzeit zu Ende gewesen. Da hatte er seinen Abschied genommen. Seitdem lebte er da unten am Salzmeer. Er kam zuweilen auf der Jagd bis hierher nach Norden herauf. Seine Kugel war gut. Einen Panther hatte er schon geschossen, zur Freude der Hirtenstämme der Wüste. Mit denen war er gut Freund. Sidi Frank hiessen sie ihn.
Nun stellte Yvonne Roland ihre letzte Frage, viel ruhiger als bisher, wie jemand, der mit einem Entschluss ganz ins reine gekommen ist: Gab es eine Möglichkeit, jetzt bald aufzubrechen und die Nacht hindurch weiter nach El-Ariana zu reisen, um so rasch wie möglich dort zu sein?
Der Araber rief einen in der Nähe am Boden kauernden Moslem an und verhandelte mit ihm: Ja — dieser greise Achmed oder Soliman, der heute früh mit Maultier und leerem Karren aus jener Oase gekommen war, sei bereit, auch wieder dorthin zurückzukehren. Nur erwartete er natürlich ein besonders hohes Backschisch, in Anbetracht der Nachtfahrt durch die Wüste, die doch immerhin etwas Ungewöhnliches, selten Unternommenes sei.
Und zugleich erhoben auch die anderen Besucher der Karawanserei, die sich in ihrer Langeweile um Yvonne Roland gruppiert und zugehört hatten, ihre warnenden Stimmen. Auf englisch, französisch und arabisch redeten sie gleichzeitig auf sie ein, um sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Die beiden britischen Missionarinnen, die Land und Leute genau kannten, gaben ihr das Versprechen, sie würden mit ihr um vier Uhr morgens, noch vor Sonnenaufgang, aufbrechen, der Leutnant de Castaing de Laprade bot sich für diesen Fall sofort zur Begleitung an, und sein mohammedanischer Waffengenosse erzählte, nachdem er einige Worte in seiner Muttersprache mit dem Stationswächter gewechselt hatte, in gutem Französisch die Geschichte von einem Reisenden, der vor einigen Wochen eben auf diesem Wege ermordet worden war.
„Schlimm genug, wenn Sie nicht besser für die Sicherheit der Strassen sorgen!“ sagte das junge Mädchen zu den Offizieren, die nichts Rechtes darauf zu erwidern wussten. Denn tatsächlich waren, dank der Strenge der tunesischen Regierung, diese Gegenden nördlich des Salzmeeres ganz sicher. Für Europäer war hier keine Gefahr. Die begann erst am Südrand des Salzsees El-Dscherid, wo die Oasen unter Militärverwaltung standen und niemand gern ohne Waffen ausging. Aber trotzdem warnte der elegante Spahileutnant, der seinen Blick gar nicht von der Fremden, ihrer schlanken Gestalt, ihrem schmalen Antlitz wenden konnte und sich dachte, dass eine derartige Gelegenheit unter vier Augen wie solch ein langer einsamer Wüstenabend in der Karawanserei nie wiederkehrte, noch einmal: „Lassen Sie sich bereden, Madame! Fahren Sie nicht allein mit dem Araber in die Nacht hinein. Man kann diesen Leuten nie trauen!“ Und der Dattelreisende fügte hinzu: „Ich tät’ es nicht! Nicht für fünfhundert Francs! Und ich komm’ dies Jahr schon zum zehntenmal von Marseille herüber!“
Yvonne Roland war einen Kopf grösser als das schmächtige, gelbliche, quecksilberne Südfranzöslein. Sie antwortete ihm gar nicht, sondern sagte über ihn hinweg zu dem Leutnant de Castaing, dem einzigen aus diesem ganzen Kreis von Unglücksraben, den sie ernst nahm: „Sehen Sie sich doch den Karrenführer an! Das ist doch ein ganz alter, gebrechlicher Mann. Ich bin stärker als er!“
„Aber er kann Spiessgesellen haben, Madame!“
Darauf griff sie in die Tasche und holte, während sie in die Arabâ kletterte und unter dem Sonnendach Platz nahm, einen Revolver heraus.
„Ich habe meine Pflicht getan, Madame, und Sie auf alle Möglichkeiten aufmerksam gemacht.“
„Mein Bruder liegt todkrank in El-Ariana. Man hat mir gesagt, wie bedrohlich es um ihn steht. Ich bin nicht deswegen aus Strassburg übers Meer und nach Afrika gereist, um jetzt, im letzten Augenblick vor dem Ziel, unnütz haltzumachen. Glauben Sie mir: ich hab’ schon ganz andere Schwierigkeiten überwinden müssen, bis ich bis hierher gekommen bin!“
Sie nickte heftig bejahend auf die stumme Gebärdenfrage des greisen Achmed oder Soliman, ob sie zur Abfahrt bereit sei. Der schwang sich vor ihr auf die Deichsel und mahnte mit seltsamen Gurgeltönen die beiden Maultiere an ihre Pflicht. Während diese die langen Ohren spitzten und anzogen, knarrte und ächzte das Räderpaar. Die Arabâ schwankte langsam durch Staub und Morast des Hofes und unter dem Torweg hinaus ins Freie.
Dort kam eben Sidi Frank, der Jäger, nach der Karawanserei zurück. Er stand etwa zwanzig Schritte von der Wüstenkarawanserei, als der Wagen, scharf vom Purpur der sinkenden Sonne mit Mann, Maultieren und Mädchen sich abzeichnend, vorüberfuhr. Er sah sich rasch und aufmerksam, auch mit einem Schatten von Besorgnis auf den verbrannten Zügen, die Insassin der Arabâ an. Die hatte es sich bequem gemacht, so gut oder so schlecht es ging. Sie kauerte auf einem Koffer in dem zwischen den federlosen Rädern schaukelnden backtrogähnlichen Holzkasten, der viel zu kurz für sie war, so dass sie die Knie hoch heraufziehen musste und die Hände darüber verschlang. Die schaute nicht hinüber, wo der Jäger stand. Sie sah unablässig, mit halbgeschlossenen Augen gegen die schrägen, langen Sonnenstrahlen anblinzelnd, geradeaus in die Richtung, wo in unsichtbarer Ferne El-Ariana lag. Dahin wollte sie ...
Читать дальше