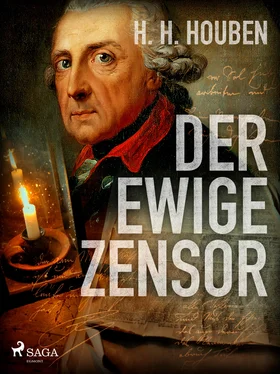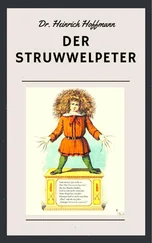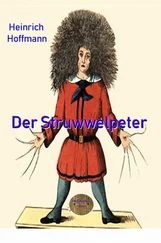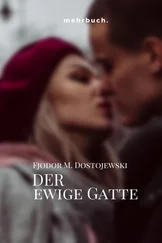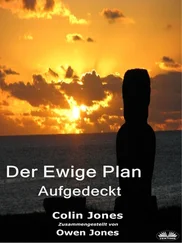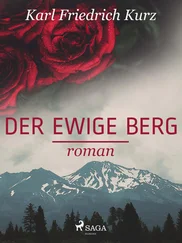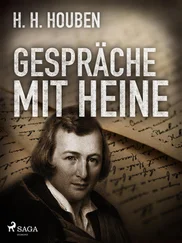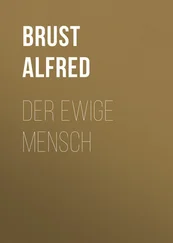Was sich über unterdrückte Bogen der Erstausgabe bisher feststellen ließ — der noch vor dem Druck stark veränderte Bogen 2 hat sich gefunden und für mancherlei Änderungen in den späteren Bogen liegen Indizien vor —, hat mit der Zensur direkt gewiß nichts zu tun, höchstens indirekt. Schiller sandte die Korrekturbogen an den Verleger Schwan in Mannheim; er hoffte jedenfalls, daß Schwan den Vertrieb des Werkes außerhalb Württembergs, im „Ausland“, veranlassen, wo nicht gar es völlig für seinen Verlag übernehmen würde. Auch ging durch ihn die Verbindung mit dem Freiherrn von Dalberg, dem Intendanten des Mannheimer Nationaltheaters. Wenn Schwan die Korrekturbogen mit zahlreichen handschriftlichen Randbemerkungen dem Dichter zurücksandte, so waren diese Änderungen zweifellos durch die Rücksicht auf die Buch- und Theaterzensur diktiert; wenn aber Schiller sich noch während des Drucks zu einschneidenden Änderungen entschloß, so waltete hier mehr eine strenge Selbstzensur, die seiner von Tag zu Tag reifer werdenden künstlerischen Einsicht entsprang. Der Anstößigkeiten sittlicher, religiöser und politischer Art, die jedem Zensor die Scham- und Zornesröte in die Wangen getrieben hätten, blieb ja noch eine Unmenge! Unmittelbar vor dem Druck der „Räuber“, im Januar 1781, hat der Stuttgarter Zensor, Rektor J. C. Voltz, Schillers „Elegie auf den frühzeitigen Tod Johann Christian Weckerlins“, die auf Kosten der Freunde des Verblichenen gedruckt wurde, in der Mache gehabt; die pädagogischen Bemerkungen, die er an den Rand des Manuskriptes malte, haben sich erhalten. Schiller hatte (Strophe I, Vers 8) geschrieben: „Einen Sohn — das Pralen seiner Mutter“; dazu bemerkte der Zensor: „Da diß Wort öfters in einer schlimmen Bedeutung gebraucht wird: so könnte es vielleicht mißdeutet, und übel aufgenommen werden.“ Strophe 7, Vers 8 lautete ursprünglich: „Pfaffen brüllend dich der Hölle weyhn“; der Zensor aber erklärte kategorisch: „Müssen weniger anstößige Ausdrücke gewählt werden“, und Schiller ersetzte die „Pfaffen“ durch „Manche“! Zu Strophe 7, Vers 10: „Und die Meze die Gerechtigkeit“ meinte der Zensor: „Möchte in einem satyrischen Aufsaze passiren, nicht aber in einem ernsthaften Gedichte“, und Schiller änderte: „Und die Falsche“ usw. Strophe 8, Vers 11: „Bruder! Diesem Teufelvollen Himmel“ verlangte der Zensor gemildert, Schiller bequemte sich und schrieb: „bosheitsvollen Himmel“, wodurch der Sinn völlig entstellt war. Und in Strophe 9, Vers 3: „Sterben ist der langen Narrheit Ende“ erschien dem Zensor die Zusammenstellung von Sterben und Narrheit unmöglich, er machte aus dem zweiten Wort „Torheit“. Am Schluß des Manuskriptes schrieb er: „Nach oben bemerkten Verbesserungen [sic!], welche nicht unterlassen werden derffen: Impr.“ Schiller mußte sich wohl oder übel fügen; alle „Verbesserungen“ des Zensors wurden gedruckt, nur die erste blieb unbeachtet. Beim zweiten Abdruck der „Elegie“ in der „Anthologie“ 1782 änderte Schiller die zweite Hälfte der ersten Strophe fast ganz, und die vom Zensor stilistisch bemäkelte Zeile hieß jetzt: „Einen Sohn, die Wonne seiner Mutter.“ An dieses Zensurerlebnis dachte Schiller gewiß, als er am 4. Februar 1781 an Freund von Hoven schrieb: „Die Fata meines Carmens verdienen eine mündliche Erzählung, denn sie sind zum Totlachen; ich spare sie also bis auf Wiedersehen auf. Bruder! ich fange an in Activität zu kommen, und das kleine hundsvöttische Ding hat mich in der Gegend herum berüchtigter gemacht als 20 Jahre Praxis. Aber es ist ein Namen wie desjenigen, der den Tempel zu Ephesus verbrannte. Gott sei mir gnädig!“ Wenn schon die harmlose Elegie ihrem Dichter solch herostratischen Ruhm im Schwabenländle einbrachte — was unter dem rektoralen Rotstift aus den „Räubern“ geworden wäre, ist nach diesen Proben leicht auszudenken. An dem „Non imprimatur“ für den ganzen „Schmarren“ war gar nicht zu zweifeln, und es wäre literarischer Selbstmord gewesen, dem Rektor Voltz das Manuskript auszuliefern.
Wenn daher von Zensurschicksalen der „Räuber“ die Rede ist, kommen immer nur die Verunstaltungen in Frage, die das Werk in der Retorte der Theaterzensur durchmachte, und da es wie ein Prairiebrand über die deutschen und österreichischen Bühnen raste, zeigen die amtlichen Löschanstalten, die man dagegen in Bewegung setzte, am besten, wes Geistes Kind die damalige Theaterzensur in deutschen und österreichischen Landen war. Die Bühnengeschichte der „Räuber“ ist aber so mannigfaltig und in ihren Einzelheiten noch so wenig durchforscht, daß hier nur der Abschnitt mitgeteilt werden kann, der die preußische Hauptstadt zum Schauplatz hat. Auf diesen Berliner Abschnitt werfen einige bisher völlig unbekannte Aktenstücke ein höchst überraschendes Licht.
So, wie sie waren, hätten sich die „Räuber“ unter den damaligen Zensurverhältnissen natürlich auch in Berlin nicht sehen lassen dürfen. Um sie bühnenfähig zu machen, nahm ein berüchtigter „Verhunzer“ klassischer Dramen, der Berliner Theaterdichter Karl Plümicke, sich ihrer an. Um den anstößigen Zwist zweier leiblichen Brüder zu mildern, degradierte Plümicke zunächst den Franz Moor zu einem Halbbruder Karls; dieser rothaarige Schurke Franz sollte überhaupt kein rechtmäßiger Grafensproß sein, deshalb mußte sich seine Mutter, die — gottlob tote — Gräfin von Moor, einen Ehebruch zuschieben lassen. Und damit auch Karl Moors Verbrechen augenfällig ihre Strafe fanden, mußte der Dolch Schweizers auf der Bühne das Rächeramt übernehmen. In dieser moralischen Verbesserung gingen die „Räuber“ am 1. Januar 1783 über die Bretter des Döbbelinschen Theaters in der Behrenstraße zu Berlin und erregten dennoch stürmischen Jubel, so daß sie fünfzehnmal schnell hintereinander wiederholt werden mußten.
Die echten „Räuber“ kamen erst unter dem ersten Generalintendanten, Graf Brühl (1815—1828), auf die Berliner Hofbühne. Nach der allgemeinen Zensurverschärfung, die 1819 mit den „Karlsbader Beschlüssen“ einsetzte und sich auch im Theaterleben auswirkte, blieb das Stück von den deutschen und österreichischen Theatern eine Weile verschwunden. 1825 wagte es Graf Brühl, sie endlich wieder hervorzuholen. König Friedrich Wilhelm III. besuchte Trauerspiele und ernste Schauspiele selten; Lustspiele und Possen, möglichst mit Ballett, waren ihm lieber. Erst vier Jahre später, als schon Brühls Nachfolger, Graf Redern, sein Amt angetreten hatte, sah er sich die ihm bis dato zweifellos unbekannten echten Schillerschen „Räuber“ an und war entsetzt über dies Gesindel, das sich da auf seiner Hofbühne eingenistet hatte. Sofort erließ er ein ungewöhnlich heftiges Verbot jeder Wiederholung. Von der Abneigung des Königs gegen Schillers Jugendwerk spricht der gut unterrichtete Varnhagen von Ense in seinen Tagebüchern schon unterm 4. April 1826, und daß der berühmte Schauspieler Karl Seydelmann 1838 seine Glanzrolle Franz Moor den Berlinern nicht vorführen durfte, war bekannt. Unbekannt aber war bisher der für Friedrich Wilhelm III. ungemein charakteristische Wortlaut des Verbots, der erst vierzehn Jahre später, nach dem Tode des Königs, aktenmäßig aufgezeichnet wurde. Im Oktober 1840, ein halbes Jahr nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV., bat der „Vaterländische Verein für erblindete Krieger aus den Jahren 1813 bis 15“ um eine Vorstellung auf der Hofbühne zum Besten seiner Kasse, und zwar der „Räuber“. Seit zwölf Jahren hatte man das Stück in Berlin nicht mehr zu sehen bekommen, der Kassenerfolg solch einer Wohltätigkeitsvorstellung schien dadurch gesichert. Der Geheime Kabinettsrat Dr. Müller sandte das Gesuch an den Intendanten von Redern, dieser aber antwortete pflichtschuldigst am 23. Oktober 1840:
„Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich auf das Schreiben vom 14. d. ganz ergebenst zu erwiedern, daß die Vorstellung des Trauerspiels ‚Die Räuber‘ seit dem Januar 1829 von dem Repertoire der Königl. Bühne gelöscht worden ist, weil des Hochseeligen Königs Majestät eine weitere Wiederholung nicht zu belieben geruhet haben.
Читать дальше