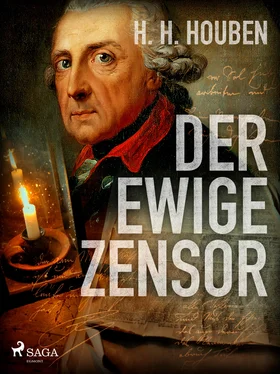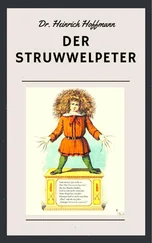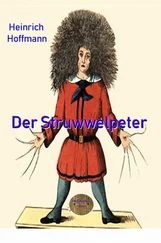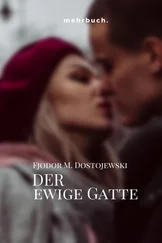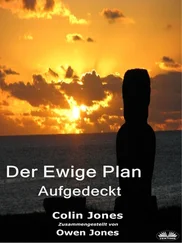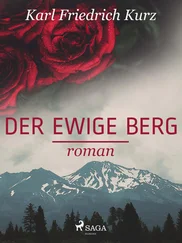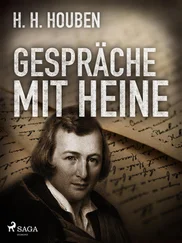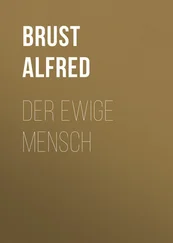Er hat mir Beifall zugenickt,
Als ich gespielt den Marquis Posa;
In Versen hab’ ich ihn entzückt,
Doch ihm gefiel nicht meine Prosa.
Die „Gedichte eines Lebendigen“, deren außerordentlicher Erfolg sich durch zahlreiche Auflagen bewies, enthielten unter anderen meisterhaften Versen das „Reiterlied“ („Die bange Nacht ist nun herum“), das unsere Feldgrauen während des Weltkrieges so oft sangen, wenn sie durch die Straßen ihrer Heimat zur Eisenbahn marschierten, die sie an die Front bringen sollte.
In Zürich bei demselben Verlag erschienen als Zensurflüchtlinge auch die politischen „Gedichte“ von Robert Prutz (1841) und seine aristophanische Komödie „Die politische Wochenstube“, die seiner akademischen Laufbahn ein vorschnelles Ende machte. Das „Literarische Comptoir“ brachte ferner mehrere Gedichtsammlungen von Hoffmann von Fallersleben, darunter seine „Deutschen Lieder aus der Schweiz“ (1842) mit dem „Lied der Deutschen“, das jetzt unsere eigentliche Nationalhymne geworden ist; auf neutralem Schweizer Boden ist also „Deutschland, Deutschland über alles“ als Zensurflüchtling zuerst — wenigstens in einer Liedersammlung des Dichters selbst — an die Öffentlichkeit getreten. Auch die „Hoffmannschen Tropfen“ und Hoffmanns „Deutsche Gassenlieder“, die „Unterthänigen Reden“ des Königsbergers Ludwig Walesrode, Ruges „Anekdota“, Schriften von Ludwig und Friedrich Feuerbach, von Bruno und Edgar Bauer, Johann Jacoby, Wilhelm Schulz und zahlreichen anderen kamen aus Zürich.
Im „Literarischen Comptoir“ erschien 1843 auch ein Bändchen, das diesem Kapitel den Namen gegeben hat: zwölf Freiheitslieder unter dem Titel „Zensur-Flüchtlinge“. Ihr ungenannter Verfasser war der junge Rudolf Gottschall, der damals in Königsberg die Rechte studierte. Bei einem dortigen Verleger hatte er soeben, gleichfalls ohne Namen, seine ersten lyrischen Versuche als „Lieder der Gegenwart“ herausgebracht. Der ihm von der Gymnasialzeit her gewogene Schuldirektor Lucas hatte dabei als Zensor gewaltet; bei einer gemütlichen Tasse Kaffee hatten Zensor und Autor in aller Freundschaft beraten, welche der Gedichte ihres Freisinns wegen dem Rotstift zum Opfer fallen mußten. Dabei hatten sich die obigen zwölf Freiheitslieder, die besten der ganzen Sammlung, als unrettbar erwiesen; für sie konnte der Schulmann als amtlich bestallter Zensor die Druckerlaubnis nicht geben. Sie wanderten also nach der Schweiz, und so spie das „doppelt geöffnete“ Tor zwei Gottschallbändchen auf einmal hervor.
Wie die deutschen Dichter des Vormärz mit ihren Büchern nach der Schweiz gingen, so die österreichischen nach Deutschland, wo man, wenigstens über Österreich, noch immer mehr sagen durfte als innerhalb der schwarzgelben Grenzpfähle. Dem Gesetz nach durfte kein k. k. Österreicher im Ausland irgend etwas drucken lassen, was nicht die einheimische Zensur gebilligt hatte, und sie billigte sehr wenig. Grillparzer und v. Zedlitz unterwarfen sich ihr ohne Widerrede. Der Dramatiker Eduard v. Bauernfeld war so kühn, ihr offen zu trotzen. Er ließ 1837 sein Lustspiel „Der literarische Salon“ unter seinem Namen bei Brockhaus in Leipzig, in dessen „Taschenbuch dramatischer Originalien“ (II. Jahrgg.), erscheinen, obgleich das Stück — eine völlig berechtigte Satire auf die damals in Wien tätigen Revolverjournalisten Saphir und Bäuerle — nach der ersten Aufführung am Burgtheater verboten worden war und die Wiener Zensur die Veröffentlichung ausdrücklich untersagt hatte. Ein Strafverfahren gegen den Dichter wurde begonnen, aber niedergeschlagen; die Polizei fürchtete jedenfalls Bauernfelds scharfe Zunge, wie sie ja auch Saphir fürchtete, dem zuliebe das Verbot des „Literarischen Salons“ ergangen war. Wem aber diese Kühnheit fehlte, dem blieb nichts übrig, als seine Werke unter fremdem Namen als Zensurflüchtlinge ins Ausland zu schicken oder selber einer zu werden. Daher die bekannten Decknamen hervorragender österreichischer Dichter in jener Zeit. Graf Anton von Auersperg verbarg sich unter dem Namen Anastasius Grün und verleugnete diesen selbst dann noch, als der Chamisso-Schwabsche Musenalmanach 1836 das getreue Jugendporträt des schnell berühmt gewordenen Lyrikers brachte. Erst 1837 zwang ihn eine persönliche Ehrenkränkung durch einen Polizeispitzel, den Dichter Braun von Braunthal, öffentlich für sein Pseudonym einzutreten. Als er kurz darauf beim österreichischen Staatskanzler, dem Fürsten Metternich, eine Audienz hatte, weil er nach dem Beispiel vieler anderer Landsleute auswandern wollte, und dabei aus seiner Identität mit Anastasius Grün zum erstenmal kein Hehl machte, lauschte der Wiener Polizeipräsident hinter einer spanischen Wand. Beinahe wäre Auersperg im Paletot des Präsidenten nach Hause gegangen; der Irrtum des Dieners in der Garderobe klärte ihn zufällig darüber auf, was die Geräusche zu bedeuten hatten, die er während der Unterredung mit Metternich zwar gehört, aber nicht beachtet hatte. Er war vornehm genug, dem Polizeipräsidenten die Beschämung zu ersparen, die Tatsache seiner Lauschertätigkeit zu den Akten geben zu müssen: er veröffentlichte alsbald ein neues Gedicht und unterzeichnete es mit seinem richtigen Namen und dem bekannten Pseudonym. Das Gedicht wurde von der Zensur durchgelassen. Damit war nun endlich der juristische Beweis für die Identität Auerspergs mit Grün in den Händen der Polizei, und prompt erhielt der entlarvte Verbrecher eine mit Rücksicht auf seinen hohen Stand noch niedrig bemessene Geldstrafe, weil er „höchst anstößige“ Schriften im Ausland habe drucken lassen. Diese Schriften waren seine „Blätter der Liebe“ (1829) „Der letzte Ritter“ (1830) und „Schutt“ (1835)! Das berühmteste seiner Werke, die „Spaziergänge eines Wiener Poeten“ (1832), das in Österreich und Deutschland ungeheuer zündete und die gesamte politische Lyrik des Vormärz aufs stärkste beeinflußte und befruchtete, war 1832 völlig namenlos bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienen, aber Auersperg hütete sich sorgfältig, auch dessen Urheberschaft zuzugeben, sonst wäre es mit einer Geldstrafe nicht abgetan gewesen.
Aus demselben Grunde nannte sich Niembsch von Strehlenau als Dichter Nikolaus Lenau, nahm Heinrich Landesmann den Namen Hieronymus Lorm an. Wer aber dieses Versteckspiel nicht durchführen zu können glaubte, denn unter Umständen gehörte dazu eine große Geistesgegenwart, dem blieb nichts anderes übrig, als den Staub des unbehaglichen Vaterlandes von den Füßen zu schütteln und außerhalb Österreichs das unsichere Leben eines Zensurflüchtlings zu führen. So kamen die Lyriker Karl Beck, Moritz Hartmann, Alfred Meißner und Karl Herlossohn, Ignaz Kuranda, der Begründer der „Grenzboten“, und andere dii minorum gentium nach Deutschland, und wenn sie sich dort nicht mehr sicher fühlten, gingen sie gleich Börne, Heine, Herwegh, Ruge, Karl Marx und zahllosen andern nach Paris, dem eigentlichen Sammelpunkt aller Zensurflüchtlinge. Denn die deutsche Polizei war gar zu gern bereit, der österreichischen Kollegin Helfersdienste zu leisten. Ein Erlebnis Alfred Meißners ist für diese vormärzlichen Zustände bezeichnend. Er hatte 1846 sein Epos „Ziska“ ohne Vorwissen der österreichischen Zensur in Leipzig herausgegeben und sich, um allen Verfolgungen zu entgehen, in Dresden niedergelassen. Da wurde eines Morgens ein Brief ohne Unterschrift an ihn abgegeben; er enthielt ein lithographiertes „Kreisrundschreiben“ seiner Prager Heimatbehörde, das alle böhmischen Amtsvorsteher auf den von der Zensur streng verbotenen „Ziska“ aufmerksam machte. Ein unbekannter Freund wollte offenbar den Dichter warnen. Als Meißner am Abend desselben Tages von einem Zusammensein mit Richard Wagner, dem Maler Friedrich Pecht und dem Bildhauer Hähnel nach Hause ging, redete ihn auf der dunklen Straße ein Unbekannter an und teilte ihm mit, zwei Polizeikommissare hätten sich sein Zimmer aufschließen lassen und erwarteten ihn dort; auch ein Schlosser sei geholt worden, und die unwillkommenen Gäste hätten unterdes gewiß schon jede Schublade erbrochen und alle Papiere untersucht und beschlagnahmt. Der freundliche Warner — ein in Meißners Nähe wohnender Friseur — hatte Mitleid mit dem jungen, fröhlichen Dichter empfunden, den er von Ansehen kannte, und es sich nicht verdrießen lassen, mehrere Stunden im Regenwetter der Straße auf ihn zu warten. Meißner wußte, was ihm bevorstand, die Dresdener Polizei besorgte die Geschäfte der benachbarten böhmischen; aber er hütete sich, ihr ins Garn zu gehen, sondern eilte sofort zum Bahnhof, um mit dem nächsten Zug das auslieferungslustige Sachsen zu verlassen. Und wenn die beiden Zensurkommissare in Dresden nicht gestorben sind, so warten sie auf den Dichter des „Ziska“ noch heute.
Читать дальше