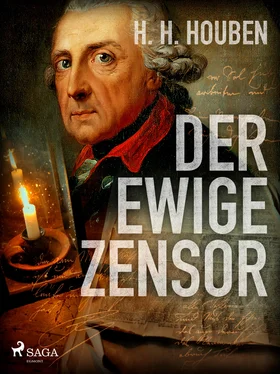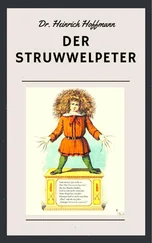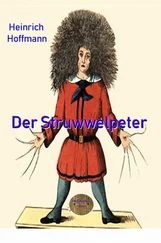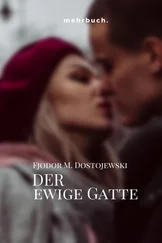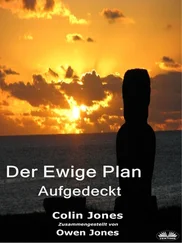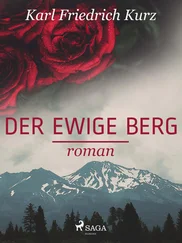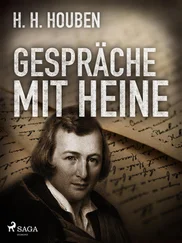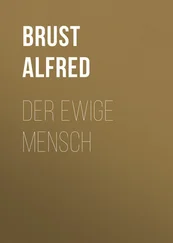Hammers erfolgreiches Wirken hatte aber Schule gemacht, und besonders nach der Julirevolution, als der Kampf zwischen Literatur und Zensur seinen Höhepunkt erreichte, schossen die fingierten Verlagsorte und -firmen wie Pilze aus der Erde. Als Ludwig Börnes „Briefe aus Paris“ (Band 1 und 2, bei Hoffmann und Campe, 1832) allenthalben heftig verboten wurden, erschien die Fortsetzung, Band 3 und 4, unter dem humoristisch harmlosen Titel „Mittheilungen aus dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde“ bei L. Brunet in Offenbach (1833), einer völlig unbekannten Firma, der Schluß, Band 5 und 6 (1834), wieder unter dem richtigen Titel bei derselben Firma, die diesmal in Paris domizilierte. In Wirklichkeit steckte natürlich der Hamburger Verlag dahinter, der die Fortsetzung wenigstens vertrieb, wenn auch der Verfasser vom 3. Bande ab, da er mit Campe die üblichen Honorardifferenzen gehabt hatte, hier den Selbstverleger gespielt zu haben scheint. Als die preußischen und sächsischen Behörden nach dem geheimnisvollen Unbekannten Brunet eifrig recherchierten, versicherte der Kommissionär dieser neuen Firma, F. Volckmar in Leipzig, Brunet sei niemand anders als Börne selbst, der unerreichbar und sicher in Paris saß. Und „L. Brunet“ klang ja auch fast wie L. Börne. Tauchte solch eine Novität auf, so wußte jeder Buchhändler, was das zu bedeuten hatte, daß dies Opus in weitem Bogen um jede Zensurstelle herumgegangen war, und meist stand auch ein entsprechender Hinweis auf der Buchhändlerfaktur, auf der Rechnung, die der Sendung beilag. Die nachstehende Abbildung ist ein interessantes Dokument: mit dieser Faktur sandte der unbekannte Verleger L. Brunet die „Mittheilungen aus dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde“ Band 1 und 2 an eine Torgauer Buchhandlung, fügte aber handschriftlich hinzu, daß es sich um Band 3 und 4 der überall bekannten Börneschen „Briefe“ handle, die in den meisten deutschen Bundesstaaten verboten waren; und daß es mit dieser Fortsetzung ähnlich ergehen werde, besagt die gedruckte Nachschrift. Behielt der Empfänger die Sendung, so war es seine Aufgabe, die gefährliche Kontrebande sogleich an den Mann zu bringen, ehe die Polizei in seinem Laden erschien und sie beschlagnahmte; das dauerte allerdings meist eine gute Weile. Als die gefährlichen „Deutsch-französischen Jahrbücher“ von Karl Marx und Arnold Ruge 1845 von der Schweiz aus verbreitet wurden, figurierten sie auf den Fakturen als „Deutsch-französische Gespräche“.
Noch größeres Kopfzerbrechen als Brunet verursachte den deutschen Polizeibehörden eine Firma, die 1833 die unverstümmelte Vorrede zu Heines „Französischen Zuständen“ herausbrachte, von der in Kapitel 8 ausführlicher die Rede ist. „Heideloff und Campe in Leipzig“, meldete sogleich der preußische Gesandte in Dresden, gebe es nicht, wohl aber in Paris. Der Leipziger Kommissionär der Pariser Firma, J. C. Ch. Kirbach (Dycksche Buchhandlung), war natürlich unschuldig wie ein Kind; er bekam von Paris nur verschnürte Ballen; was darin stecke, wisse er nicht. Als der preußische Gesandte in Paris ein Verzeichnis der Verlagswerke der Pariser Firma liefern sollte, erklärte er, das sei unmöglich, denn die meisten davon gingen unter falscher Firma hinaus. Bei „Karl Heideloff in Paris“ erschien 1831 eine Flugschrift „Ueber die polnische Frage“; in Wirklichkeit war F. A. Brockhaus der Verleger; in Leipzig wurde sie gedruckt, mit Fakturen Heideloffs versandt, dieser rechnete auf der Messe mit den Buchhändlern ab und setzte sich dann mit dem wirklichen Unternehmer auseinander. So wahrte man das Gesicht. Leipzig war überhaupt ein Zufluchtsort der polnischen Revolutionäre bis in die fünfziger Jahre hinein, und die meisten dortigen Buchhändler machten mit ihnen Geschäfte. Über die Pariser Firma führten nun die preußischen Behörden eine gewaltige Untersuchung. Friedrich Napoleon Campe, der Teilhaber, war ein Neffe des berüchtigten Hamburger Verlegers, Heideloff selbst war Mitglied des deutschen revolutionären Komitees in Paris; in Nürnberg fand sich eine „Kommandite“ des Pariser Hauses, dort betrieb Friedrich Campe, der Bruder des Hamburgers und Vater des jungen Napoleon, eine Druckerei, aus der auch Börnes „Briefe aus Paris“ hervorgegangen waren. Man verkehrte untereinander nie direkt, alles ging durch die Hand des Leipziger Kommissionärs. Auf preußische Reklamation mußte der Nürnberger Verleger und Druckereibesitzer, Doktor und „Magistrat“ Friedrich Campe vor dem Stadtrichter erscheinen. Er wies jeden Schatten eines Verdachtes mit verräterischem Pathos von sich; Heideloff und Campe seien fern von allem revolutionären Treiben und wegen ihrer legitimistischen Gesinnung bei allen Pariser Demagogen verhaßt; er selbst, so beteuerte er „vor Gott“, sei ebenfalls „rein von jeglicher Verbreitung revolutionärer Schriften“ — denn Drucken und Verbreiten der Börneschen „Briefe“ war ja zweierlei! Er habe „mit Indignation“ alle ihm erreichbaren Exemplare der Heineschen Vorrede vernichtet. Statt nach Heideloff und Campe solle sich die Polizei lieber in Leipzig bei Volckmar nach L. Brunet erkundigen, dann werde er, „der graue Vater“, und ebenso sein „braver Sohn“, der gleichwohl mit dem Pariser assoziiert war, ehrenvoll dastehen. Jeder redete sich so gut heraus wie er konnte, völlige Klarheit gewann die Behörde nicht, die Akten darüber schwollen unheimlich an und endeten am 21. Juni 1834 mit einem Generalverbot aller Schriften, die die verdächtigen Firmen Heideloff und Campe und ebenso L. Brunet auf dem Titelblatt trugen oder noch tragen würden; denn in solchen Fällen machte man in Berlin kurzen Prozeß und verbot auch das, was noch gar nicht erschienen war. 1842 erreichte auch die Hamburger Firma Hoffmann und Campe dieses Schicksal; der Brand von Hamburg im Mai dieses Jahres erweichte dann aber das Herz des Königs, und die Maßregel wurde wieder aufgehoben.
Um diese Zeit war ein großer Teil der jungen deutschen Literatur, vor allem die sich mächtig entfaltende politische Lyrik, völlig ins Ausland abgewandert, und zwar nach der Schweiz, nach Zürich, wo der Publizist und Politiker Julius Fröbel, ein Neffe des bekannten Pädagogen, einen Buchverlag, das „Literarische Comptoir“ (Zürich und Winterthur), gegründet hatte, um der jungen Literatur eine Gasse durch das Sperrfeuer der deutschen Zensur zu brechen. Fröbel war damals Professor der Mineralogie an der Züricher Universität; die buchhändlerische Tätigkeit nahm ihn aber bald so stark in Anspruch, daß er seine akademische Laufbahn aufgab, um sich ganz dem Geschäft zu widmen. Der bekannte Demokrat und Dichter August Follen war Mitinhaber dieses Verlagsunternehmens, das trotz großer Erfolge und kaufmännischer Geschicklichkeit durch steten Mangel an Betriebskapital nie recht auf einen grünen Zweig kam. 1845 war auch Arnold Ruge daran beteiligt. Im „Literarischen Comptoir“ erschienen 1841 Georg Herweghs „Gedichte eines Lebendigen“, deren Zauber ganz Deutschland berauschte und selbst Friedrich Wilhelm IV. Bewunderung abnötigte; als der Dichter ein Jahr darauf eine Triumphreise durch Deutschland machte, beschied ihn der preußische König zu einer Audienz, in der er ihn seiner Vorliebe für eine „gesinnungsvolle Opposition“ versicherte. Das hielt aber die preußische Zensur nicht ab, zur selben Stunde eine von Herwegh angekündigte neue Zeitschrift, den „Deutschen Boten aus der Schweiz“, zu verbieten, noch ehe das erste Heft im „Literarischen Comptoir“ erschienen war. Herwegh beschwerte sich darüber in einem kecken Brief an den König; indiskrete Freunde brachten das Schriftstück alsbald in die Presse, und das Ergebnis der Begegnung zwischen Sänger und König war, daß dem ersteren dringend geraten wurde, sich nicht mehr innerhalb der preußischen Grenzpfähle blicken zu lassen. Die ganze Audienz, ihre Vor- und Nachgeschichte, machte damals ungeheures Aufsehen; die Gesinnungsgenossen des Dichters waren von seinem Auftreten auf dem höfischen Parkett keineswegs erbaut, und ein anonymer Karikaturenzeichner stellte die zwei Szenen nebeneinander: links Herwegh, wie er trotzig vor dem Bilde des Königs steht, dem er mit seinen „Gedichten eines Lebendigen“ den Handschuh hingeworfen; rechts die Vorstellung des Dichters vor dem König selbst durch dessen Leibarzt Schönlein, wobei der Dichter seinen devoten Bückling macht wie jede andere Hofschranze (vgl. Abbildung S. 48). Heine hat die „Audienz“ in einem boshaften Gedicht verewigt und die Veröffentlichung des Briefes köstlich persifliert mit den Versen:
Читать дальше