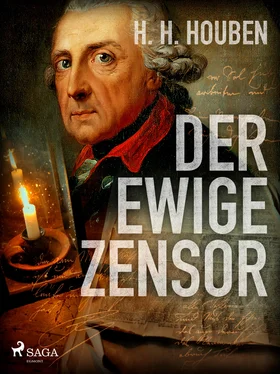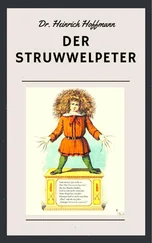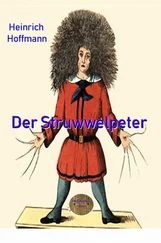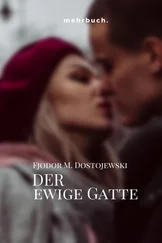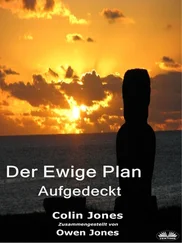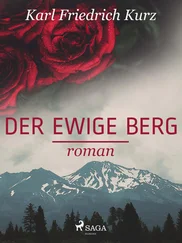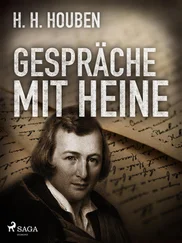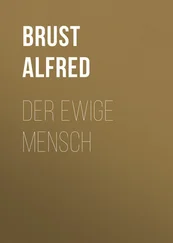Heinrich Hubert Houben - Der ewige Zensor
Здесь есть возможность читать онлайн «Heinrich Hubert Houben - Der ewige Zensor» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der ewige Zensor
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der ewige Zensor: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der ewige Zensor»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der ewige Zensor — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der ewige Zensor», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Van Swieten war auch der Begründer des österreichischen „Catalogus librorum prohibitorum“, des gedruckten Verzeichnisses verbotener Bücher, das zur schnelleren Unterrichtung der Behörden und Buchhändler und zur nachdrücklicheren Durchführung seiner Verbote von 1754 bis 1780 in immer wieder revidierten und bereicherten Neuausgaben im Druck erschien und alsbald ein — sehr gesuchter Führer durch die anrüchige Literatur wurde, der, wie der schon oben erwähnte Berliner Schriftsteller und Buchhändler Friedrich Nicolai mit Recht sagte, die schlechten Leute die schlechten und die klugen Leute die klugen Bücher erst kennen lehrte. So wurde die löbliche Zensurhofkommission selbst die Verfasserin des gefährlichsten aller Bücher, und es ist erstaunlich genug, daß sie erst 1777 zu dieser Erkenntnis kam und daraus den logischen Schluß zog: sie setzte den von Sammlern und Buchhändlern vielbegehrten Katalog selbst auf den Index; er war von da ab nur noch Beamten und „erga schedam“ (gegen schriftliche, nur persönlich bewilligte Erlaubnis) Gelehrten zugänglich, die ihn von Amts oder Geschäfts wegen brauchten. —
In den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts war der Geschäftsgang der Zensur in Österreich folgender:
Was an Büchern von auswärts nach Österreich gesandt wurde, landete zunächst an der Grenze auf der Büchermaut, in deren unmittelbarer Nähe der Sekretär der Zensurkommission sein Amtszimmer hatte. Ihm wurden die Bücherpakete zugestellt und die Namen der Besitzer gemeldet. Was dem Sekretär als erlaubt bekannt war, wurde bald wieder zurückgegeben; was ihm unbekannt war, also jede Neuerscheinung, oder sonstwie bedenklich erschien, überwies er den zuständigen Mitgliedern der Zensurkommission. Bücher, die schon auf dem Index standen, beschlagnahmte er.
Die sieben Mitglieder der Wiener Zensurhofkommission versammelten sich nebst dem Sekretär monatlich ein oder mehrere Male, und die einzelnen Zensoren berichteten über die von ihnen geprüften Bücher. Die bedenklichen Stellen las man vor, und wenn die sieben Weisen sich darüber einigten, daß durch jene Äußerungen die Religion, der Staat, die guten Sitten, die Liebe des Nächsten oder die Ehrfurcht, die man „denen Hohen“ schuldig war, gefährdet seien, wurde darüber ein Protokoll aufgenommen. Dieses wanderte zur Hofkanzlei und von da zur Kaiserin, der auf diese Weise nicht nur die epochemachenden wissenschaftlichen Werke, sondern auch der massenhafte Abhub der unsittlichen Literatur vor Augen kam. Bestätigte sie das Urteil der Kommission, so wurde der Titel des Buches in den Katalog der verbotenen Bücher aufgenommen. Die Exemplare selbst versiegelte man, sandte sie an den Absender zurück oder schaffte sie sonstwie über die Grenze. Bücher, die man nicht unbedingt verbieten wollte, gab man ihren Besitzern zurück, wenn sie ausdrücklich um die Erlaubnis baten, „erga schedam“ (gegen Erlaubniszettel); manchem war natürlich diese Formalität unbehaglich, und er verzichtete lieber auf sein Eigentum. Auch unkatholische Bücher, falls sie keine Lästerungen der katholischen Kirche enthielten, wurden den Andersgläubigen zum Gebrauch überlassen, wenn die betreffende Religion in dem jeweiligen Landesteil geduldet war. Diese ganze Prozedur dauerte natürlich etliche Monate, und jede auch harmlose Neuerscheinung kam daher mit großer Verspätung in die Hände der österreichischen Leser.
Nur die Bücher, die schon geprüft und verboten waren, verfielen der Beschlagnahme oder Vernichtung. Zu den Sitzungen der Kommission brachte der Sekretär diese von ihm angehaltenen Bücher mit, las das Verzeichnis derselben vor nebst den Namen der Besitzer, und dann machten sich die würdigen Herren daran, eigenhändig diese Kontrebande zu zerreißen und zu verbrennen. Theologische und staatswissenschaftliche Schriften verschonte man und überwies sie der Kaiserlichen und Erzbischöflichen Bibliothek, wenn sie dort noch fehlten. Solche verbotene Schriften wurden, wenn sie nicht unbedingt verwerflich waren, sondern nur anstößige Stellen enthielten, wenigstens seit 1766 Jurch die Initiative Kaiser Josephs den Gelehrten, die sie für ihren Beruf brauchten, „erga schedam“ ausgeliehen. „Professoren wird so ziemlich alles in die Hand gegeben“, schrieb Sonnenfels am 17. Dezember 1768 an Klotz. Die anstößigen protestantischen Bücher wurden im hintersten Zimmer der Kaiserlichen Bibliothek verwahrt; wer eines davon entleihen wollte, mußte sogar erst beim päpstlichen Nuntius in Wien gegen Bezahlung von Gebühren die Erlaubnis erbitten, die ganz nach Gutdünken erteilt oder verweigert wurde. Dieser Unterschied zwischen dem kleinen Kreis der Gebildeten und der großen Masse blieb von da ab ein Merkmal der ganzen Zensurgesetzgebung Österreichs.
Natürlich gab es bei dem Verfahren auch Hintertüren. Nicht immer wurden die ganzen Bücher verboten, oft nur einzelne Bogen oder Blätter daraus. War man mit dem Sekretär befreundet, berichtet Nicolai, so wurden die beanstandeten Blätter nicht heraus-, sondern nur durchgeschnitten. Außerdem trieben die Unterbeamten mit den herausgeschnittenen Blättern einen schwunghaften Handel. Selbst die zum Feuertode verurteilten Bücher oder Blätter waren durch die käufliche Gunst der Unterbeamten zu retten; sie wurden nur angebrannt.
Derselben Zensurkommission wurden, seitdem die Prüfung der in Österreich selbst zu druckenden Bücher den Jesuiten durch van Swieten endgültig entzogen war, auch die Manuskripte vorgelegt, und zwar mußten sie in zwei Exemplaren eingereicht werden, was in einer Zeit, wo man noch keine Schreibmaschine besaß, eine große Last für die Verfasser bedeutete. Das eine Exemplar wurde vom Zensor begutachtet und dann auf dem Zensuramt zur späteren Kontrolle behalten; das zweite erhielt der Verleger oder Autor mit dem Vermerk der Erlaubnis oder des Verbotes zurück. —
Nach van Swietens Tode 1772 fiel die Zensur bald in ihre alten Übel zurück, und der Klerus gewann in der Kommission wieder das Übergewicht. Der neue Präsident der Zensurhofkommission stand den mit frischer Keckheit auftretenden Anmaßungen der Geistlichkeit hilflos gegenüber, und so konnte es nicht fehlen, daß die Jesuiten, obgleich ihr Orden 1773 auch in Österreich aufgelöst wurde, verstärkten Einfluß auf den Gang der Zensurgeschäfte gewannen. Besaßen sie doch noch immer das Ohr der Kaiserin, der jetzt ein energischer Berater wie van Swieten fehlte. Hatte ein Jesuit oder sonst ein Betbruder, erzählt Nicolai, an einem Buche Ärgernis genommen, so steckte er sich hinter eine Kammerfrau der Fürstin; er zeigte ihr etliche mit Rotstift angestrichene Stellen des Buches, die anstößig erscheinen konnten, und die Kammerfrau legte sie der Kaiserin vor. Auf den Zusammenhang des Textes wurde keine Rücksicht genommen, und ein kaiserliches Handbillett verfügte kurzweg das Verbot. Auf diese Weise soll 1774 wegen einer falschen Interpunktion, die eine Stelle über Christus und Mohammed verunstaltet hatte, Wielands „Deutscher Merkur“ wegen vermeintlicher Gotteslästerung verboten worden sein. Als schließlich vernünftige Leute die Kaiserin über den Zusammenhang aufklärten, wurde das Verbot wieder aufgehoben.
3. Philosoph und könig.
Das trübste Zensurwetter, das die deutsche Literatur je zu verzeichnen hatte, herrschte unstreitig unter der Regierung Friedrich Wilhelms II. und seines Justizministers Wöllner, von dem Friedrich der Große in einer seiner lapidaren Marginalien zu den Akten gegeben hatte: „Der Wöllner ist ein betrügerischer und intriganter Pfaffe, weiter nichts.“ Das von ihm selbst geschaffene Zensuredikt vom 19. Dezember 1788 genügte ihm schon nach zwei Jahren nicht mehr, und die oberste Zensurbehörde, das Oberkonsistorium, gefiel ihm schon gar nicht, da es „viel zu leichtsinnig“ verfuhr. Durch neue Bestimmungen wurde die Zensurschraube immer schärfer angezogen, und dem Oberkonsistorium wurde eine von ihm unabhängige geistliche Aufsichtskommission auf die Nase gesetzt, die „Immediat-Examinationskommission“, die alle preußischen Pfarramtskandidaten zu prüfen hatte und deren spiritus rector ein ehemaliger Breslauer Oberlehrer, namens Hillmer, war, der durch seine mystischen Neigungen das Vertrauen des Königs gewonnen hatte. Diese Kommission wurde zunächst mit der Zensur der theologischen und moralilischen Schriften beauftragt, und sie wußte sich nach und nach des ganzen Zensurgeschäftes zu bemächtigen. Nach dem Vorbilde Österreichs sollte auch in Preußen kein gedrucktes Blatt verbreitet werden, das nicht von der Zensur genehmigtwar, ein Index verbotener Bücher wurde geplant, und die ganze Büchereinfuhr wurde einer scharfen Kontrolle unterworfen. Der König stand ganz auf seiten dieser Kommission, drohte gelegentlich mit „Leib- und Lebensstrafen“ für Zensurvergehen, und ein Mann wie Immanuel Kant, der berühmte Königsberger Philosoph, mußte sich durch ein geradezu beispielloses Ministerialreskript vom 1. Oktober 1794 wie ein Schulbube herunterputzen lassen (vgl. das Faksimile auf Seite 31). Auf der Gegenseite standen natürlich die Schriftsteller und Buchhändler, die mit Recht über den Rückgang ihres Gewerbes klagten, denn eine förmliche Literaturflucht aus Berlin hatte eingesetzt, und ihre Proteste wurden in einer bewundernswert kühnen Art durch die gesamten Ministerien unterstützt, die mit überlegenem Geschick jeder Maßregel der Immediatkommission die Spitze abbrachen und selbst den Ausbrüchen königlichen Zornes mannhaft entgegentraten, bis endlich die Götzendämmerung erfolgte und mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III. eine neue Morgenröte der Freiheit heraufzudämmern begann — eine Morgenröte, die sich allerdings nur zu bald in tiefe Nacht verlor. Vier Monate nach seiner Thronbesteigung entließ der junge Monarch den allmächtigen Minister; Wöllners Kreaturen von der Immediatkommission wurden mit kleinen Pensionen abgebaut, und das Ministerium stellte ihnen das Abgangszeugnis aus, daß sie „in ihren bisherigen Verhältnissen nichts geleistet hätten und auch fernerhin keinen Nutzen bringen würden“.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der ewige Zensor»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der ewige Zensor» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der ewige Zensor» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.