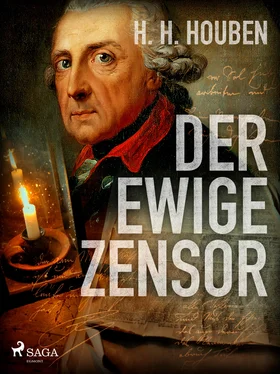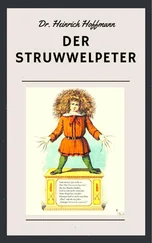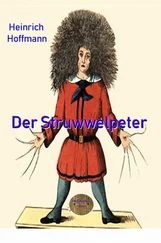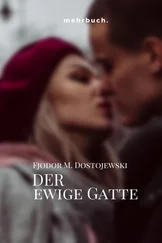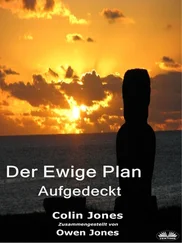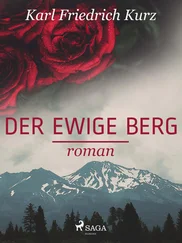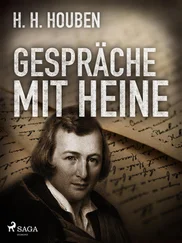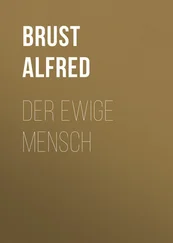Heinrich Hubert Houben - Der ewige Zensor
Здесь есть возможность читать онлайн «Heinrich Hubert Houben - Der ewige Zensor» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der ewige Zensor
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der ewige Zensor: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der ewige Zensor»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der ewige Zensor — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der ewige Zensor», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Als Beginn einer neuen Ära begrüßte daher Preußen den Entschluß des neuen Königs Friedrich Wilhelm IV., der im Frühjahr 1841 durch sein „Propositionsdekret“ über die ständischen Ausschüsse eine, wenn auch noch umgrenzte Veröffentlichung der Landtagsverhandlungen zugestand und sie damit der Willkür des Zensors entzog. Die Namen der Redner durften aber auch jetzt nicht genannt werden; diese Errungenschaft bescherte erst das Jahr 1847; gleichzeitig damit wurde der Presse endlich auch die Mitteilung der vollständigen Landtagsberichte freigegeben.
Im übrigen war Friedrich Wilhelm IV. auf die Gazetten genau so schlecht zu sprechen wie sein Vater. Er gefiel sich zwar darin, durch Befreiung der Tagespresse vom Zensurknebel „eine größere Teilnahme an vaterländischen Interessen“ erwecken und „so das Nationalgefühl erhöhen“ zu wollen; aber was ihm im Rausch rednerischer Begeisterung an solchen Verheißungen über die Lippen strömte, nahm er im nächsten Satz gewöhnlich wieder zurück, und vereinzelte Zensurerleichterungen, die er der Buchliteratur gewährte, änderten nichts an der Tatsache, daß die Verbote unliebsamer Blätter, wie der „Rheinischen Zeitung“ von Karl Marx in Köln, der „Leipziger Allgemeinen Zeitung“, der „Hallischen (Deutschen) Jahrbücher“ von Ruge usw., ein bezeichnendes Merkmal gerade seiner ersten Regierungsjahre bilden. Als er am 31. Januar 1843 eine neue Instruktion für die Zensur unterzeichnete, leitete er sie mit der Erklärung ein, daß die meisten Zensoren seine früheren Befehle über die Behandlung der Zeitungspresse „gänzlich mißververstanden und durch ungeschickte Behandlung der Sache völlig verfehlt“ hätten. „Die dadurch veranlaßten, immer zunehmenden Ausschreitungen der Tageblätter machen daher angemessenere Instruktionen für die Zensoren unumgänglich nötig. Was Ich durch die genannten Verordnungen gewollt, das will Ich unveränderlich noch: die Wissenschaft und die Literatur von jeder sie hemmenden Fessel befreien und ihr dadurch den vollen Einfluß auf das geistige Leben der Nation sichern, der ihrer Natur und ihrer Würde entspricht; der Tagespresse aber innerhalb des Gebiets, in welchem auch sie Heilsames in reichem Maße wirken kann, wenn sie ihren wahren Beruf nicht verkennt, alle zulässige Freiheit dazu gestatten. Was Ich nicht will, ist: die Auflösung der Wissenschaft, und Literatur in Zeitungsschreiberei, die Gleichstellung beider in Würde und Ansprüchen, das Übel schrankenloser Verbreitung verführerischer Irrtümer und verderbter Theorien über die heiligsten und ehrwürdigsten Angelegenheiten der Gesellschaft auf dem leichtesten Wege und in der flüchtigsten Form unter einer Klasse der Bevölkerung, welcher diese Form lockender, und Zeitungsblätter zugänglicher sind, als die Produkte ernstlicher Prüfung und gründlicher Wissenschaft.“ Und was nun als Instruktion für die Zensoren folgte, nahm durchweg den Wortschatz des Wöllnerschen Zensuredikts und der Verordnung vom 18. Oktober 1819 wieder auf und verschärfte die alte Bedingung der „bescheidenen anständigen Form“ noch durch die weitere Forderung einer „wohlmeinenden Absicht“, die herauszufühlen nach wie vor die Aufgabe des mehr oder weniger psychologisch veranlagten Zensors blieb. Und wie wenig der König selbst auch bei der leisesten Kritik an die „wohlmeinende Absicht“ des Zeitungsschreibers zu glauben geneigt war, zeigte gleich hinterher sein Rekontre mit dem Schriftsteller, den die Mark Brandenburg und ihr Fürstenhaus als ihren ersten und damals einzigen Heimatdichter mit Jubel hätte auf den Schild erheben sollen. Willibald Alexis, der hier gemeinte, schrieb Anfang 1843 etliche Leitartikel für die „Vossische Zeitung“. Einer davon beschäftigte sich mit dem aktuellsten Stoff des Tages, mit der Preßfreiheit und den neusten Zeitungsverboten, wurde aber von den beiden amtierenden Zensoren derart zugerichtet, daß Alexis gut zu tun glaubte, den Hergang dem Könige vorzulegen, damit dieser sehe, wie die neue Zensurinstruktion gehandhabt werde. Der König, meinte er, würde so etwas gewiß nicht für möglich halten, wenn er sich nicht durch eigenen Augenschein davon überzeuge. An „wohlmeinender Absicht“ habe es bei diesem Zeitungsartikel nicht gefehlt, er habe, ganz im Sinne des Königs, dazu dienen sollen, „diese opponirenden Artikel frei zu halten von den leeren, hohlen Theorien jüngerer Schulen, welche nur negiren und einen systematischen Krieg allem Positiven erklären“. Der Erfolg dieser berechtigten Beschwerde war die bekannte Kabinettsorder vom 26. März 1843, die, ähnlich wie die Ministerialverfügung Wöllners gegen den Philosophen Kant, den Dichter des „Cabanis“, mit den Worten herunterkanzelte: „Mit Widerwillen habe ich einen Mann von Ihrer Bildung und literarischen Bekanntheit durch jenen Artikel unter der Klasse derer gefunden, die es sich zum Geschäft machen, die Verwaltung des Landes durch hohle Beurtheilung ihres Thuns, durch unüberlegte Verdächtigung ihres nicht von Ihnen begriffenen Geistes, vor der großen, meist urtheilslosen Menge herabzusetzen, und dadurch ihren schweren Beruf geflissentlich noch schwerer zu machen. Von Ihrer Einsicht wie von Ihrem Talent hatte ich Anderes erwartet und sehe mich ungern enttäuscht.“ (Der Entwurf zu dieser Kabinettsorder, von der Hand des Hausministers von Thiele, wird hier zum erstenmal mitgeteilt, vgl. das obige Faksimile.)
Berücksichtigt man bei diesem königlichen Denkzettel, daß der sonst so beredte Monarch auf frühere Einsendungen des Dichters, der ihm seine märkischen Romane „Der Roland von Berlin“ (1840) und „Der falsche Waldemar“ (1842) überreichen zu müssen geglaubt hatte, nur mit nichtssagenden Redensarten zu antworten wußte, so gewinnt dieser beleidigende, sogar nach Heinrich von Treitschkes Urteil „ungerechte“ Brief für den später im Wahnsinn endenden König eine symptomatische Bedeutung. Von der „wohlmeinenden Absicht“ dieses Königs war für die Presse nichts Ersprießliches mehr zu erwarten. Die seinem Stolze unentbehrliche Gönnermiene aber wurde bis zum letzten, bittern Augenblick beibehalten: als schon die Straßenkämpfe zwischen Volk und Militär begannen, am 17. März 1848, entwarf das preußische Ministerium endlich das Gesetz über die Preßfreiheit; der König hegte noch immer Bedenken und unterzeichnete es widerwillig erst am 18. Es wurde aber mit dem Datum des 17. veröffentlicht, damit es nicht so aussehe, als ob die Ereignisse des 18. dem Könige dieses Zugeständnis an die Forderung der verhaßten Zeitungsschreiber abgetrotzt hätten.
2. Eine kaiserin der zensur.
Die Kaiserin Maria Theresia (1717—1780) war bekanntlich eine heftige Feindin aller religiösen Aufklärung und verfolgte mit harter Unduldsamkeit alles, was Macht und Ansehen der katholischen Kirche und ihrer Diener verletzen konnte. Mit „Inquisition und Mission“ führte sie die Gegenreformation in den österreichischen Erblanden durch, und die Pflege der kulturellen Güter sah sie am liebsten ausschließlich in der Hand der Jesuiten.
Die wirksamste Waffe in der Hand des Protestantismus war das Buch; ihm galt deshalb der glühende Haß der geistlichen Machthaber. Seit 1623 war die Wiener Universität unter Verwaltung der Jesuiten; ihnen lag auch fast die gesamte Bücherzensur ob, ohne deren Genehmigung in Österreich nichts gedruckt und kein fremdes Buch verbreitet werden durfte. Gegen die katholische Kirche und ihre Vertreter durfte infolgedessen nichts, gegen die Ketzer alles geschrieben werden. Wegen Übersetzung einiger antikatholischen Streitschriften wurde der evangelische Prediger Mathias Bohil, erzählt ein Biograph des Kaisers Joseph II., eingekerkert, und er entging nur durch die Flucht schlimmerem Schicksal; man fand aber nichts darin, daß der Bischof Martin Bird in seinem „Enchiridion“ die Ausrottung der Ketzer predigte; erst der Papst selbst mußte eingreifen, um dieses Buch zu unterdrücken. Wissenschaftliche Werke hatten keinen Anspruch auf mildere Behandlung. Noch im Jahre 1750, versichert der Reformator des österreichischen Schrifttums, Joseph von Sonnenfels (der keineswegs für Preßfreiheit eintrat, sondern die Zensur noch als „eine der notwendigen Polizeianstalten“ bezeichnete), konnte es Stand und Glück kosten, wenn man sich anmerken ließ, in Montesquieus „Esprit des lois“ geblättert zu haben. Die Verfasser protestantischer und antikatholischer Schriften erwartete Verbannung und Kerker. Schon der Besitz lutherischer, ketzerischer, überhaupt unkatholischer Schriften war aufs strengste verpönt; sie standen außerhalb allen Eigentumsrechtes; jeder Geistliche durfte sie konfiszieren, wo er sie fand, jeder Privatmann war bei Strafe verpflichtet, anzugeben, wo immer er sie gesehen hatte. Wer ein neues Buch kaufte, mußte es innerhalb der Zeit von vier Wochen seinem Pfarrer zur Prüfung und Genehmigung vorlegen, sonst erhielt er drei Gulden Strafe, die sich im Wiederholungsfall empfindlich steigerte. Ein Drittel des Strafgeldes fiel dem Denunzianten zu; daher stand die niederträchtigste Spionage in voller Blüte. Haussuchungen waren an der Tagesordnung. Das Gepäck der Reisenden wurde auf den Mautämtern an der Landesgrenze und in den Städten durchsucht, alle irgendwie bedenklichen Bücher wurden ihnen weggenommen, die verbotenen verbrannt. Verkleidete Beamte der geistlichen Bücherpolizei, sogar die Präsidenten der Zensurkommission, wie Graf Saurau in Wien, besuchten als harmlose Kunden die Buchläden, schlichen sich in das Vertrauen der Händler und drangen in sie, ihnen verbotene Bücher zu verschaffen; ließen die Buchhändler sich überreden, so entdeckten sich die Spitzel als Polizisten, beschlagnahmten die Werke und denunzierten die Verkäufer.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der ewige Zensor»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der ewige Zensor» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der ewige Zensor» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.