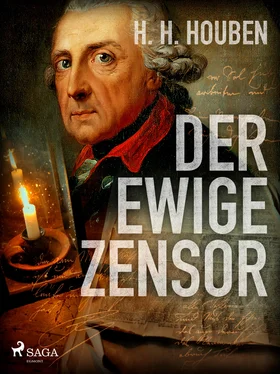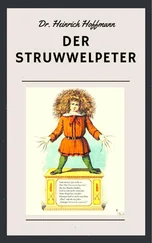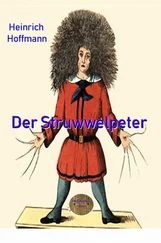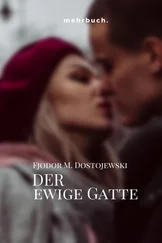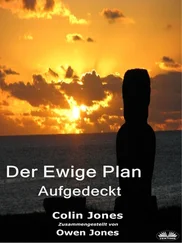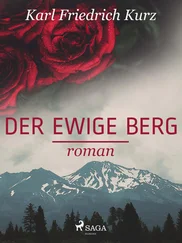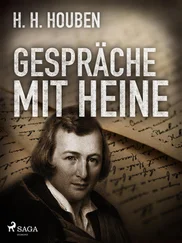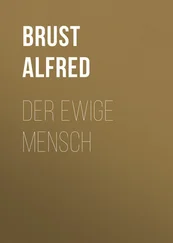Dieser verheißungsvolle Umschwung soll durch ein Literaturereignis illustriert werden, das zwei Jahre später die gesamte wissenschaftliche Welt in Aufruhr brachte. In seinem Mittelpunkt steht ein jüngerer Zeitgenosse Kants, Johann Gottlieb Fichte, dessen „Reden an die deutsche Nation“, gehalten 1807/08 unter den Augen und vor den gespitzten Ohren der französischen Machthaber in Berlin, eines der heiligen Bücher unseres Volkes geworden sind.
Seit 1793 lebte Fichte als Professor der Universität in Jena, wohin ihn Karl August von Sachsen-Weimar auf Anregung des berühmten Mediziners Hufeland und unter Goethes lebhaftem Beifall berufen hatte. Mit seinem Fachkollegen Niethammer gab er 1798 ein „Philosophisches Journal“ heraus, um das sich keine Behörde kümmerte; nur in Österreich wurden die einzelnen Hefte fast regelmäßig verboten, denn dort stand man mit jeder Philosophie auf gespanntem Fuße. Für dieses Blatt schrieb ein Rektor Forberg in Saalfeld, vordem Fichtes Schüler, eine Abhandlung: „Entwicklung des Begriffs der Religion“, worin kurzweg gesagt war, daß man in Ermangelung einer „logischen Notwendigkeit“ zwar nicht an eine göttliche Weltregierung glauben, aber doch so handeln müsse, als ob man nicht daran zweifle. Anmerkungen, die Fichte dazu machen wollte, verbat sich der Verfasser; daher stellte der Herausgeber dem Aufsatz eine eigene Abhandlung „über den Grund unseres Glaubens an eine moralische Weltregierung“ voran. Er ging dabei zwar von der Existenz einer Gottheit aus, die alles durchdringe und belebe, doch dürfe man ihr nicht mit den allzu menschlichen Vorstellungen der natürlichen Theologie nahen. Gegen diese im Januarheft 1798 erschienenen Abhandlungen wandte sich alsbald eine anonyme, von einem Gegner Fichtes, einem Jenenser Mediziner, verfaßte Flugschrift: „Schreiben eines Vaters an seinen studierenden Sohn über den Fichteschen und Forbergschen Atheismus“. Damit war das Stichwort gefallen, das dem nun einsetzenden Kampf, dem Fichteschen Atheismusstreit, verblieben ist.
An Gegnern fehlte es dem temperamentvollen Philosophen in seinem nächsten Wirkungskreise nicht; mit jener anonymen Broschüre wurde eine systematische Hetze gegen ihn veranstaltet. Exemplare wurden nach Leipzig zu unentgeltlicher Verteilung geschickt, ebenso nach Dresden an das dortige Oberkonsistorium. Am 29. Oktober 1798 richtete dieses an den Kurfürsten von Sachsen eine umfangreiche Vorstellung; es forderte nicht nur Konfiskation des „Philosophischen Journals“, sondern, „um dem Unheil der anstößigen Schriften wirksam zu steuern“, außerdem eine Beschwerde „bei den Fürstl. Sächsischen Höfen, auf deren Akademie zu Jena die gefährlichen Grundsätze ... am lautesten gelehrt und am eifrigsten verbreitet werden“, damit „diejenigen Lehrer jener hohen Schulen, welche sich dabei am geschäftigsten beweisen, darüber in Anspruch genommen und nach Befinden bestraft werden möchten“. Auch sei die Drohung angebracht, daß man im Notfall den sächsischen Untertanen den Besuch Jenas verbieten werde; außerdem solle man sich mit der preußischen Regierung in Verbindung setzen. — Daraufhin befahl Kurfürst Friedrich August III. am 8. November, das Journal zu konfiszieren, festzustellen, ob es etwa in Leipzig gedruckt und zensiert sei, und die einheimischen Universitäten nachdrücklichst zu ermahnen. Am selben Tag entwarf das Geheime Consilium entsprechende Schreiben an die Erhalter der Universität Jena, die Herzöge von Sachsen-Weimar, Sachsen-Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Coburg-Saalfeld, mit der Aufforderung, Verfasser und Herausgeber des Journals zur Verantwortung zu ziehen, um „dergleichen Unwesen“ Einhalt zu tun. In der ersten Hälfte des Dezembers gingen die vom Kurfürsten unterzeichneten Schriftstücke ab, das an Sachsen-Weimar erst am 18. Außer Preußen (wegen der Universitäten Halle und Frankfurt a. O.) wurden auch Braunschweig-Wolfenbüttel und Hannover (wegen der Universitäten Helmstedt und Göttingen) zu Maßregeln gegen „solche gemeinschädlichen Grundsätze“ aufgefordert.
Hannover antwortete schon am 14. Januar 1799, es habe das Journal sofort verboten und die „diensam scheinenden besonderen Ermahnungen“ nach Göttingen gerichtet. Braunschweig folgte mit einer ähnlichen Mitteilung am 11. Februar. Sachsen-Gotha wollte (25. Januar) den Rektor Forberg vor das Altenburger Konsistorium stellen, ebenso Sachsen-Coburg (26. Januar). Herzog Georg von Sachsen-Meiningen antwortete (26. Januar), er habe schon früher eine genauere Aufsicht auf diese Dinge beantragt, sei aber „nicht so glücklich gewesen, dieserhalb eine conforme Entschließung zu bewürcken“. — Aus Weimar ließ die Antwort auf sich warten. Das Geh. Consilium in Dresden wollte daher schon am 14. März den Besuch Jenas kurzweg verbieten, besonders da Fichte „sich nicht entblödet“ habe, wider die Unterdrückung seines Journals eine Appellation an die Öffentlichkeit erscheinen zu lassen.
Die „Appellation an das Publicum über die durch ein Churf. Sächs. Confiscationsrescript ihm beigemessenen atheistischen Äußerungen“ — eine Schrift, wie es auf dem Titel hieß, „die man erst zu lesen bittet, ehe man sie confiscirt“ — überreichte Fichte am 19. Januar 1799 dem Herzog von Weimar. Was man hier von dem ganzen Handel hielt, besagt am klarsten ein Brief Schillers vom 26. Januar an Fichte. Karl August dachte nicht daran, seinen Professoren im Schreiben irgendwelche Beschränkungen aufzuerlegen, nur wollte er „gewisse Dinge“ nicht auf dem Katheder gesagt wissen; das sei aber nur seine Privatmeinung, erklärte er; seine Räte würden nicht einmal diese Einschränkung machen. Doch ärgerte sich auch die Weimarische Regierung, daß Fichte vorschnell die Sache vor die Öffentlichkeit gebracht hatte. Über die Konfiskation seines Journals in Sachsen mochte er Lärm schlagen, soviel er wollte, da war man ganz der Ansicht Schillers, daß „eine aufgeklärte und gerechte Regierung keine theoretische Meinung, welche in einem gelehrten Werke für Gelehrte dargelegt wird, verbieten könne“. Aber die von Sachsen geforderte amtliche Maßregelung des Jenenser Professors hätte dieser in ruhigem Vertrauen seiner vorgesetzten Regierung überlassen sollen. Für diese diplomatisch feine Unterscheidung hatte aber Fichte keinen Sinn, der Vorstoß Sachsens hatte ihn aufs äußerste erbittert; er sah sich als Helden eines widerwärtigen öffentlichen Skandals, der in der ganzen Presse breitgetreten wurde; er verlor die Ruhe und witterte Gefahr für seine Stellung, als noch gar keine bestand. Er beanspruchte eine eklatante Genugtuung und glaubte, diese nur durch ein förmliches Gerichtsverfahren finden zu können, das natürlich mit seiner Freisprechung enden müsse. Zu diesem Zweck setzte er auf seine „Appellation“ eine noch viel temperamentvollere „Gerichtliche Verantwortungsschrift gegen die Anklage des Atheismus“ und überreichte auch diese am 18. März seinem Herzog.
Karl August war in diesem Streit entschieden der bessere Philosoph, indem er erklärte, philosophische Systeme könnten nicht Gegenstand richterlicher Entscheidung sein; er wollte die lästige Sache kurz abtun mit einem gelinden Verweis wegen „Unvorsichtigkeit“. Gerade damit aber glaubte Fichte sich nicht zufrieden geben zu dürfen; er drohte mit Demission. Damit hatte der aufbrausende Philosoph die ihm durchaus günstige Stimmung des Herzogs mit einem Schlage verscherzt; selbst Goethe, der ebenfalls über göttliche Dinge „besser ein tiefes Stillschweigen“ beobachtet wissen wollte, ließ jetzt den Freund fallen mit den Worten: „Ein Stern geht unter, ein anderer auf“; Fichtes stolze Sprache erschien ihm unerhört. So erging am 29. März 1799 an den Senat der Universität Jena der Befehl, den beiden Herausgebern des „Philosophischen Journals“ einen Verweis zu erteilen, außerdem aber die von Fichte angebotene Demission „sofort anzunehmen“. Am 5. April teilte man der kurfürstlich sächsischen Regierung das Ergebnis des Verfahrens mit, und in Dresden sah man (15. Mai) darin einen „herrlichen Sieg der Wahrheit und der Religion“.
Читать дальше