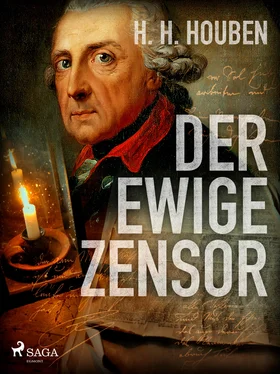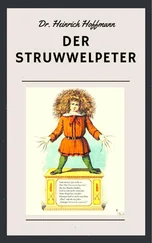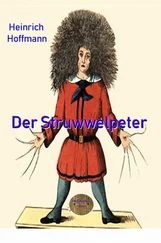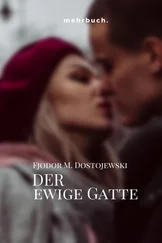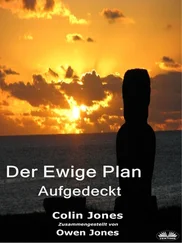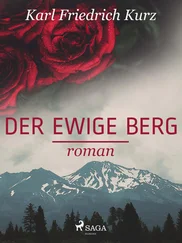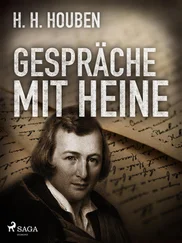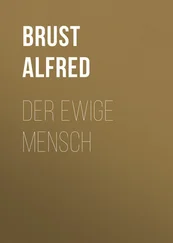Heinrich Hubert Houben - Der ewige Zensor
Здесь есть возможность читать онлайн «Heinrich Hubert Houben - Der ewige Zensor» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der ewige Zensor
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der ewige Zensor: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der ewige Zensor»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der ewige Zensor — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der ewige Zensor», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nur eines erregte beim sächsischen Hofe großes Befremden: die völlig überraschende Haltung, die Preußen gegenüber der sächsischen Aufforderung einnahm — Preußen, das unter dem Ministerium Wöllner im Kampf gegen die Aufklärung die schärfsten Saiten aufgezogen hatte. Aber Friedrich Wilhelm II. war Ende 1797 gestorben, Wöllner seit März 1798 entlassen, und der Thronfolger Friedrich Wilhelm III. dachte damals ganz anders über diese Probleme, so anders, daß das Geh. Consilium in Dresden völlig konsterniert war, als endlich unterm 16. April 1799 aus Berlin eine sieben eng beschriebene Folioseiten lange Antwort eintraf, die unverblümt erklärte, man finde die Konfiskation des Fichteschen Journals durchaus nicht ratsam! Drei gewichtige Gründe sprächen dagegen: 1. mache man die Schrift dadurch nur um so bekannter; sonst werde sie bald vergessen und „in die Dunkelheit, welche die Fichtesche Philosophie überhaupt umgibt, versunken seyn“; das Verbot mache den Verfasser nur zu einem Märtyrer der Wahrheit; Gottesleugner habe es überdies zu allen Zeiten gegeben; 2. verhindere man durch ein solches Verbot auch die öffentliche Bekämpfung der Schrift, und 3. stehe es in eigenartigem Kontrast zu der Gleichgültigkeit gegen „eine Menge anderer, offenbar sittenverderblicher und zu einer weit schädlicheren praktischen Gottlosigkeit geradezu führenden Schriften“. An diese möge man sich halten, statt an Bücher, die „bloß irrige Theorien, Gegenstände eines vorübergehenden Schulgezänkes und Wortstreites“ enthielten, die aber „übrigens auf Recht und Pflicht als die höchste Würde der menschlichen Natur mit großem und immer schätzbarem Ernste dringen“. Dieses Bestreben werde auch Preußen gern unterstützen; zu besonderen Anweisungen an die Universitäten habe bisher kein Professor Ursache gegeben. Daher könne der König — das war die Quintessenz des preußischen Erlasses — sich dem Verbot nicht anschließen, selbst wenn „alle deutschen Regierungen dem dortseitigen Beispiele“ folgten, er wünsche vielmehr, der Kurfürst möge es wieder aufheben!
Diese kategorische Stellungnahme Preußens ging unmittelbar auf den König zurück. Die Einladung Sachsens, seinem Beispiel zu folgen, war vom Departement des Äußeren an die zuständige Behörde gegeben worden, an das Departement der geistlichen Angelegenheiten, dessen Chef, der Geheime Staats- und Justizminister v. Massow, wiederum die Instanz zu Rate zog, die in der Zeit Wöllners völlig an die Wand gedrückt worden, jetzt aber in ihre Zensurrechte wieder eingesetzt war, das Oberkonsistorium. Dessen vier Mitglieder, die Oberkonsistorialräte Hecker, Zöllner, Sack und Teller, sprachen sich einmütig gegen das Verbot aus, wenn auch vorwiegend aus Zweckmäßigkeitsgründen, die im Punkt 1 der preußischen Antwort deutlich hervortreten. Die kleine Bosheit von dem Dunkel, das die Fichtesche Philosophie umgebe, stammt aus dem Votum des Geheimrats Sack, des ehemaligen Erziehers des Königs. Am nachdrücklichsten und überzeugendsten war der rationalistische Zöllner für die Ablehnung des sächsischen Vorschlags eingetreten; auf ihn geht auch der ideelle Gesichtspunkt zurück, der in Punkt 3 hervortritt: die Heiligkeit des Sittengesetzes, für die Fichte sich so begeistert einsetzte, so hatte Zöllner ausgeführt, müsse gerade als eine mächtige Stütze aller Religiosität betrachtet werden; deshalb hatte er geraten, abzuwarten und „durch Mitteilung der Bedenken die Aufhebung des Verbotes zu erstreben“. Mit den vier Gutachten des Oberkonsistoriums war das Departement des Auswärtigen aber schlecht zufrieden; um die Konfiskation wenigstens des inkriminierten Heftes glaubte es nicht herumzukommen. Das Oberkonsistorium aber blieb (4. März) bei seiner Meinung, damit nicht „die Grundsätze der Pressefreiheit, Zensur und Toleranz sehr bald in ihrer Festigkeit erschüttert und wir in die Notwendigkeit versetzt werden, selbige den Rücksichten auf hierüber abweichende Systeme anderer Höfe aufzuopfern“. Die Akten mit allen Gutachten gingen am 18. März an den König, und dieser trat am 25. März der Ansicht des Oberkonsistoriums ausdrücklich bei.
Diese Willensmeinung des jungen Königs, die dann vom Departement des Auswärtigen (Finkenstein, Alvensleben und Haugwitz) mit Benutzung der Gutachten des Oberkonsistoriums ausführlich begründet wurde, in ihrem vollständigen Wortlaut aber noch nicht gedruckt ist, sprach über alle Verbote philosophischer und theologischer Schriften, die aus dem Drang nach Wahrheit erwachsen, das denkbar schärfste Urteil aus und bewies mit überlegenem Scharfsinn, daß durch Gewaltmaßregeln, durch die Unterbindung der öffentlichen Aussprache für und gegen, die gesundheitsmäßige, das Schädliche auch wieder ausstoßende Entwicklung des Gedankenkörpers nur zum Schaden der Allgemeinheit aufgehalten und durch solche Stockungen weit mehr böses Blut erzeugt wird. Wenn auch Sachsen auf diese Aufforderung aus Berlin verlegen schwieg und das Verbot nicht zurücknahm, so bedeutete sie doch für Fichte eben die Rechtfertigung, auf die er Anspruch zu haben glaubte; sie ist ihm vielleicht auch nicht völlig unbekannt geblieben, denn als er Jena verließ und sogar in Rudolstadt nicht geduldet wurde, wandte er sich, seinen Plan einer Auswanderung nach Amerika aufgebend, nach Preußen; dort werde er, so hatte ihm der preußische Minister Dohm sagen lassen, „gedeckt vor den Bannstrahlen der Priester und den Steinigungen der Gläubigen“ leben können. Und als er im Juli 1799 in Berlin war und durch den ihm befreundeten Kabinettsminister v. Beyme fragen ließ, wie man über seine dauernde Niederlassung dort denke, kam die geradezu friderizianische Antwort: „Ist Fichte ein so ruhiger Bürger, als aus allem hervorgeht, und so entfernt von gefährlichen Verbindungen, so kann ihm der Aufenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet werden. Ist es wahr, daß er mit dem lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ist, so mag dies der liebe Gott mit ihm abmachen, mir tut das nichts.“ Daraufhin löste Fichte Ende des Jahres seinen Haushalt in Jena auf, zog nach Berlin und wurde Preuße. Der Kosmopolit, der er ursprünglich war, wandelte sich bald zum glühenden Verteidiger der Nationalität als der Grundlage aller Staatsbildung, und aus seinem ehemals erträumten Weltbürgertum riß ihn die Schlacht bei Jena vollends heraus. So wurde er zum Verfasser der „Reden an die deutsche Nation“. —
Fünfundzwanzig Jahre später aber wurde unter demselben König ein Neudruck dieser „Reden an die deutsche Nation“, die schon bei ihrem ersten Erscheinen 1808 dem damaligen Oberkonsistorium gewaltiges Kopfzerbrechen verursacht hatten, als nicht mehr zeitgemäß durch den Zensor Grano verboten und dieses Votum durch das Oberzensurkollegium vollkommen gebilligt! Die Zeiten waren eben einmal wieder andere geworden!
4. Schillers „räuber“ in berlin.
Daß bei einem der revolutionärsten Werke der Weltliteratur, bei Schillers „Räubern“, ein Zensor Pate gestanden haben sollte, ist schwerlich anzunehmen. Sie wurden zwar in Stuttgart selbst Anfang 1781 gedruckt, jedenfalls in der Offizin des Verlags Johann Benedikt Metzler, aber weder der Name des Verfassers, noch der eines Verlegers oder Druckers sind in der Originalausgabe genannt, und der falsche Verlagsort „Frankfurt und Leipzig“ bestätigt die Annahme, daß sich „Die Räuber“, obgleich sie erst auf dem Titelblatt der zweiten Ausgabe das bekannte Motto „In Tyrannos“ erhielten, als „Zensurflüchtlinge“, von denen im 5. Kapitel ausführlicher die Rede sein wird, in die Welt stahlen, ebenso wie Schillers berühmte „Anthologie auf das Jahr 1782“, die den Vermerk trug „Gedruckt in der Buchdruckerei zu Tobolsko“, ohne einen weiteren Namen; Verleger dieser Sammlung war tatsächlich derselbe Metzler, doch bekannte er sich erst 1798 dazu, als er die noch daliegenden Restvorräte von dem Jugendwerk des mittlerweile berühmt gewordenen Dichters abstoßen wollte. Einen Verleger hatte das dramatische Erstlingswerk des Regimentsmedikus Schiller überhaupt nicht gefunden, ebenso wenig wie Goethes „Götz von Berlichingen“ (1773). Beide Dichter zahlten die Druckkosten selbst, und Schiller mit seiner Gage von 18 Gulden monatlich mußte sich in drückende Schulden stürzen, um unter Bürgschaft eines Freundes von einem Geldgeber die nötigen 150 Gulden zu erhalten. Wenn schon kein Verleger für eines der beiden Werke das wirtschaftliche Risiko zu übernehmen wagte — vor einem so aufrührerischen Buch wie „Die Räuber“ schlug er gewiß drei Kreuze, und sich mit seinem Namen dazu zu bekennen, das wäre eine Herausforderung der Zensurbehörde gewesen, auf die er im Interesse seines Geschäftes zarte Rücksicht zu nehmen hatte. Dem Stuttgarter Verleger Metzler gab Schiller einen Teil der Exemplare, die in dicken Ballen in seinem Junggesellenquartier aufgestapelt waren, nur in Kommission, um sie nach Möglichkeit im Buchhandel zu verbreiten. Aber wer verlangte nach dem Werk eines Unbekannten? Metzler zuckte die Achseln, sein Geld steckte ja nicht darin, die Bücher lagen wie Blei, und um einen Teil der Druckkosten zu retten, mußte Schiller schließlich den ganzen Vorrat an einen Antiquar als Makulatur verkaufen. Von den 800 Exemplaren des Erstdrucks haben sich daher nur etwa 30 erhalten; sie gehören bekanntlich zu den größten Seltenheiten der deutschen Literatur. Der Bucherfolg der „Räuber“ setzte erst mit der Aufführung und der dadurch veranlaßten zweiten Ausgabe 1782 ein.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der ewige Zensor»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der ewige Zensor» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der ewige Zensor» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.