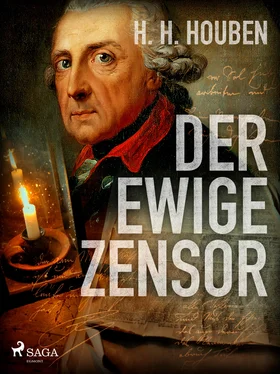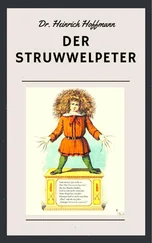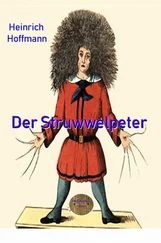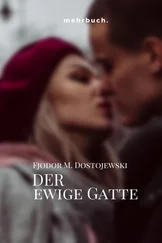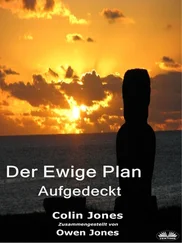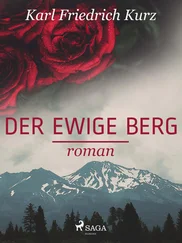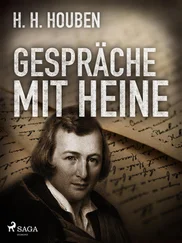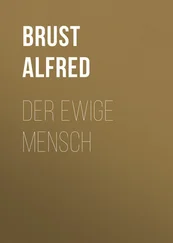Heinrich Hubert Houben - Der ewige Zensor
Здесь есть возможность читать онлайн «Heinrich Hubert Houben - Der ewige Zensor» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der ewige Zensor
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der ewige Zensor: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der ewige Zensor»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der ewige Zensor — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der ewige Zensor», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Dieser Wendung der Dinge entsprach vollkommen das neue preußische Zensuredikt vom 18. Oktober 1819, die landesgesetzliche Anwendung der „Karlsbader Beschlüsse“ des Deutschen Bundestags und seines Bundespreßgesetzes vom 20. September desselben Jahres. Es „genirte die Gazetten“ wie nie zuvor und war für die Zeitungsschreiber ein Maulkorbgesetz schlimmster Art. Zeitungen, die „Gegenstände der Religion, der Politik, Staatenverwaltung und der Geschichte gegenwärtiger Zeit in sich aufnahmen“, hingen von dem Stirnrunzeln dreier Ministerien ab, die die oberste Leitung der gesamten Zensurgeschäfte hatten: des Ministeriums des Äußern, des Kultus und des Innern und der Polizei. Diese drei Zensurministerien bestellten den für dieses Amt vertrauenswerten Zeitungszensor. Wenn ein Blatt von seiner Genehmigung „schädlichen Gebrauch“ machte, wurde es unterdrückt; flößte der für jede Nummer verantwortlich zeichnende Redakteur nicht das „nötige Zutrauen“ ein, so mußte der Verleger für ihn Geldkaution stellen oder einen andern nehmen. Damit der Redakteur auf alle Fälle der Polizei greifbar war, mußte er in Preußen wohnen und überdies „bekannt“ sein. Nicht nur der Verleger — womit sich die Bundesbeschlüsse begnügten —, auch der Drucker mußte auf jeder Zeitungsnummer genannt sein und war für die Beobachtung der Zensurvorschriften verantwortlich. Der Redakteur einer verbotenen Zeitung war fünf Jahre zur Stellungslosigkeit verurteilt, wenn er es nicht vorzog, den Staub seiner preußischen Heimat von den Füßen zu schütteln. Und da „frecher und unehrerbietiger Tadel und Verspottung der Landesgesetze und Anordnungen im Staate, Verletzung der Ehrerbietung gegen die Mitglieder des Deutschen Bundes und gegen auswärtige Regenten und frecher, die Erregung von Mißvergnügen abzweckender Tadel ihrer Regierungen“ mit Gefängnis- oder Festungsstrafe von sechs Monaten bis zwei Jahren geahndet wurde, so trug der Redakteur einer Zeitung tagtäglich seine Haut zu Markte, denn „frech, unehrerbietig und Mißvergnügen“ waren, um mit dem Geheimen Rat Sack zu reden, so schwankende und unbestimmte Begriffe, daß unter ihnen „alles und jedes Mißfällige subsumiert werden“ konnte und „durch das, was dann von öffentlicher Schreib- und Redefreiheit übrig blieb, die Wahrheit und das Recht nicht immer sonderlich gefördert“ worden sein dürfte. Die Verfolgungen von Männern wie Joseph Görres und Ernst Moritz Arndt, schikanöse Verfolgungen, die mit Zensurvergehen begannen und mit angeblichem Hochverrat endeten, haben dem deutschen Patriotismus Wunden geschlagen, die nie vernarbten, und der Kampf Deutschlands um die endliche Erlangung einer gesetzmäßigen Verfassung, der naturgemäß am unerbittlichsten in der Tagespresse ausgefochten wurde, hat dieser Tagespresse gerade die Bedeutung gesichert, die man ihr durch die Präventivzensur nehmen wollte. Wie kraß der Unterschied von einst und jetzt geworden war, zeigt am besten eine Kabinettsordre, die Friedrich Wilhelm III. im ersten liberalen Dezennium seiner Regierung, am 20. Februar 1804, erlassen hatte. Die Kriegs- und Domänenkammer in Hamm hatte sich durch einen Artikel beleidigt gefühlt, der die Baufälligkeit einer Ruhrbrücke und die Nachlässigkeit der Verwaltung betraf. Die Sache kam vor den König, und dieser erklärte: „Es kann nicht jedem zugemutet werden, in solchen Fällen, die eine Rüge verdienen, sich den Unannehmlichkeiten, womit offizielle Denunzialionen verbunden sind, auszusetzen. Sollte nun eine anständige Publizität darüber unterdrückt werden, so würde ja kein Mittel übrig bleiben, hinter die Pflichtwidrigkeiten der untern Behörden zu kommen, die dadurch eine sehr bedenkliche Eigenmacht erhalten würden. In dieser Rücksicht ist eine anständige Publizität der Regierung und den Untertanen die sicherste Bürgschaft gegen die Nachlässigkeit oder den bösen Willen der untergeordneten Beamten und verdient auf alle Weise gefördert und geschützt zu werden. Ich befehle Euch daher, die genannte Kammer hierdurch für die Zukunft gemessenst anzuweisen. Übrigens will ich nicht hoffen, daß über diesen Disput die Sache selbst, nämlich die Reparatur der schadhaften Brücke, wird vergessen werden.“ Nachdrücklicher und schlagender läßt sich das Recht der Presse, öffentliche Zustände auch in einer den regierenden Gewalten unwillkommenen Form zu erörtern, kaum formulieren. Zehn Jahre später hätte sich der König nur ungern an jene Kabinettsordre erinnern lassen, als ein zweiter „Brückenbau“ in Berlin selbst unliebsamstes Aufsehen machte. Unter diesem Titel hatte Professor Catel in der „Vossischen“ vom 20. September 1814 ein Spottgedicht veröffentlicht, das folgendermaßen begann:
„In China baute man unlängst an einer Brücke,
Es ging das Tagewerk mit jedem Tag — zurücke.
Bei Frühstück, Mittagsmahl und Vesperbrot verstrich
Die Zeit; zur Arbeit fand kaum eine Stunde sich.“ usw.
Darob stellte der Kabinettsrat Albrecht auf Befehl des Königs den Zensor Renfner zur Rede. Der wußte von nichts, da diese poetischen Stilübungen vom Polizeibureau zensiert wurden. Catel versicherte auf Ehre und Gewissen, daß er beileibe keinen bestimmten königlich preußischen Brückenbau damit gemeint habe, sondern nur die seit dem Frieden eingerissene Faulheit der Berliner Handwerker — schon damals also eine Nachkriegserscheinung! — habe geißeln wollen. Der König ließ ihm daraufhin zu seiner Beruhigung versichern, auch er habe „die Saumseligkeit mancher Handwerker nicht übersehen“ und sei über den Scherz keineswegs ungehalten. Etliche Monate später wäre die königliche Nachfrage gewiß von üblen Folgen für den durchaus harmlosen Professor gewesen; man hätte seine Verse ganz gewiß auf die nicht geringere „Saumseligkeit“ der Diplomaten des Wiener Kongresses gedeutet, der im September 1814 zusammentrat, um die deutsche Landkarte wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht ahnte man an höchster Stelle schon, wie treffend sie auf diesen verunglückten politischen „Brückenbau“ passen würden. Dieses lustige Gegenbeispiel aber zeigt, wie hoch bereits damals das Mißtrauen, die Unduldsamkeit gegen öffentliche Erörterung von Übelständen seitens der Tagespresse gestiegen war. Diese gereizte Stimmung wuchs mit jedem Tage, denn die Presse versuchte sich nun auch an öffentlichen Zuständen, die an Wichtigkeit einer baufälligen Ruhrbrücke oder der Saumseligkeit der Berliner Handwerker nicht nachstanden. Die überall einberufenen Provinzialstände schufen ein, wenn auch recht verschwommenes, Abbild konstitutioneller Verfassung. Der werdende deutsche Parlamentarismus ging jeden Staatsbürger an. Das Volk sollte wählen, seine Rechte kennenlernen, den Sinn der ihm gewährten oder von ihm erkämpften vorläufigen Verfassung begreifen; es sollte die Männer finden, die seine Rechte vertraten, und ihre Tätigkeit im Parlament verfolgen. Die Öffentlichkeit der Kammerverhandlungen war dazu unbedingt erforderlich; sie mußte in jahrelangen Kämpfen erst erstritten werden; in Süddeutschland gelang das zuerst. Der arbeitsame Staatsbürger konnte aber seine Tage nicht auf den Parlamentstribünen zubringen. Die Zeitung mußte ihm also berichten, was dort oben vorging. Die ministeriellen Blätter, wie die amtliche „Leipziger Zeitung“, verschwiegen gerade das, was man wissen wollte; sie wurden zum Kinderspott. Der Kampf um die Preßfreiheit war demnach eine Sache der gesamten Nation, wenn eine Verfassung jemals Leben gewinnen und das Verständnis für politische Rechte und Pflichten in das Volk übergehen sollte. Daran lag aber den meisten Regierungen sehr wenig; über diese öffentlichen Angelegenheiten wollte man eine öffentliche Meinung möglichst gar nicht aufkommen lassen. Die Verhandlungen des Deutschen Bundestags wurden in den ersten Jahren nach 1819 der Presse mitgeteilt in Form von Sitzungsprotokollen; am 5. Februar 1824 schon wurde dieses Zugeständnis an die Öffentlichkeit zurückgezogen und noch 1837 das Verbot in Erinnerung gebracht. Auch um die Verhandlungen der Landtage bekümmerte sich die Presse mehr, als den Regierungen und Souveränen gefiel. Am 5. Mai 1826 erließ Friedrich Wilhelm III. daher den Befehl: die Zeitungen hätten fortan über die Landtage zu schweigen, da solche Diskussionen „nur die öffentliche Meinung irreführten“. Was dem Publikum wissenswert sei, werde „in Gemäßheit der Gesetze künftig unter öffentlicher Autorität“ bekannt gemacht werden. Damit wurde der politische „Waschzettel“ Trumpf. Nur die „Resultate der Landtagsverhandlungen“ lernte die Öffentlichkeit kennen, in Form der „Schlußprotokolle“, wie sie vom Landtagsmarschall redigiert, vom königlichen Landtagskommissar genehmigt und schließlich noch vom Zensor zugelassen wurden, wobei es ganz im Belieben des letzteren stand, das zu unterdrücken, was ihm aus irgendeinem Grunde nicht opportun erschien. Die Namen der Redner durften überhaupt nicht genannt werden. So suchte man jede Brücke, um in dem obigen Bilde zu bleiben, zwischen Parlament und Öffentlichkeit abzubrechen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der ewige Zensor»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der ewige Zensor» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der ewige Zensor» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.