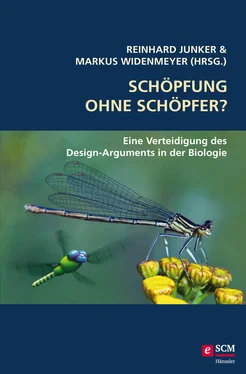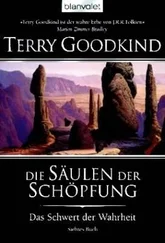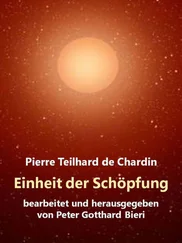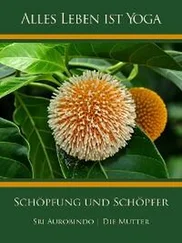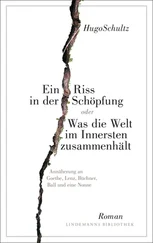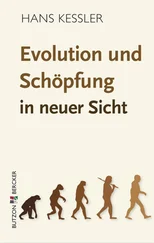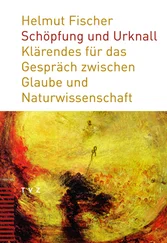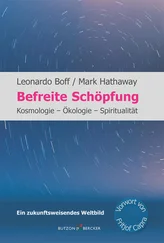• „‘Reciprocal causation’ captures the idea that developing organisms are not solely products, but are also causes, of evolution“ (S. 6). – Hier wird auf die Nischenkonstruktion und auf Einflüsse während der Ontogenese angespielt. Inwiefern und aufgrund welcher Vorgänge dadurch innovative Veränderungen eintreten sollen, wird nicht gesagt (s. o.).
• Weiter oben wurde dieses Zitat von LALAND et al. (2015, 8) bereits angeführt: „… the direction of evolution does not depend on selection alone, and need not start with mutation. The causal description of an evolutionary change may, for instance, begin with developmental plasticity or niche construction, with genetic change following. The resulting network of processes provides a considerably more complex account of evolutionary mechanisms than traditionally recognized.“ – Eine solche Plastizität ist weit entfernt vom Auftreten einer Neuheit. Sie ist ohnehin im Organismus bereits angelegt. Ohne nachträgliche genetische Fixierung („genetic change following“) sind diese Veränderungen zudem nur Ausdruck der Plastizität, der individuellen Anpassungsfähigkeit und eines schon vorhandenen Variationspotenzials der Organismen und tragen auch deshalb nichts zum Verständnis evolutionärer Innovationen bei.
• „Developmental bias and niche construction are, in turn, recognized as evolutionary processes that can initiate and impose direction on selection“ (S. 7). – Hier geht es nur um Selektion, die gewisse Richtungen erfahren soll, nicht aber um Innovation. 33
• „In fact, the conceptual change associated with the EES is largely a change in the perceived relationship between genes and development: a shift from a programmed to a constructive view of development“ (S. 9). – Hier verweisen LALAND et al. (2015) nochmals darauf, dass biologische Entwicklungsvorgänge nicht fix programmiert sind, sondern auf viel anspruchsvollere, flexible Entwicklungsprogramme zurückgreifen („constructive development“), die eine Anpassung der Entwicklungsprozesse des Individuums an jeweilige (sich ändernde) innere und äußere Rahmenbedingungen ermöglichen. Diese Fähigkeit als „konstruktiv“ im evolutionären Sinne zu bezeichnen, ist jedoch irreführend, da zum einen die Herkunft dieser Programme nicht thematisiert wird und zum anderen aus der Existenz dieser anpassbaren Programme nicht die Entstehung evolutionärer Neuheiten folgt.
• Instruktiv ist Tabelle 3 in LALAND et al. (2015), in der neue Vorhersagen der EES zusammengestellt sind; zum Beispiel: Neue phänotypische Varianten sind häufig gerichtet und funktional, sind oft umweltinduziert und betreffen viele Individuen gleichzeitig (Anspielung auf Plastizität), es können deutlich veränderte neue Phänotypen aufgrund von Mutationen in Regulationsgenen auftreten, es kann aufgrund von konvergenter Selektion oder Entwicklungszwängen wiederholte, konvergente Evolution vorkommen. 34Die Liste hat einen ähnlichen Inhalt wie die oben besprochene Aufzählung von MÜLLER (2017) und erfordert daher keine weitere Kommentierung. Es handelt sich laut LALAND et al. um kurzfristig zu erwartende Veränderungen („short-term“), was wiederum bedeutet, dass es um das Abrufen von anspruchsvollen anpassungsfähigen Programmen und nicht um Makroevolution geht: „For example, the EES predicts that stress-induced phenotypic variation can initiate adaptive divergence in morphology, physiology and behaviour because of the ability of developmental mechanisms to accommodate new environments“ (LALAND et al. 2015, 9).
Bewertung der EES in Bezug auf ihre Naturwissenschaftlichkeit
So wie MÜLLER (2017) und LALAND et al. (2015) die EES beschreiben, beruhen evolutionäre Veränderungen darauf, dass es ein bereits vorhandenes Potenzial an Ausprägungsmöglichkeiten von Merkmalen gibt. LALAND et al. (2015, 7) sprechen von präexistenten Entwicklungsprozessen, die vererbbare phänotypische Varianten aufgrund genetischer, epigenetischer oder umweltinduzierter Inputs erzeugen 35, und von der Fähigkeit der Entwicklungsprozesse, sich an neue Inputs anzupassen und funktionell integrierte Antworten auf eine große Bandbreite von Umweltbedingungen zu ermöglichen. 36Solche Entwicklungsprogramme und -prozesse erlauben durchaus Vorhersagen und können als naturwissenschaftlich beschreibbare Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich einer bei Organismen potenziell verfügbaren Anpassungsfähigkeit formuliert werden (wenn auch nicht als strenge „Gesetze“, was in der Biologie allgemein aufgrund der Komplexität der Forschungsgegenstände kaum möglich ist; vgl. die Ausführungen im Abschnitt „Erweiterung des Begriffs naturwissenschaftlich-nomologischer Erklärungen“). Doch es wurde nicht gezeigt, dass diese Prozesse zu evolutionären Innovationen führen. Man kann also sagen: Nur insoweit evolutionäre Veränderungen auf präexistenten Variationsprogrammen beruhen, können sie im weiteren Sinne naturwissenschaftlich beschrieben werden (dabei kann wenigstens indirekt Bezug auf Wenn-Dann-Aussagen genommen werden, und hier sind Tests möglich und wurden auch erfolgreich durchgeführt 37). Diese Programme erklären aber nicht die Entstehung von Neuheiten und evolutionäre Innovationen; ihre Entstehungsweise ist auch 160 Jahre nach DARWIN trotz intensiver Bemühungen naturwissenschaftlich nicht beschreibbar.
Nur insoweit evolutionäre Veränderungen auf präexistenten Variationsprogrammen beruhen, können sie im weiteren Sinne naturwissenschaftlich beschrieben werden.
Gerade die biologischen Aspekte, die im Rahmen einer EES argumentativ besonders wichtig sind, lassen sich gut im Rahmen eines Ansatzes verstehen, wonach es ein präexistentes Potenzial an Variationsmöglichkeiten (s. o.) und anpassbare Variationsprogramme gibt (CROMPTON 2019). Deren Herkunft liegt jedoch aus der Perspektive der Naturwissenschaft, die nach Gesetzmäßigkeiten sucht, im Dunkeln, und es gibt gute Gründe, sie als Indizien für das Handeln eines Schöpfers zu werten (nach welchen Kriterien dies erfolgen könnte, wird im Beitrag „Der Kern des Design-Arguments“ in diesem Band ausführlicher diskutiert).
Fazit: Gibt es eine naturwissen-schaftliche Evolutionstheorie?
In diesem Beitrag haben wir dargelegt, dass naturwissenschaftliche Erklärungen zwingend einen Bezug auf Gesetzmäßigkeiten nehmen müssen. Auch wenn in der Biologie aufgrund der Komplexität ihrer Gegenstände DN-Erklärungen manchmal nicht im strengen Sinne durchführbar sind, implizieren häufig angewandte Erklärungsweisen wie die Angabe eines Mechanismus oder kausale Beschreibungen u. a. Bezugnahmen auf Gesetzmäßigkeiten. Andernfalls könnten Ursachen für natürliche Phänomene gar nicht angegeben werden. Das muss auch für Erklärungen für Makroevolution gelten.
Seit DARWIN besteht der explizit formulierte Anspruch, die Entstehung der Arten durch einen natürlichen Mechanismus und ohne jede teleologische Komponente erklären zu wollen bzw. bereits zu können und Modellierungen des Artenwandels alleine auf (ggf. probabilistische) Gesetzmäßigkeiten und Randbedingungen zu gründen. Insofern es um den Ursprung von evolutionär Neuem geht, können jedoch weder der Darwinismus und die Moderne Synthese mit natürlicher Selektion als zentralem „Mechanismus“ noch die Erweiterte Evolutionäre Synthese (EES) diesen Anspruch einlösen. Das wird auch von manchen Evolutionsbiologen eingeräumt und damit begründet, dass Evolution ein kontingenter, historischer Prozess sei. Das heißt: Es gibt bis heute keine naturwissenschaftliche Evolutionstheorie, die die Entstehung von Innovation (Makroevolution) beschreibt. Auch die Selektionstheorie kann dies nicht leisten, u. a. aufgrund der expliziten oder impliziten Einbeziehung von teleologischen Aspekten.
Seit DARWIN besteht der Anspruch, die Entstehung der Arten durch einen natürlichen Mechanismus und ohne jede teleologische Komponente erklären zu wollen.
Читать дальше