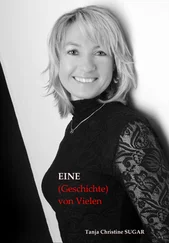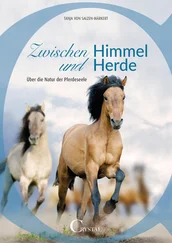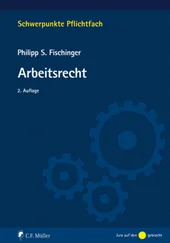Unsere Leiterin mahnt uns ständig ab. Müssen wir das wirklich ernst nehmen?
Bei verhaltensbedingten Kündigungen stehen Arbeitgeber häufig vor dem Problem, entweder zu früh zu kündigen (d. h. ohne vorausgegangene wirksame Abmahnung) oder ihr Abmahnungsrecht durch zu viele Abmahnungen zu verwirken. Denn wenn sich ausgesprochene Abmahnungen nur als leere Drohungen erweisen, weil der AG ständig nur mit einer Kündigung droht, ohne jemals arbeitsrechtliche Konsequenzen folgen zu lassen, wird die Warnfunktion einer Abmahnung erheblich beeinträchtigt. Das BAG hat hierzu jedoch festgestellt, dass angesichts der im Arbeitsleben weit verbreiteten Praxis, bei leichteren Vertragsverstößen einer Kündigung mehrere – häufig drei – Abmahnungen vorausgehen zu lassen, in der Regel die dritte Abmahnung jedenfalls keineswegs schon entwertet ist (BAG, Urt. vom 16. 9. 2004 – 2 AZR 406/03 –, NZA 2004 S. 8). Ob dies auch für weitere Abmahnungen gilt, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden.
Tipp:In vielen Rechtsratgebern im frühpädagogischen Bereich wird behauptet, eine Abmahnung sei nur binnen zweier Wochen nach dem Fehlverhalten der AN zulässig und zur Begründung § 626 Abs. 2 BGB angeführt. Hiervon sollten Sie sich nicht verwirren lassen: § 626 BGB gilt ausschließlich für außerordentliche (fristlose) Kündigungen, die ja gerade ohne Abmahnung wirksam sind. Zur Wirksamkeit einer Abmahnung sagt diese Norm nichts aus.
•Kündigung
•Personalakte, Einsicht in die
•Tarifvertrag
Fallbeispiel:
Lydia M., Leiterin der Einrichtung „Farbklecks“ ist aufgebracht: Obwohl ihr Träger ihr in den vergangenen zwei Jahren Weihnachtsgeld gezahlt hatte, ist eine Zahlung in diesem Jahr ausgeblieben. Auf ihre Nachfrage, wo denn ihr Geld bleibe, antwortet der Träger lapidar: Die Zahlung in den vergangenen Jahren war freiwillig und widerruflich, sie könne dies in ihrem Arbeitsvertrag nachlesen.
AGB (= Allgemeine Geschäftsbedingungen) sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (= Verwender) der anderen bei Abschluss eines Vertrages stellt, d. h. einseitig auferlegt (§ 305 Abs. 1 BGB). Verstößt eine solche Vertragsbedingung gegen das Gesetz, ist die einzelne Klausel unwirksam und entfällt, nicht aber der gesamte Vertrag (§ 306 Abs. 1 BGB), es sei denn, hierdurch entstünde eine unzumutbare Härte für eine der Parteien (§ 306 Abs. 3 BGB). Nach BAG, NZA 2005 S. 465 muss die durch Wegfall entstehende Lücke durch ergänzende Vertragsauslegung geschlossen werden.
Eine Inhaltskontrolle von AGB ist seit dem 1. 1. 2002 grundsätzlich auch für Arbeitsverträge zulässig und seit dem 1. 1. 2003 auch für solche Arbeitsverträge erlaubt, die vor dem 1. 1. 2002 geschlossen wurden. BAG (Urt. vom 27. 10. 2005 – 8 AZR 3/05 –) und BGH (NJW 1998 S. 2280) haben jedoch ausdrücklich festgestellt, dass die gerichtliche Inhaltskontrolle von AGB nicht zu einem Schutz des Verwenders führen soll! Soweit also eine nach den §§ 305ff. BGB unwirksame Klausel die AN begünstigt, kann sich der AG als Verwender nicht auf die Unwirksamkeit der Klausel berufen. Andererseits kann sich jedoch die AN gegenüber dem AG jederzeit auf die Unwirksamkeit der Klausel berufen.
Im Wesentlichen kennt das Arbeitsrecht drei Typen von AGB-Klauseln:
In Arbeitsverträgen finden sich häufig Klauseln, nach denen Leistungen einseitig durch den AG widerrufen werden dürfen. Häufig findet man auch Klauseln, die wie im Fallbeispiel Freiwilligkeitsvorbehalte mit einer Widerrufsmöglichkeit kombinieren. Da heißt es dann z. B.: „Die Leistung erfolgt auch bei wiederholter Gewährung freiwillig, begründet keinen Rechtsanspruch für die Zukunft und kann jederzeit widerrufen werden.“
Widerrufsklauseln dürfen für die AN jedoch nicht unzumutbar sein. Das BAG hat Kriterien aufgestellt, an denen Widerrufsvorbehalte zu messen sind (BAG, NZA 2005 S. 465). Demnach sind solche Vorbehalte zulässig, wenn die widerruflichen Leistungen weniger als 25%, maximal 30% des Gesamtverdienstes ausmachen und der Tariflohn nicht unterschritten wird. Lydia M. im Fallbeispiel wird diese Grenze wohl nicht erreicht haben, der Widerruf ist in ihrem Fall also zulässig.
Der Widerruf muss nicht an eine bestimmte Frist gebunden sein; eine Klausel ist also nicht deshalb schon unwirksam, weil sie keine Frist bestimmt und sie damit etwa zu unbestimmt wäre. Allerdings muss die Klausel Voraussetzung und Umfang des Widerrufsrechts bestimmen. Ansonsten verstößt sie gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB und ist für die AN unzumutbar (§ 308 Nr. 4 BGB). Voraussetzung und Umfang sind dann definiert, wenn die Leistung nach Art und Höhe klar bestimmt und der Grund des Widerrufs (z. B. wirtschaftliche Gründe) sowie der Grad der Störung konkretisiert ist (BAG, Urt. vom 12. 1. 2005 – 5 AZR 364/04 –).
Viele Arbeitsverträge enthalten Klauseln, nach denen Überstunden pauschal durch das Gehalt abgegolten sind. Eine solche Klausel ist deshalb problematisch, weil der AG durch Anweisung von  Überstunden den durchschnittlichen Stundenlohn absenken kann, weil er ja für mehr Arbeitsleistung dasselbe Gehalt zahlt. Eine solche sog. „unqualifizierte Abgeltungsklausel“ ist nach überwiegender Literaturauffassung unwirksam. Etwas anderes kann für qualifizierte Klauseln gelten, die festlegen, wie viel Mehrarbeit durch das Grundgehalt abgegolten werden soll. Mangels BAG-Rechtsprechung können hier jedoch noch keine gesicherten Aussagen gemacht werden.
Überstunden den durchschnittlichen Stundenlohn absenken kann, weil er ja für mehr Arbeitsleistung dasselbe Gehalt zahlt. Eine solche sog. „unqualifizierte Abgeltungsklausel“ ist nach überwiegender Literaturauffassung unwirksam. Etwas anderes kann für qualifizierte Klauseln gelten, die festlegen, wie viel Mehrarbeit durch das Grundgehalt abgegolten werden soll. Mangels BAG-Rechtsprechung können hier jedoch noch keine gesicherten Aussagen gemacht werden.
3.3 Doppelte Schriftformklausel
Doppelte Schriftformklauseln regeln, dass der Arbeitsvertrag und sämtliche Änderungen schriftlich geschlossen werden müssen; der Verzicht auf die Schriftform bedarf ebenfalls der Schriftform. Eine solche Klausel ist wegen des im Arbeitsrecht bestehenden Vorranges von Individualabreden problematisch: Wenn nämlich sich die Parteien einig sind, dass sie das Schriftformerfordernis durch mündliche Vereinbarung aufheben und den Vertrag mündlich ändern wollen, ist diese individuelle Abrede gem. § 305b BGB möglich (s. dazu auch  „Schlussbestimmungen“).
„Schlussbestimmungen“).
Das BAG hat jedoch eine doppelte Schriftformklausel für wirksam erachtet, wenn es um Ansprüche aus  betrieblicher Übung geht (BAG, NZA 2003 S. 1145). Bei der betrieblichen Übung soll es sich danach zwar um einen vertraglichen Anspruch handeln, jedoch nicht um einen individuellen, sondern um einen kollektiven. Daher ist § 305b BGB nicht anwendbar. Vielmehr sei die betriebliche Übung als eine mündliche Nebenabsprache wegen § 125 BGB nichtig, wenn sie nicht dem Formerfordernis der doppelten Schriftformklausel genüge. Mit Urt. vom 20. 5. 2008 – 9 AZR – hat das BAG seine Rechtsprechung diesbezüglich konkretisiert und anerkannt, dass sich die
betrieblicher Übung geht (BAG, NZA 2003 S. 1145). Bei der betrieblichen Übung soll es sich danach zwar um einen vertraglichen Anspruch handeln, jedoch nicht um einen individuellen, sondern um einen kollektiven. Daher ist § 305b BGB nicht anwendbar. Vielmehr sei die betriebliche Übung als eine mündliche Nebenabsprache wegen § 125 BGB nichtig, wenn sie nicht dem Formerfordernis der doppelten Schriftformklausel genüge. Mit Urt. vom 20. 5. 2008 – 9 AZR – hat das BAG seine Rechtsprechung diesbezüglich konkretisiert und anerkannt, dass sich die  betriebliche Übung stets gegen die doppelte Schriftformklausel durchsetzt, wenn letztere geeignet ist, nach Vertragsschluss getroffene Individualvereinbarungen zu unterlaufen, indem sie bei dem anderen Vertragsteil den Eindruck hervorrufen, die mündliche Abrede sei entgegen § 305b BGB unwirksam. Solche Klauseln sind geeignet, den Vertragspartner von der Wahrnehmung der ihm zustehenden Rechte abzuhalten (BAG, Urt. vom 20. 5. 2008 – 9 AZR 382/07 –). Das bedeutet im Klartext: Ein AG, der sich auf § 305b BGB beruft, um einer Individualabrede nicht Folge leisten zu müssen, muss sich immer an einer zwischenzeitlich erfolgten
betriebliche Übung stets gegen die doppelte Schriftformklausel durchsetzt, wenn letztere geeignet ist, nach Vertragsschluss getroffene Individualvereinbarungen zu unterlaufen, indem sie bei dem anderen Vertragsteil den Eindruck hervorrufen, die mündliche Abrede sei entgegen § 305b BGB unwirksam. Solche Klauseln sind geeignet, den Vertragspartner von der Wahrnehmung der ihm zustehenden Rechte abzuhalten (BAG, Urt. vom 20. 5. 2008 – 9 AZR 382/07 –). Das bedeutet im Klartext: Ein AG, der sich auf § 305b BGB beruft, um einer Individualabrede nicht Folge leisten zu müssen, muss sich immer an einer zwischenzeitlich erfolgten  betrieblichen Übung festhalten lassen.
betrieblichen Übung festhalten lassen.
Читать дальше
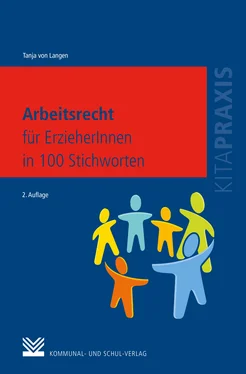
 Überstunden den durchschnittlichen Stundenlohn absenken kann, weil er ja für mehr Arbeitsleistung dasselbe Gehalt zahlt. Eine solche sog. „unqualifizierte Abgeltungsklausel“ ist nach überwiegender Literaturauffassung unwirksam. Etwas anderes kann für qualifizierte Klauseln gelten, die festlegen, wie viel Mehrarbeit durch das Grundgehalt abgegolten werden soll. Mangels BAG-Rechtsprechung können hier jedoch noch keine gesicherten Aussagen gemacht werden.
Überstunden den durchschnittlichen Stundenlohn absenken kann, weil er ja für mehr Arbeitsleistung dasselbe Gehalt zahlt. Eine solche sog. „unqualifizierte Abgeltungsklausel“ ist nach überwiegender Literaturauffassung unwirksam. Etwas anderes kann für qualifizierte Klauseln gelten, die festlegen, wie viel Mehrarbeit durch das Grundgehalt abgegolten werden soll. Mangels BAG-Rechtsprechung können hier jedoch noch keine gesicherten Aussagen gemacht werden.