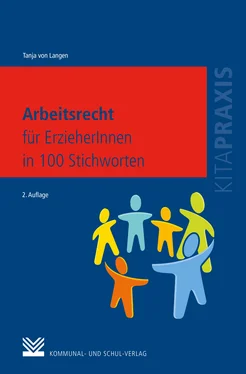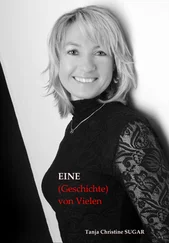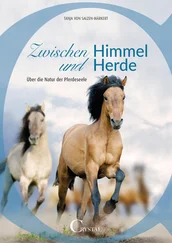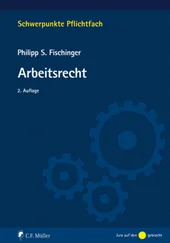9.Arbeitsgerichtsverfahren 9.Arbeitsgerichtsverfahren Fallbeispiel: Katja P., Erzieherin in der Kindertageseinrichtung „Luftballon“, erhält heute eine verhaltensbedingte Kündigung, weil sie nachweisbar 90 private Telefonate auf Kosten der Einrichtung während ihrer Arbeitszeit geführt hat. Katja P. ist entsetzt: Schließlich ist sie seit 12 Jahren in der Einrichtung beschäftigt und noch nie konnte man ihr etwas vorwerfen. Außerdem handelte es sich bei den Telefonaten um eine Ausnahmesituation, weil sie damit ihre Tochter, die extreme Schulschwierigkeiten hat, fernmündlich bei den Hausaufgaben betreut hat. Katja P. will sich diese Behandlung nicht gefallen lassen: Sie reicht Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht ein und gewinnt.
10.Arbeitsschutzgesetz 10.Arbeitsschutzgesetz Fallbeispiel: Linda J., Leiterin der Kita „Seepferdchen“, ist verunsichert. Heute hat sie Post vom Träger bekommen. Nach § 7 ArbSchG i. V. m. § 13 GUV-V A1 soll sie den Aufgabenbereich „Sicherheitsbeauftragte“ übernehmen. Ein entsprechendes Formular, das sie unterschreiben soll, ist beigefügt. Linda J. fragt sich, ob sie verpflichtet ist, dies zu unterschreiben.
11.Arbeitsstättenverordnung 11.Arbeitsstättenverordnung Fallbeispiel: Der Kindergarten „Villa Kunterbunt“ befindet sich in kommunaler Trägerschaft. Die dreigruppige Einrichtung hat insgesamt zehn Mitarbeiterinnen. Als der Stadtrat beschließt, das Angebot der Einrichtung um eine Kinderkrippe zu erweitern, ist wegen der damit einhergehenden Erhöhung des Personals die Planung eines Sozialraumes erforderlich.
12.Arbeitsunfähigkeit 12.Arbeitsunfähigkeit Fallbeispiel: Nina M. ist seit kurzem Kinderpflegerin im Kindergarten „Farbklecks“, der in kommunaler Trägerschaft steht. Nach langer Jobsuche und vielen Enttäuschungen hat sie nun die Stelle gefunden, die sie sich immer gewünscht hat: Man überträgt ihr viel Verantwortung und lässt sie eigenständig mit den Kindern arbeiten. Gruppenleiterin Gisa P. traut ihr viel zu und fordert sie, was ihr sehr entgegen kommt. Als Nina M. wegen einer Nierenbeckenentzündung krankgeschrieben ist, lernt sie die andere Seite der Medaille kennen: Gisa P. ruft sie zuhause an und erkundigt sich, ob sich Nina M. „ausnahmsweise“ in der Lage sehe, am morgigen Ausflug teilzunehmen, es stünden sonst nicht genügend Aufsichtspersonen zur Verfügung, und der Ausflug müsse ins Wasser fallen.
13.Arbeitsverhältnis im kirchlichen Dienst 13.Arbeitsverhältnis im kirchlichen Dienst Fallbeispiel: Conny L. ist seit Mitte der 1980-er Jahre Leiterin des Kindergartens „St. Elisabeth“, der in der Trägerschaft der katholischen Kirche steht. 1994 trennt sie sich von ihrem Mann und lebt von 1995 an mit einem neuen Partner in einer außerehelichen Beziehung zusammen. Als der kirchliche Arbeitgeber davon erfährt und ihm zudem mitgeteilt wird, dass Conny L. ein Kind erwartet, führt der Dekan der Pfarrgemeinde im Juli 1997 zunächst ein Gespräch mit Conny L. Wenige Tage später spricht die Pfarrgemeinde die Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit Wirkung ab April 1998 aus. Zur Begründung führt sie an, dass Conny L. gegen die Grundordnung der Katholischen Kirche für den kirchlichen Dienst im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse verstoßen habe. Indem sie außerhalb der von ihr geschlossenen und noch immer bestehenden Ehe mit einem anderen Mann zusammenlebe und nun ein Kind erwarte, habe sie sowohl Ehebruch begangen als auch sich der Bigamie schuldig gemacht. Hierauf legt Conny L. Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht ein. Arbeitsgericht und LAG geben Conny L. Recht. Das BAG verweist die Sache zur erneuten Entscheidung an das LAG, das zu prüfen habe, ob nicht zuvor eine Abmahnung hätte ausgesprochen werden müssen. Das LAG weist die Klage im Februar 2000 letztlich ab. Die hierauf gerichtete Revision zum BAG bleibt erfolglos. Das BVerfG entscheidet im Juli 2002, die Verfassungsbeschwerde von Conny L. nicht zur Entscheidung anzunehmen. Am 11. 1. 2003 legt Conny L. Beschwerde beim EGMR ein und gewinnt. (Fall nach EGMR, Urt. vom 23. 10. 2010, Beschwerde-Nr. 1620/03)
14.Arbeitsvertrag, Rechte und Pflichten 14.Arbeitsvertrag, Rechte und Pflichten Fallbeispiel: Ein Schwelbrand hat in der Nacht zum Sonntag dazu geführt, dass die Kita „Zwergenhaus“ ein Opfer der Flammen wurde. Die Feuerwehr kommt aufgrund der Anzeichen zum Verlauf der Brandentwicklung zu dem Ergebnis, dass ein fehlerhaftes Kabel im Raum der Mäusegruppe Ursache des Brandes gewesen sein muss. Gruppenleiterin Kerstin O. kann sich das nicht erklären. Im Strafprozess gegen sie wegen fahrlässiger Brandstiftung lässt sie sich zu ihrer Verteidigung ein wie folgt: Zwar stimme es, dass ihr Träger sämtlichen Erzieherinnen die Einhaltung der Unfallkassenvorschriften nahegelegt habe. Sie wisse auch, dass hierzu eine regelmäßige Kontrolle der verwendeten Stromkabel gehöre. Sie habe aber kein defektes Kabel bemerkt. Im Übrigen habe sie einen umfangreichen Arbeitsauftrag und müsse entscheiden, welchen Inhalten sie sich primär widme. Und wenn sie nicht dazu käme, bei jeder Benutzung des Beamers zu prüfen, ob seine Kabel auch noch alle intakt sind, läge das daran, dass sie stattdessen Kita-Plätze zu verteilen oder die Vertretung kranker Kolleginnen in der Krippe zu organisieren habe oder mit unzufriedenen Eltern diskutiert oder mit dem JA wegen eines verwahrlosten Kindes gesprochen habe. Daraufhin ergeht ein Beschluss des Strafgerichtes: „Zur Frage der Verursachung des Brandes durch Mangelhaftigkeit eines Stromkabels, der Offenkundigkeit eines eventuellen Mangels und damit einhergehender Vorhersehbarkeit des Schadenseintritts ist ein brandtechnisches Sachverständigengutachten einzuholen.“ Der Brandsachverständige kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Vermutung der Feuerwehr berechtigt war: Der Brand wurde von einem auf dem Laminatboden liegenden defekten Kabel verursacht. Der Defekt am Kabel musste nach dem Schadensbild offen zutage liegen (wird näher begründet), hätte also auch bei regelmäßiger Prüfung erkannt werden können. Durch rechtzeitige Auswechslung des Kabels hätte der Brand weiterhin mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermieden werden können.
15.Befristung mit und ohne Sachgrund 15.Befristung mit und ohne Sachgrund Fallbeispiel: Uta P., Leiterin der kommunalen Kindertagesstätte „Sonnenschein“ macht sich Gedanken über die Personalstruktur der nächsten Jahre. Einerseits ist da die Gruppenleiterin Anna S., die immer wieder davon spricht, sich beruflich verändern zu wollen, andererseits Kassandra L., die äußerst engagierte und bei Kindern und Eltern beliebte Berufspraktikantin, die bereits Bewerbungen schreibt. Wäre nicht viel an zeitraubendem Einstellungsaufwand gespart, wenn man diese beiden Umstände miteinander verknüpfen würde? Uta P. möchte Kassandra L. im Anschluss an ihre Ausbildung befristet für ein Jahr einstellen. Falls Anna S. die Einrichtung verlassen wird, wäre Ersatz für sie schon da. Aber reicht das als Befristungsgrund aus?
16.Berufshaftpflicht 16.Berufshaftpflicht Fallbeispiel: Die sechsjährigen Kinder Tim, Kevin und Noah haben von einem schlecht einsehbaren Teil des Kindergartengeländes aus Steine auf außerhalb geparkte Fahrzeuge geworfen und diese dadurch beschädigt. Die Steine hatten sie vorher – ebenfalls unbemerkt – von einem anderen Teil des Geländes zusammengetragen. Das erkennende Gericht geht von einer Aufsichtspflichtverletzung der Gruppenleiterin Marita M. aus und führt dazu aus: Kinder, die sich in einer Gruppe auf dem Außengelände eines Kindergartens aufhalten, dürfen nicht über einen längeren Zeitraum (hier 15 bis 20 Minuten) unbeaufsichtigt bleiben. Kinder müssen zwar nicht auf „Schritt und Tritt“ beaufsichtigt werden – es ist aber gerade bei Kindergruppen mit Gefahrenlagen zu rechnen, die bei einzelnen Kindern nicht zu erwarten sind. Deshalb ist bei Kindergruppen stets eine engmaschige Kontrolle im Abstand von wenigen Minuten geboten.
Читать дальше