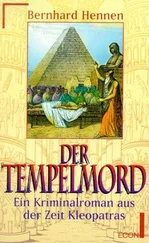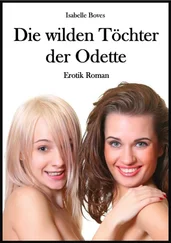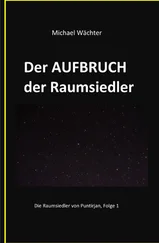»Vincent!« rief Dennis Tully. »Komm her. In den Salon.«
Als Vincent den Salon betrat, sagte er: »Ich wollte ohnehin hier hereinschauen, Vater. Ich habe schon auf der Straße das Licht gesehen. Was ist los, bist du krank?«
»Ich bin nicht sicher«, antwortete sein Vater. »Vielleicht. Vielleicht bin ich krank.«
Er saß, erzählte mir Vincent, in dem Sessel, der in der Familie als seiner galt, und auf dem nicht einmal fremde Besucher Platz nahmen, als ob ein Teil seines Wesens in die Kissen und die hohen Armlehnen übergegangen wäre. Eine Teekanne stand neben seinem Ellbogen auf dem kleinen Tisch aus dunklem Holz. Alle Gaslampen im Zimmer brannten, und der schwere grüne Samt der Vorhänge war vorgezogen, mit Ausnahme eines schmalen Fensterchens, hinter dem die vom Mond schwach erhellte Nacht lag. Es war der Sessel, in dem er sich sonst ausruhte, sein kahler Kopf mit seinem Kranz aus frühergrautem Haar ruhte, auf dem gestärkten Leinen eines sinnlosen Sesselschoners, und sein grobknochiges Gesicht war entspannt, die Wangen voll und rosa, und die Hände mit den hellbraunen Flekken ruhten auf seinen massiven Knien. Wenn er so in seinem Sessel saß, konnte er den Teil der Welt übersehen, der aus seiner Familie und seinen Gästen bestand – Mary und mir vielleicht einmal alle zwei Wochen, Schulmeister und Frau, und Considine, der katholische Arzt, und vielleicht Mr. Roberts, der Armenpfleger. Aber in dieser Nacht saß er vorgebeugt in seinem Sessel und wiegte sich sanft vor und zurück. Sein Kopf war gesenkt, und die Wülste unter seinem Kinn wurden aufeinander gepreßt. Vincent griff zur Teekanne.
»Großer Gott«, sagte er. »Kein Wunder. Der Tee ist eiskalt. Der muß ja wie Grabenwasser in deinem Magen liegen.«
»Mary Ellen hat mir die Kanne gebracht, ehe sie ins Bett gegangen ist. Ich hatte sie nicht darum gebeten, aber du kennst ja deine Mutter.«
Vincent zog seine Uhr aus der Tasche und hielt sie unter die Lampe. »Ein Glas Portwein«, sagte er. »Es ist ein königliches Heilmittel, und ich trinke eines mit dir.«
Als er an der Anrichte stand und die Gläser aus der Karaffe mit dem tintenschwarzen Portwein füllte, sprach er immer weiter über die späte Stunde und die seltsame Entdeckung, daß Dennis noch auf war, allein und stumm vor seinem kalten Tee. Aber beim Reden dachte er nach.
»Ich weiß, wie spät es ist«, sagte Tully. »Und dazu brauche ich deine hervorragende Uhr nicht.« Sie war wirklich hervorragend; Vincent hatte eine Vorliebe für Taschenflaschen, Uhren, Zigarrenetuis. »Ich war hier, im Salon. Wo warst du?«
»An keinem respektablen Ort«, antwortete Vincent. Er trug die Gläser vorsichtig, denn er hatte sie bis dicht unter den Rand gefüllt, aber trotzdem schwappte aus einem davon etwas über, als er es seinem Vater reichte, und auf seiner Hand war der Wein nicht mehr tinten-, sondern pflaumenfarben. »Und ich sollte dir wohl lieber die ganze Wahrheit sagen. Ich war mit ein paar anderen oben in den Bergen, bei Laffan, dem Whiskeybrenner. Und mein Kopf ist nicht mehr allzu klar, wenn du das unbedingt wissen willst. Man könnte genausogut Schießpulver und Petroleum trinken wie das Gebräu dieses Burschen.«
»Daß dein Magen das verträgt, Portwein auf Poitín g!«
»Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg«, sagte Vincent und setzte sich Tully gegenüber auf die andere Seite des Tisches.
»Wer war denn bei dir da oben? Das war ein dummes Unternehmen, mitten in schwarzer Nacht.«
»Bei Gott, das stimmt. Aber du hast zu deiner Zeit sicher genau solche Dummheiten begangen, vielleicht sogar noch schlimmere.«
»Habe ich nicht. In deinem Alter war ich Ehemann und Vater. Und ich hatte den Laden, um mich bei der Stange zu halten.«
»Und wenn schon«, sagte Vincent. »Es ist besser, wenn wilde Gelüste schon in der Jugend aus unserem Blut verschwinden. Nicht, daß es so ein wildes Gelüst gewesen wäre. Wir hatten in den Arms ein letztes Glas getrunken, und dann sagte einer, ›Bei Gott, die Nacht ist noch jung, und oben im Gebirge bei Laffan gibt es tonnenweise zu trinken.‹«
»Und wer ist dann mit dir losgezogen?«
»Die üblichen«, antwortete Vincent. »Bob Delaney und noch ein paar.«
»Merkwürdig, daß Bob so unklug war.«
»Ach, es war sogar Bobs Idee. Bob hat mehr Seiten, als du im Laden zu sehen bekommst.«
»Und Hughie MacMahon?«
»Der nicht. Mary geht es nicht gut, und deshalb hat er den Abend bei ihr verbracht. Und das war gut für seinen Ruf. Es hätte einem Schulmeister doch übel angestanden.«
Vincent erzählte mir, daß er in den ein oder zwei Minuten, in denen er sich seine Geschichte ausdenken mußte, mit einem anderen Teil seiner Gedanken wie ein Kronanwalt daran herummäkelte. War sein Vater zum Laden oder vielleicht zu meinem Haus gegangen? Aber nachdem das Kind in den Brunnen gefallen war, lag darin, einen kühlen Kopf zu behalten, die einzige Hoffnung. Und er war schon längst ein geübter Geschichtenerfinder, da sein Vater sich immer wieder nach Vincents Unternehmungen erkundigte, wobei ihn höchstens das Fehlen eines Gitters und die Macht, die Sünden zu vergeben, von einem Beichtvater unterschieden. Vielleicht glaubte er jedoch, über etwas dieser Macht Ähnelndes zu verfügen. Vincents rücksichtsloses Benehmen – und jetzt spreche ich nicht von Rebellionen, sondern von seinem Betragen bei Mädchen, bei Pferden oder an Spieltischen – war ein Thema, an dem der Vater sich immer wieder versuchte, ohne jedoch die ganze Wahrheit wissen zu wollen.
»Und dieser Vetter von Hughie, dieser Ned Nolan. War der auch dabei?«
»Doch, der ja«, sagte Vincent sofort, ehe er sich gestattete, am Portwein zu nippen. »Obwohl er nichts vertragen kann. Ein Glas oder zwei, vielleicht aus Höflichkeit ein drittes. Aber seine Gesellschaft hat uns Spaß gemacht. Ein sehr interessanter Mann.«
»Interessant«, sagte Tully.
»Und das ist er ja nicht ohne Grund«, fuhr Vincent fort. »Drei Jahre war er bei der Nordstaatenarmee und hat in den Tälern und Bergen von Tennessee und Virginia gekämpft. Und außerdem hat er in New York gewohnt. Ein weitgereister Mann.«
»Das stimmt. Und jetzt ist er über das Meer nach Kilpeder gereist. Nur die wenigsten machen die Reise in dieser Richtung.«
»Zurückgekehrt wäre vielleicht ein besserer Ausdruck. Er ist hier geboren, er ist aus Kilpeder.«
»Das weiß ich«, sagte Tully. »Tom Nolans Sohn. Ich habe Tom Nolan gekannt. Es war ein schöner Tag für Kilpeder, als Tom Nolan es verlassen hat.«
»Vielleicht«, erwiderte Vincent. »Ich habe gehört, daß der Name Thomas Justin Nolan in diesem Haus voller Respekt ausgesprochen worden ist, von Dr. Considine und sogar von Pater Cremin selber.«
Und das traf sicher zu, denn so geht es eben. Die Männer von 48, wie sie immer genannt wurden, waren in diesen Tagen heiß verehrt, als Patrioten und Gentlemen, die niemals zu brutaler Kriegführung herabsanken oder das gewalttätige und unwissende Blut der Gebirgler und Slumbewohner aufrührten. Ganz anders, natürlich, als die Fenier, die von den respektablen Bürgern als die neuen Sansculotten verdammt wurden. Und doch habe ich erlebt, daß die Fenier – und damit meine ich natürlich die »echten« Fenier, die Fenier von 67, die Männer von Clonbrony Wood, wie Vincent und mich selber, Gott helfe uns, als Bilderbuchhelden gepriesen werden, um die Land League-Leute und die Invincibles und die Dynamiters zu verdammen. Zeit und Mißlingen, vor allem Mißlingen, werfen einen Umhang aus sanften Farben und Geweben über die Vergangenheit.
»Dr. Considine hat Tom Nolan nie gekannt«, sagte Tully. »Und Cremin auch nicht. Beide sind Fremde in Kilpeder, auch wenn sie schon ein paar Jahre hier leben. Neulinge. Ich habe ihn gekannt«
Er hatte schon recht. Denn Thomas Justin Nolan hatte sich nicht darauf beschränkt, leidenschaftliche Artikel in The Nation zu verfassen. Er hatte sich alle Mühe gegeben, Kilpeder aufzuwiegeln, hatte die Vertriebenen und die halb Verhungerten von 48 angestachelt, zu Piken und Knüppeln und Stöcken zu greifen. Und als ihm das nicht gelungen war, war er mit einem halben Dutzend Unzufriedener nach Tipperary gezogen, um sich Smith O’Brien anzuschließen. Natürlich hatte der junge Dennis Tully ihn verabscheut, ebenso wie sein Vater, der alte Malachi, der Gründer, wie er später genannt wurde. Denn in jenen Tagen, in den entsetzlichen Tagen der Hungersnot und ihrer Folgen, wurde der Grundstein für das Haus Tully wirklich gelegt. Und als Dennis zu Beginn der Sechziger Jahre seinen großen neuen Laden am Marktplatz eröffnete, brachte er über dem Eingang eine Steintafel an, nicht mit dem Baujahr, sondern mit der Jahreszahl 1848. Malachi und Dennis Tully hätten mit Thomas Justin Nolan nur wenig anfangen können.
Читать дальше