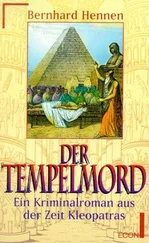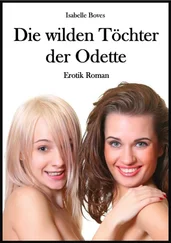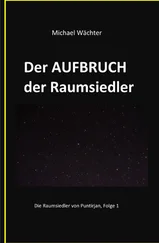Ich sah einen Jungen neben seinem Vater stehen, neben einem geliebten und verehrten Riesen, in einem vom Gaslicht hell erleuchteten Schankraum, mit Sägespänen auf dem Boden, vielleicht nach einer öffentlichen Versammlung, Echos der Redekunst, die er und seine Freunde vorgeführt hatten, sollten nun mit einem guten Schuß amerikanischen Whiskeys gefeiert werden. Sie standen im Halbkreis da, ein halbes Dutzend, und der junge Barmann mit den roten Haaren des County Leitrim ließ jede dritte Runde aufs Haus gehen, sein eigenes Glas war züchtig unter dem Tresen verborgen, die Kameradschaft war wärmer und behaglicher als die vom Zigarrenrauch trübe Luft. Neds Vater dominierte, Thomas Justin Nolan, einer der Helden von 48, ein YoungIreland-Mann, nicht wie seine Kameraden, die Hungeriren, durch Mißernten und Räumungen nach Amerika getrieben, sondern verbannt aufgrund seiner Überzeugung, ein Freund Dohenys und Meaghers, ursprünglich Schulmeister, sein Kopf vollgestopft mit Poesie, mit patriotischer Rhetorik. Bei der vierten oder vielleicht bei der fünften Runde kam seine Zunge jedoch ins Stolpern, seine Gesten wurden großartiger. Ein Sturzbach von Worten. Sie sprachen über die Heimat, die ganze unerbittliche Nacht von Manhattan hindurch, vielleicht stützte ein Freund seines Vaters ihn, und dieser Freund erzählte Ned dann von allem, was sein Vater für Irland erlitten hatte, feuchte Lippen und tränende Augen, Wunden und weißgewordene Narben, das alles waren die Orden vergangener Schlachten. Morgens aber saß der Vater still und gelassen vor seinem kalten Tee, seine Hand zitterte leicht, wenn er die Tasse berührte. »Eine lange dreckige Nacht, Ned. Gut, daß wir nicht oft ausgehen, wie mein eigener Vater zu sagen pflegte, dein Großvater.« Seine verblümte Entschuldigung, die Worte heruntergeleiert wie die Worte einer Litanei. Und der junge Ned wartete geduldig darauf, daß der geliebte Riese am späten Nachmittag wieder da war, voller Geist, lässiger Charme lag bei ihm in einer schlichten Schulterbewegung.
Nicht, daß Ned um die Flasche immer einen Bogen gemacht hätte, wie ich in den frühen Stunden des folgenden Morgens herausfinden sollte, aber sie war für ihn eine stumme und einsame Waffe gegen sich selber, und ich habe niemals gesehen, daß er sich wie ein Betrunkener benommen hätte, und das auch niemals von jemand anderem gehört. Es gibt Menschen, für die Schnaps nicht Trost, sondern Bestrafung ist, und ob wir sie für unglücklicher oder für glücklicher halten sollen als uns andere, kann ich nicht sagen.
Es war lange, nachdem wir in die Chapel Street zurückgekehrt waren und uns vor meiner Schlafzimmertür gute Nacht gewünscht hatten. Mary schlief natürlich schon, und ich zog mich leise in der Dunkelheit aus, legte mich neben sie und fühlte, wie mich die Wärme ihres Körpers willkommen hieß. Im Schlaf drehte sie sich halb zu mir um, und ich konnte ihr Gesicht im schwachen Licht desselben verschleierten, blassen Mondes erkennen, der uns in Knockmany beschienen hatte, dessen Strahlen nun aber auf stille, verletzliche und vertrauensvolle Schönheit fielen. Ihre offene Hand lag neben meiner, und ich nahm sie und blieb so liegen, während ich an die Decke starrte und in Gedanken die Ereignisse dieser Nacht durchging. Ein willkommener erster Halbschlaf überkam mich, und damit war ich zufrieden, ich kann nicht sagen, für wie lange, dann weckte mich das Geräusch eines Stuhles, der im Zimmer unter uns verrückt wurde, und als ich schon angefangen hatte, an meinen Ohren zu zweifeln, hörte ich es wieder.
Nun stand ich auf, und da ich keine Zeit damit vergeuden wollte, an den Kleiderhaken hinter der Tür nach meinem Schlafrock zu suchen, streifte ich meine Hose über und ging nach unten. Im Vorübergehen registrierte ich, daß Neds Tür offenstand, und ich fand ihn in der Küche. Auf dem Tisch, vor dem er saß, brannte eine Kerze, und er hatte neben sich eine Flasche stehen. Er war immer noch vollständig angezogen, und er mußte meine Schritte auf der Treppe gehört haben, denn er blickte zur Tür, als ob er mich erwartete, und er lächelte.
Unsere Begegnung sollte jedoch nicht die letzte späte Begegnung dieser Nacht bleiben, denn als Vincent nach Hause kam, das erzählte er mir am nächsten Tag, war sein Vater noch wach und wartete auf ihn. Als Vincent mir seine Geschichte berichtete, hatte ich immer noch meine Küchenszene im Kopf, mit ihrer einzigen Lichtquelle, deren Licht, weich und hart zugleich, wie tot auf Ned fiel, auf seine hohen Wangenknochen und seine tiefliegenden Augen, und auf sein Lächeln, das mich mit einem fremden Teil seines Wesens bekannt machte, zurückhaltend und bedrohlich. Ich erzählte Vincent nichts von unserem Gespräch, was ganz außergewöhnlich war, denn Vincent und Bob und ich standen einander so nahe wie Dumas’ Drei Musketiere, obwohl mir jetzt einfällt, daß Athos sein düsteres Geheimnis hatte, das er Porthos und Aramis fast bis zum Ende vorenthielt. Aber schließlich brannte Vincent ja auch darauf, seine eigene Erzählung loszuwerden.
Das Wort »Erzählung« benutze ich ganz bewußt. Es gibt Menschen, denen jeglicher Ehrgeiz fehlt, ihre Worte zu Papier zu bringen, die aber dennoch alle Gaben eines Erzählers haben, mit Ausnahme des Durchhaltevermögens. So ein Mensch war Vincent Tully. Als Erzähler war er ein Wunder, und das paßte gut zu seinen übrigen liebenswerten Seiten. Wenn Vincent in Form war, unterbrachen ihn nur die verstocktesten Spießer mit Fragen oder Kommentaren, niemand jedoch brachte konkurrierende oder ergänzende Anekdoten. Denn wenn irgend etwas fehlte, das zum vollen Verständnis notwendig war, dann konnten wir uns darauf verlassen, daß Vincent das so wollte und daß fehlende Informationen zum passenden Zeitpunkt ihren überraschenden Auftritt haben würden. Seine Geschichten waren elegant aufgebaut, und man konnte das Vergnügen spüren, das er bei ihrer Konstruktion empfand. Alles, was für Bühnenbild und Atmosphäre nötig war, wurde eingearbeitet: Charakteristiken, Tonfälle, Zögern, Gerissenheit oder Possenreißereien, das Aussehen eines Zimmers, Geräusche und Schweigen während einer Unterhaltung – das alles stand seinen Zuhörern vor Augen, wenn er lässig seine Sätze von sich gab. Und wenn alles zum Abschluß gebracht war, wurde die Erzählung durch eine unerwartete Bemerkung abgerundet, »So, Jungs, was sagt ihr nun dazu?«, und die Geschichte hing noch eine Weile in der Luft, unsichtbar, und in das Vergnügen seiner Zuhörer floß ein Wermutstropfen, wie immer, wenn wir die Künste erleben, die im Moment ihrer Ausführung für immer verschwinden, die Künste eines Gauklers, Tänzers, Jongleurs.
So war es auch am nächsten Abend mit Vincent Tullys Geschichte darüber, wie er mit dem alten Dennis Tully zusammengestoßen war, und dabei bemerkte ich, nicht zum erstenmal, die Gefahr, die dem begabten Geschichtenerzähler mit seinem Talent gegeben ist. Denn die Geschichte mag ihre Bedeutung haben, vielsagende Ausdrücke und Farben, und doch kann die Bedeutung dem Erzähler selber unzugänglich sein, anders als in den Fabeln von Aesop und La Fontaine, die am Ende pflichtschuldigst ihre Tadel und Ermahnungen beisteuern. Als Vincent mir seine Geschichte von Vater und Sohn erzählte, die einander wie riesige Kater umkreisten, ein Daumen in der Weste aus changierender violetter Seide mit weißem eingewirktem Zweigmuster eingehakt, schien er mich geradezu zu bitten, ihre Bedeutung zu entschlüsseln, und ich hätte das durchaus machen können. Aber ich war zu sehr erfüllt von einem Gesicht im Kerzenlicht, und Vincents Stimme entführte mich durch ihren Unterton von boshaftem Vergnügen.
Um halb zwei schloß Vincent die Haustür auf und betrat die Eingangshalle, die jetzt dunkel war, abgesehen von dem Streifen gelben Lichtes, der aus dem offenen Salon fiel, und die mir immer, wenn ich die Gelegenheit zu einem Besuch hatte, ein erster Botschafter vom Wohlstand der Tullys war, mit ihrem üppigen Teppich, hellrosa mit gelben Vierecken und Rauten, ihrem sorgfältig gearbeiteten Garderobenständer, kompliziert verschlungen wie das Geweih eines Hochlandhirsches, und dem langen Tisch mit seiner Platte aus rosa Marmor.
Читать дальше