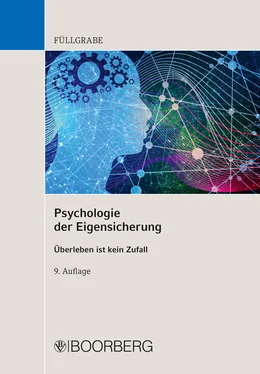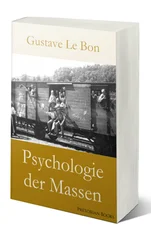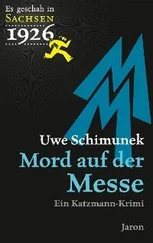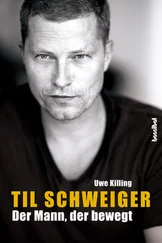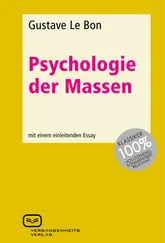Auf jeden Fall müsste der Polizeibeamte die Möglichkeit in Betracht ziehen, neben friedlichen Bürgern oder höchstens verärgerten „Verkehrssündern“ auch einer gewaltbereiten Person zu begegnen, einem „kalten Praktiker angewandter Gewalt“ (Toch, 1969) oder einem „Straßenkampf-Veteranen“ (Pinizzotto et al., 1997, 1998).
Gemäß ihren eigenen Aussagen betrug das Durchschnittsalter der Täter, bei dem sie ihre erste Tat begingen, 11 Jahre. Für mehr als zwei Drittel der Täter war dies Diebstahl. Sie berichteten, dass sie mehr Verstöße gegen das Waffengesetz begangen hatten, als jedes andere Verbrechen. 24 der 42 Täter berichteten, dass sie vor dem Angriff auf die Polizisten in Ereignisse mit Schusswaffengebrauch verwickelt worden waren, entweder weil sie selbst geschossen hatten oder weil auf sie geschossen worden war. 21 % berichteten, dass sie schon in der Vergangenheit versucht hatten, einen Polizisten anzugreifen. Pinizzotto et al. (1998, S. 18) schreiben anschaulich: „Einige der Straftäter können am besten als Straßenkampf-Veteranen beschrieben werden, angesichts der Häufigkeit der Beteiligung an Schusswechseln mit anderen Kriminellen und der Polizei.“
Bedrohlich wird eine Situation für einen Polizisten, wenn ein grundsätzlich Gewaltbereiter Alkohol oder Drogen benutzt. 62 % der von Pinizzotto et al. (1998) untersuchten Täter benutzten Drogen, Alkohol oder beides zum Zeitpunkt des Vorfalls. Am häufigsten war gleichzeitiger Genuss von Drogen, gewöhnlich Kokain und Alkohol. Ein Täter beschrieb die Wirkung der Drogen folgendermaßen: „Heroin lässt dich unbesiegbar fühlen; Kokain lässt dich defensiver und etwas paranoid fühlen. Drogen behindern nicht deine Fähigkeit, eine Schusswaffe zu benutzen. Sie lassen dich schneller schießen. Wenn du auf Droge bist, bist du leichter erregbar und übergeschnappt, und vielleicht benutzt du schneller eine Schusswaffe“ (Pinizzotto et al., 1998). Selbst wenn diese Äußerungen lediglich die persönliche Meinung des Täters wiedergeben und nicht unbedingt durch klinische Daten bestätigt werden, so ist doch aufschlussreich, wie hoch der Täter seine Aggressionsbereitschaft auf der Grundlage seines Drogenkonsums einschätzt.
Ein Täter, der bei einem bewaffneten Raubüberfall durch den Polizisten gestört worden war, gab an, dass er nicht beabsichtigt hatte, den Polizisten zu verletzen, sondern nur, eine Festnahme zu vermeiden. Er wusste, wenn er verhaftet worden wäre, hätte er sein Bedürfnis nach mehr Drogen nicht befriedigen können, was seinen Raubüberfall an erster Stelle motiviert hatte.
3.6 Mangelnde Wachsamkeit bei Interaktionen
Straftäter mit langer krimineller Karriere besitzen in manchen Bereichen eine gute Menschenkenntnis: Sie erkennen recht schnell die Schwächen anderer Menschen. Dazu folgendes Beispiel:
In einem Fall hatte ein 26-Jähriger zuvor 40 Einbrüche, 6 bewaffnete Raubüberfälle, 200 Autodiebstähle und 2000 Verstöße gegen Drogengesetze begangen. Vor der Ermordung des Polizisten hatte er niemals versucht, jemanden zu töten. Sein letztes Delikt vor dem Mord war ein bewaffneter Raubüberfall gewesen.
Als der Polizist ihn zu einer Anhörung vor Gericht fahren sollte, war er daran erinnert worden, dass der Täter ein bewaffneter Räuber sei, sehr gefährlich, und dass er selbst alle möglichen Zwangsmittel benutzen sollte.
Der Täter wusste, dass er zum Gefängnis transportiert werden sollte, und hatte geplant, zu fliehen, wenn es möglich war. Er hatte einen selbst gebastelten Schlüssel für die Handschellen in seinem Mund versteckt. Er hatte auch in den vergangenen zwei Wochen mit seinen Zellengenossen eine Entwaffnungstechnik eingeübt.
Beim Verlassen des Gefängnisses sagte der Polizist, dass er den Gefangenen, wenn er „brav bleibe“, mit den Handschellen vorne (nicht auf dem Rücken) fesseln würde und ihm erlauben würde, auf dem Vordersitz zu fahren, weil es für einen Menschen mit einer derartigen Körpergröße, wie sie der Täter hatte, unbequem sei, im hinteren Sicherheitskäfig zu fahren. Der Täter versicherte dem Polizisten, dass er gehorchen würde. Auf der Fahrt zum Gefängnis hatte der Täter keine Gelegenheit zur Flucht gehabt. Auf der Fahrt dahin war der Polizist im beständigen Gespräch mit ihm gewesen und hatte dem Täter seine persönlichen Probleme mitgeteilt. Vermutlich zeigte dieses Symptom der Vertrauensseligkeit auch den Grund dafür auf, dass der Polizist dem Gefangenen beim Verlassen des Gerichts wieder nur vorne Handschellen anlegte und auf dem vorderen Beifahrersitz fahren ließ. Kurz vor Beendigung der Fahrt sah der Polizist zwei Frauen in der Nähe eines fahruntüchtigen Autos. Als der Polizist sich nach links neigte, um die Autotür zu öffnen, kam seine Dienstwaffe in Reichweite des Gefangenen. Dieser nahm sie aus dem Holster, und bei dem folgenden Kampf erschoss er den Polizisten mit dessen eigener Waffe.
Der Täter zeigte später keinerlei Gefühle für das Opfer. Er sagte, dass der Polizist ihn hätte in die Sicherheitszone auf dem Rücksitz setzen sollen und dass er nicht hätte so gesprächig sein sollen. Seiner Meinung nach hatte es der Polizist versäumt, seinen Job richtig zu tun, und er hatte ihm eine Möglichkeit gegeben, zu entkommen (FBI, 1992).
Man sieht also: Was der Polizist als freundliches Verhalten ansah, betrachtete der Täter als Schwäche, die er ausnutzen konnte. Spieltheoretisch ausgedrückt: Eine extrem kooperationsbereite Strategie (Polizist) traf auf eine extrem unkooperative Strategie (Täter) und wurde besiegt.
3.7 Nichtsprachliche Signale der Verletzbarkeit
Manche Polizisten senden also körpersprachliche Signale der Verletzbarkeit aus, und viele Täter sind clever genug, diese Signale zu lesen (s. a. Pinizzotto & Davis, 1999).
In einem Fall erklärte ein 18-jähriger Mann, der ein Stipendium für ein College bekommen hatte, dass er von dem „guten Leben“ gelangweilt gewesen sei und dass er beschlossen hatte, ein „Stadtguerilla“ zu werden. Dazu kaufte er sich eine Pistole und eine schusssichere Weste. Nachdem er innerhalb von drei Tagen zwei Geschäfte ausgeraubt hatte, wurde er von einem Polizisten als verdächtig eingestuft. Aber der Polizist wartete nicht die von ihm angeforderte Verstärkung ab; als er sich (ohne schusssichere Weste) dem Täter näherte, wurde er erschossen. Er hatte noch nicht einmal seine Waffe gezogen und war nicht schussbereit, als er sich dem Täter näherte, von dem anzunehmen war, dass er bewaffnet war. Er machte auch den großen Fehler, die Hände des Täters nicht zu betrachten, was diesem erlaubte, die Pistole zu ziehen, während er von ihm abgewandt war. Der Täter sagte später, dass er das Verhalten des Polizisten abgeschätzt hatte, bevor er eine aggressive Handlung ergriffen hatte. Er stellte fest: „Der Polizist war nicht autoritär und übernahm keine Kontrolle über mich, er war ein williger Teilnehmer an seinem Tod.“ Damit drückte er aus: „Weil der Polizist nicht die Führung in der Situation übernommen hatte, konnte ich ihn angreifen.“
Der Polizist war sich nicht bewusst, dass er bestimmte Signale der Verletzbarkeit an den Täter übermittelt hatte. Aber der Täter sah, dass
• der Polizist alleine war und
• seine Pistole im Holster hatte
und deshalb bei einem plötzlichen Überfall verletzbar war.
Der Täter hatte also sowohl den Polizisten als auch die Situation abgeschätzt, bevor er handelte. Als er befragt wurde, was der Polizist hätte tun müssen, um seinen Tod zu vermeiden, sagte er: Er selbst hätte anders gehandelt, hätte der Polizist einen Partner gehabt oder hätte er seine Waffe gezogen gehabt(FBI, 1992).
Ein Täter sagte, dass er wusste, dass der Polizist nicht seine Waffe benutzen würde, obwohl der Polizist auf ihn zielte. Der Täter gab an, dass er dies aus der Art und Weise erkannte, wie der Polizist ihn anschaute und wie er seine Schusswaffe hielt (FBI, 1992). Wie viele andere Täter hatte dieser Mörder das Verhalten des Polizisten gemäß dessen Verletzbarkeit abgeschätzt. Und da dieser Unsicherheit zeigte, wurde er ein leichtes Opfer eines Gewaltbereiten.
Читать дальше