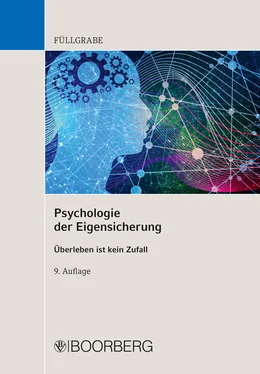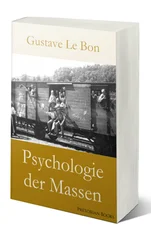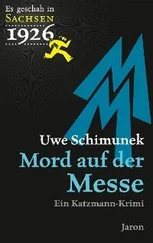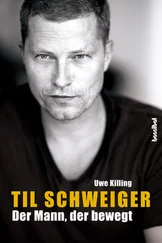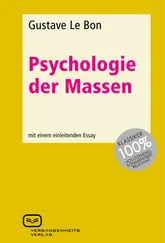Ein weiteres Problem besteht darin, dass psychisch Gestörte die Dinge oft anders sehen als andere Menschen, weil sie sich eher bedroht, verfolgt usw. sehen. Deshalb ist es wichtig, dass man ihnen durch sein Verhalten und seine Worte signalisiert, dass sie keine Angst zu haben brauchen, dass man ihnen helfen wird, ihr Problem zu lösen usw. (Füllgrabe, 1992).
Bei den Personengruppen der Betrunkenen und Rauschgiftsüchtigen betont Garner (1997): Sie scheinen weniger Schmerzen zu spüren. Und weil ihre Schmerztoleranz erhöht ist, scheinen sie (und vermutlich auch manche der psychisch Gestörten) übernatürliche Kräfte zu besitzen (s. a. S. 123). Deshalb ist beim Einschreiten gegen sie Vorsicht geboten, und man sollte sich die Hilfe von Kollegen sichern.
Psychisch Gestörte, Betrunkene und Rauschgiftsüchtige werden leicht unterschätzt, weil man sie irrtümlicherweise für hilflos und für Opfer ihrer Umstände hält (Sessar et al., 1980). In Wirklichkeit haben sie eine weitaus größere Steuerungsfähigkeit, als man glaubt (s. Füllgrabe, 2016), wie auch die Beispiele in diesem Buch belegen. Deshalb ist es richtig, dass Garner (1997) im Umgang mit ihnen ausdrücklich allgemeine Prinzipien der Eigensicherung betont: Man darf sie nie aus den Augen verlieren. Wenn man jemanden alleine in den nächsten Raum gehen lässt, „um seinen Mantel zu holen“, könnte er mit einer Waffe zurückkommen. Man darf ihm auch nicht erlauben, dahin zu greifen, wo man die Waffe nicht unter Kontrolle hat.
Kapitel 4 Polizeiliche Fehler bei der Eigensicherung
Ein Polizist kann dadurch einen Konflikt und Gewalt erzeugen, dass er nicht sachorientiert handelt, sondern seine Person und seine Macht in den Vordergrund stellt. Dies ist aber nur eine Ursache von Aggressivität, die gegen einen Polizisten gerichtet ist. Eine Studie von Polizisten, die im Dienst getötet wurden, zeigte nämlich: 39 % der Täter beschrieben das Verhalten des späteren Opfers als „bedrohlich“ oder „laut“. Dagegen beschrieben 57 % der Täter das Verhalten des Opfers während der Konfrontation als „unvorbereitet“ oder „überrascht“ (FBI, 1992).
Man kann also sagen, dass
a) die meisten Täter nicht vom Polizisten provoziert wurden und
b) die Angriffe zumeist vom Täter nicht geplant waren,
sondern sich im Verlauf der Interaktion entwickelten (s. a. Sessar et al. 1980 für Deutschland). Darauf war aber der Polizist zumeist nicht vorbereitet. In einer Situation, in der er problemlösend handeln sollte, blieb er passiv oder handelte irrational. Die Passivität hat dann oft schwerwiegende Konsequenzen, z. B. Tod durch die eigene Dienstwaffe!
Es ist deshalb wichtig, die Fehler, die Polizisten machten, zu analysieren, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, damit in Zukunft diese Fehler vermieden werden können.
Die Untersuchung von Sessar et al. (1980, S. 106–107) fasst die Fehler von deutschen Polizisten, die im Dienst getötet wurden, in folgenden sieben Gruppen zusammen. Da in den einzelnen Fällen mehr als ein Fehler begangen wurde, ist die Summe aller Fehler größer als 100 %.
Die amerikanische Studie über die Ursachen der Ermordung amerikanischer Polizisten im Dienst (FBI, 1992; Pinizzotto & Davis, 1995) zeigt folgendes Grundmuster auf, eine Kombination negativer Faktoren:
• Ein Polizist, der die Dinge zu leicht nimmt, vor der Benutzung von Gewalt (als legitime Selbstverteidigung) zurückschreckt.
• Eine unangemessene, unvorsichtige Annäherung an Personen und Fahrzeuge (unter Vernachlässigung der Eigensicherung).
• Ein gewaltbereiter Täter mit abweichendem, gestörten Verhalten.
Diese „tödliche Mischung“ führt leicht zum Tod des Beamten. Ein ähnliches Muster fanden Pinizzotto et al. (1997, 1998) bei Polizisten, die einen Angriff überlebten. Einige Polizisten werden also leichter als andere zu Opfern! Welche Fehler machten sie?
2.1 Die Vernachlässigung von Sicherheitsstandards
Gefährlich wurde es für Polizisten, wenn Sicherheitsstandards nicht beachtet wurden. Ein Polizist wurde getötet, als er einen von drei Verdächtigen anwies, sich hinter ihn zu stellen, während er das Auto der Verdächtigen durchsuchte. Als der Polizist in das Auto schaute, ohne auf einen Kollegen als Sicherung zu warten, nahm der Verdächtige ihm die Schusswaffe aus dem Holster und tötete ihn (FBI, 1992).
Diese Fehler bei der Annäherung an den Täter sind also zumeist die gleichen wie bei der BKA-Studie (Sessar et al., 1980). Die häufigsten Muster bei deutschen Polizisten, die im Dienst getötet wurden:
• Der Polizist wartet nicht auf einen weiteren Kollegen als Sicherung – obwohl man einen angefordert hat, sondern
• geht z. T. ohne gezogene Waffe auf eine Person zu,
• von der er oft weiß oder annehmen kann, dass sie bewaffnet ist.
• Man achtet bei Tätern in Häusern oder Autos nicht auf deren Handbewegungen. Der Griff unter den Sitz eines Autos oder unter die Decke eines Bettes ist zumeist der Griff nach einer dort versteckten Waffe!
Die FBI-Studie (1992) wies spezifisch auf folgende Probleme hin:
Falsche Annäherung an Autos und Verdächtige
Sich sachgemäß einem vermutlich bewaffneten Verdächtigen zu nähern, kann lebensrettend sein. Das ist die Konsequenz aus folgenden Vorfällen:
In einem Fall gab der Polizist über Funk bekannt, dass er einen Verdächtigen sehe, der einem bewaffneten Bankräuber ähnelte. Er bat um Verstärkung. Bevor aber ein zweiter Polizist kam, näherte er sich dem Verdächtigen, dem wahrscheinlich bewaffneten Bankräuber. Der Mörder sagte später, dass der Polizist nicht die Kontrolle über ihn übernommen hätte. Er ignorierte den Befehl des Polizisten, seine Hände zu heben, drehte sich schließlich um und erschoss den Polizisten. Das Opfer hatte seine Waffe noch nicht einmal aus dem Holster genommen!
In einem zweiten Fall sollte der Polizist mehrere vermutete Einbrecher ermitteln. Er beobachtete zwei Verdächtige, die zwei Gewehre hatten und weggingen. Er näherte sich ihnen und verlangte ihre Waffen. Als sie sich weigerten, ihre Waffen niederzulegen, drehte der Polizist ihnen den Rücken zu, ging zu seinem Streifenwagen zurück und rief um Verstärkung. Nachdem er zu den Verdächtigen zurückkehrte, wurde er erschossen. Seine Waffe war noch immer in seinem Holster!
Annäherung an mehrere Verdächtige
Zum Zeitpunkt der Ermordung des Polizisten waren 14 der Mörder in der Begleitung von einer Person oder mehreren Personen. 11 dieser Mörder waren nicht die Zielperson des Polizisten, also diejenige, die für ihn auffällig war bzw. die er verdächtigte.
Es scheint, dass in vielen dieser Fälle der Polizist einen „Tunnelblick“ hat, d. h. dass er bei seiner Annäherung seine Aufmerksamkeit auf eine Person konzentriert und die anderen Personen in der Gruppe vernachlässigt oder ignoriert. Und gerade das bringt ihn leicht in Gefahr.
Ein Polizist hielt ein Auto an, in dem sich 3 Personen befanden. Er wollte den Fahrer wegen einer Verkehrsübertretung ansprechen, schenkte den anderen beiden Mitfahrern keinerlei Beachtung. Einer der Mitfahrer verließ das Auto, näherte sich dem Streifenwagen, in dem der Polizist saß, schoss auf ihn und tötete ihn.
In einem anderen Fall rief ein Ladenbesitzer die Polizei wegen Belästigung durch einen Mann. Dieser Mann wurde verhaftet. Seine Freundin ging zum Auto, nahm einen Revolver, ging zu dem Polizisten und verlangte die Freilassung ihres Freundes. Als dieser sich weigerte, den Verhafteten freizulassen, und versuchte, seinen eigenen Revolver zu ziehen, schoss die Frau auf ihn und tötete ihn.
Читать дальше