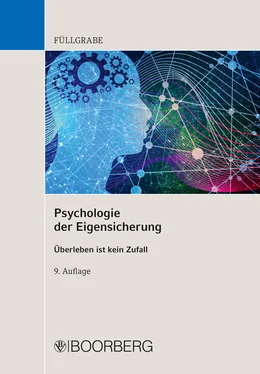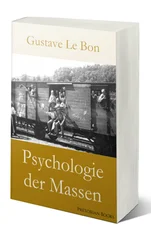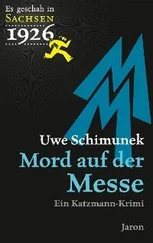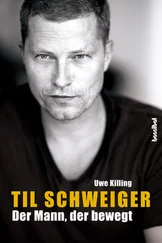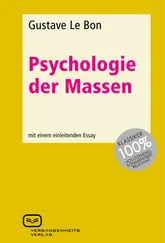Der Polizist sah die Dinge offenbar so: Die Frau hatte in dieser Situation keine gesetzesverletzende Handlung begangen und stellte für den Polizisten keine wahrnehmbare Gefahr dar. Deshalb ignorierte er sie völlig. Er berücksichtigte nicht, dass auch sie gefährlich werden könnte (FBI, 1992).
2.2 Das Versäumnis, einen Verdächtigen zu untersuchen
Das Versäumnis, einen Verdächtigen zu untersuchen, kann für einen Polizisten verhängnisvoll sein. Darauf hatten Sessar et al. bereits 1980 in der deutschen BKA-Studie hingewiesen. Wie wichtig aber eine Durchsuchung ist und wie notwendig, dabei die Tricks von Gewalttätern zu kennen, belegen Pinizzotto et al. (1997, 1998):
Bei 8 von 40 Vorfällen benutzten die Täter mehr als eine Waffe, einschließlich Messer und stumpfe Gegenstände, sowie Hände, Fäuste und Füße, vor allem aber wurden Schusswaffen bei den Angriffen gegen Polizeibeamte eingesetzt. 50 der 52 Polizisten wurden mit Feuerwaffen angegriffen, und die Verfügbarkeit der Waffen war der entscheidende Faktor bei der Benutzung der Waffe. Als sie über ihre bevorzugte Methode befragt wurden, mit der sie eine Handfeuerwaffe bei sich tragen, sagten 36 % der Täter, dass sie die Waffe in der Leistengegend tragen. Die Hälfte dieser Täter glaubte, dass diese Gegend am häufigsten von Polizisten übersehen wurde, die eine Durchsuchung durchführten. Ein ähnliches Ergebnis ergab die Befragung von Tätern, die Polizisten getötet hatten. In dieser Untersuchung (FBI, 1992) wurde auch die Methode eines Täters festgestellt, Polizisten daran zu hindern, in einer derartigen Körpergegend zu suchen. Sobald sich die Hand des Polizisten bei der Durchsuchung dieser Körpergegend näherte, wo der Täter Waffen und Rauschgift versteckt hatte, machte er Scherze über Homosexualität und stellte Behauptungen über die sexuelle Orientierung des Polizisten auf.
50 % der Täter trugen beim Autofahren ihre Waffe direkt bei sich, anstatt sie irgendwo im Auto zu verstecken. 12 % der Täter hatten in der Vergangenheit ihre Waffe einer anderen Person gegeben, um sie für sie zu tragen. Über ein Viertel der Täter berichteten, dass sie – zumindest zeitweise – eine zweite Waffe tragen, gewöhnlich eine Handfeuerwaffe, mit der ausdrücklichen Absicht, sie gegen einen Polizisten zu verwenden oder jeden anderen, der ihre erste Waffe wegnehmen würde.
Es ist eindeutig von großer Wichtigkeit, dass die Vertrautheit des Täters mit Handfeuerwaffen, Geschicklichkeit bei der Benutzung und den Methoden des Tragens und Verbergens der Waffen beachtet werden muss, wenn Vorgehensweisen hinsichtlich der Annäherung und Durchsuchung von Verdächtigen entwickelt werden (s. Pinizzotto et al., 1997, S. 27).
Diese Studie zeigt auch schwere Versäumnisse beim Durchsuchen von Verdächtigen auf. Nur drei der 42 Täter gaben an, dass Polizeibeamte immer sorgfältig seien: Nur 14 % gaben an, dass sie immer von Polizisten durchsucht würden.
Hinzu kommt ein Ablenkungsfaktor:
Ein Täter berichtete, dass die Polizisten, die ihn verhafteten, so überglücklich waren, Drogen in seiner Jackentasche zu finden, dass sie einen versteckten Revolver übersahen, der in seiner Leistengegend verborgen war. Ihm wurden Handschellen angelegt, Hände nach vorne, die Handinnenflächen zusammen. Während des Fahrens entfernte er seine Waffe und schob sie unter den Fahrersitz. Er gab an, die Polizisten zu dem größten Drogenhändler der Stadt zu bringen. Nachdem er auf der Wache registriert und durchsucht worden war, wurden ihm erneut Handschellen angelegt, nach vorne, mit den Handinnenflächen zusammen. Während der Fahrt zu dem angeblichen Haus des Drogendealers ergriff er die Waffe und schoss auf die Polizisten, einer wurde getötet, der andere schwer verwundet, konnte aber nach einiger Zeit wieder seinen Dienst aufnehmen.
Ein weiteres Gebiet, das bei Durchsuchungen oft übersehen wird, ist der Raum unter dem Fahrersitz.20 % der Polizistenmörder berichteten, dass sie ihre Waffen unter dem Sitz versteckt hätten (FBI, 1992).
Pinizzotto et al. (1997, S. 42) ziehen daraus folgende Konsequenzen:
• Nach jedem Transport sollte der Streifenwagen durchsucht werden.
• Das Finden einer Waffe (oder eines verbotenen Gegenstandes) schließt nicht das Vorhandensein einer zweiten aus.
• Die Fesselung nach vorne beeinträchtigt wenig die Bewegungsfreiheit von Händen und Armen und liefert dem Täter eine weitere Waffe: die Handschellen.
2.3 Die Benutzung der Dienstwaffe
Pinizzotto und Davis (1995) stellten fest: Es herrschte Unsicherheit und innere Anspannung bei den Mitgliedern der gleichen Dienststelle, wenn es um die Frage ging, ob sie in einer Situation ihre Dienstwaffe zum Selbstschutz ziehen und feuern konnten und ob sie dann immer noch in Übereinstimmung mit den Dienstvorschriften wären.
Manche Polizisten berichteten, dass sie so ängstlich hinsichtlich Anklagen und Disziplinarmaßnahmen seien, dass sie zögern, ihre Dienstwaffe zu ziehen. Unsicherheit und Nervosität bestehen auch über den Zeitpunkt, wann die Dienstwaffe gezogen werden sollte und, wenn notwendig, zu welchem Zeitpunkt sie benutzt (abgefeuert) werden sollte.
Viele Polizisten sagten, dass es ihnen sogar verboten wurde, ihre Dienstwaffe zu ziehen, bis der Täter als Erster seine Waffe gezeigt hat. Es ist sehr schwierig, sich eine Situation vorzustellen, wo man auf einen Notruf reagiert, bei dem es um einen Raub geht, bei dem Schüsse fallen, während man nicht die Erlaubnis hat, eine Waffe zu ziehen, bis der Täter selbst eine zeigt.
Eine Gruppe von Militärpolizisten sagte, dass nach ihrem Verständnis es nicht erlaubt sei, Patronen in ihre Dienstwaffe zu stecken, bis ein Vorgesetzter den Befehl dazu gegeben hat.
Die Konsequenzen aus derartigen Unsicherheiten zeigt folgende Erkenntnis: Von den 54 getöteten Polizisten feuerten 46 ihre Dienstwaffe nicht ab, und 11 Polizisten wurden mit ihrer eigenen Dienstwaffe getötet (FBI, 1992).
Dies hängt damit zusammen, dass in einer Gefahrensituation keine problemlösenden Gedanken (innere Monologe) vorhanden waren, die eine Handlung auslösen konnten, sondern Vermeidungsdenken, das Passivität förderte. Dies belegt die Studie von Pinizzotto et al. (1997, 1998):
Während der Angriffe erinnerten sich die Polizisten dieser Untersuchung daran, was sie nicht tun sollten und wann sie nicht Gewalt anwenden sollten. Aber einige hatten Schwierigkeiten, sich daran zu erinnern, wann die Benutzung von Gewalt eine angemessene, zeitgerechte, notwendige und positive Entscheidung war. Einige hatten Probleme, sich an die dienstlichen Vorschriften hinsichtlich tödlicher Gewalt zu erinnern und zu bestimmen, wann man zum nächsten Niveau von Gewalt gehen sollte. Derartige Gedanken verhindern aktives Handeln und begünstigen Passivität.
Diese Passivität hat schwerwiegende Konsequenzen: Tod durch die eigene Dienstwaffe.
Von den 762 zwischen 1981 und 1990 in den USA getöteten Polizisten waren 110 (= 14 %) mit ihrer eigenen Dienstwaffe getötet worden. In der FBI-Studie von 1992 waren es 11 der getöteten Polizisten (= 20 %).
In einem Fall hatte der Mörder die Waffe dem Polizisten mit einer einfachen, mehrfach eingeübten Handbewegung aus der Hand genommen. Dieser Mörder hatte eine Reihe von Straftaten begangen und war stolz auf die Tatsache, dass er bei seinen Delikten keine Waffe benutzt hatte. In diesem Falle hatte ihm der Polizist selbst die Waffe geliefert. Er behauptete, dass er wusste, dass der Polizist seine Waffe nicht benutzt hätte, obwohl der Polizist die Waffe auf ihn gerichtet hatte. Er wusste das aus der Art und Weise, wie der Polizist ihn anschaute und wie er die Waffe hielt.
Читать дальше