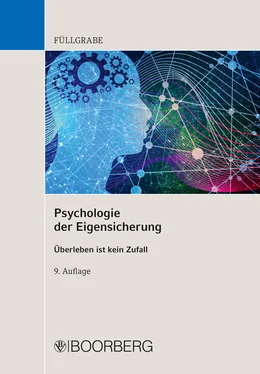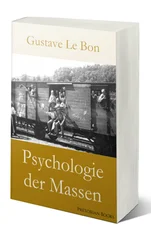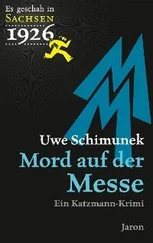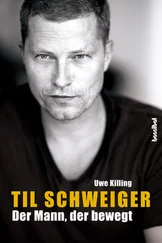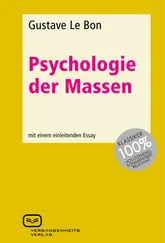Was der Täter nicht wusste, war, dass der Polizist ein Jahr zuvor einen verdächtigen Einbrecher mit seiner Dienstwaffe getötet hatte. Es wurde festgestellt, dass die Benutzung seiner Dienstwaffe gesetzesmäßig gerechtfertigt war und dass der Polizist nichts Unrechtes getan hatte. Er erhielt auch Beratung hinsichtlich „Postshooting Trauma“. Sogar nach dieser Beratung äußerte der Polizist tiefe Gefühle des Bedauerns, dass er für den Verlust eines Menschenlebens verantwortlich war. Mehrere Kollegen seiner Dienststelle sagten später, dass sie geglaubt hätten, dass dieser Polizist niemals wieder seine Waffe benutzen würde. Sein Zögern in einer anderen Konfrontationssituation kostete ihn sein Leben.
Die Vorgehensweise, die die Polizisten in ihrer Ausbildung gelernt hatten, kam manchmal in Konflikt mit ihrer persönlichen Sicherheit. Es ist also wichtig und notwendig, als Verhaltensregel eine klar definierte und einfach zu verstehende Anweisung hinsichtlich des Schusswaffengebrauchs zu besitzen.
Auf die Bedeutung einer Schießausbildung, die variationsreich ist und unter extremen Belastungen stattfindet, weist Ungerer (2001) hin. Dadurch werden die Beamten zunehmend steuerungsfähiger. „Hier liegt also möglicherweise die Erklärung dafür, weshalb hochqualifizierte Einsatzkräfte weniger töten als schlecht qualifizierte“ (Ungerer, 2001, S. 135). Anders formuliert: Je besser das Schießen geübt wird, desto größer ist die Chance, dass in einer Krisensituation nicht geschossenwird.
2.4 Im Angesicht einer gezogenen Waffe
„Warum müssen Polizisten den Helden spielen?“, fragte ein Täter bei einem Interview. Damit meinte er die zumeist vergeblichen Versuche, einen Täter zu entwaffnen, der ihnen – ohne Deckungsmöglichkeit – mit einer auf sie gerichteten Waffe gegenübersteht. 80 % der Mörder hatten während des Interviews angegeben, dass sie „instinktive Schützen“ seien. Dieser Begriff drückt aus, dass sie nicht bewusst darüber nachdenken, ihre Schusswaffe abzufeuern. Vielmehr ziehen sie einfach, zielen und drücken ab. Wenn nun ein Polizist vor einem derartigen Täter steht, der eine gezogene Waffe auf ihn richtet, sind seine Versuche, die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen, lebensgefährlich (FBI, 1992).
Völlig anders ist die Lage, wenn der Täter seine Waffe noch nicht auf den Polizisten gerichtet hat. Dann ist es wichtig, sich zu wehren, wie das Beispiel einer Polizistin bei der Verkehrskontrolle zeigte (Pinizzotto et al., 1998; s. a. Kap. 9. 2, S. 130).
Schnelle Handlungen, die die Waffe des Täters ablenkten, retteten mehreren Polizisten das Leben (Pinizzotto et al., 1997, S. 34–35). Entscheidend für das Handeln des Polizisten ist: Stellt der Täter Forderungen oder beginnt er gleich zu schießen? Hat der Täter die Waffe schon schussbereit auf den Polizisten gerichtet? Ist das Letztere nicht der Fall, ist aktive Gegenwehr notwendig.
2.5 Fehlende Identifi zierung als Polizist
Weil der getötete Polizist nicht in Uniform war, behauptete später der Mörder, dass er nicht gewusst habe, dass es sich um einen Polizisten handelte. Es wurde vom Mörder behauptet, dass er befürchtet habe, von einem anderen Drogenhändler ausgeraubt zu werden. Ein Täter sagte: „Es reicht nicht aus, zu schreien: ,Polizei, keine Bewegung!‘ oder ‚Polizei, Hände hoch!‘, weil das Einzige, was ich sie sagen höre, ist: „Gib mir dein Geld, gib mir deine Drogen“ (FBI, 1992, S. 38).
Gleichgültig, ob dies als Ausrede gedacht ist, empfiehlt das FBI eine doppelte Identifizierung: eine visuelle (Polizeiuniform, Abzeichen) und eine verbale Aufforderung.
Eine genaue Identifizierung ist auch deshalb wichtig, weil (wie z. B. ein Vorfall in der New Yorker U-Bahn zeigt) auch nichtuniformierte Polizisten versehentlich von Kollegen beschossen wurden.
3. Psychologische Fehler
3.1 War der Angriff vorhersehbar?
Pinizzotto et al. (1998) berichten, dass in den USA jedes Jahr mehr als 50000 Polizisten im Dienst angegriffen werden. Ein Drittel von ihnen wird verletzt, und etwa 70 Polizisten werden getötet. Die Untersuchung von 52 Polizisten, die Opfer eines Angriffs geworden waren, gibt – genau wie die Studie über getötete Polizisten (FBI, 1992; Pinizzotto & Davis, 1995) – Hinweise, warum in vergleichsweise ähnlichen Situationen einige Polizisten sterben oder verletzt werden und andere überleben.
Von den 40 Fällen geschahen 50 % als Reaktion auf einen Notruf, 20 % geschahen, während der Polizist verdächtige Personen oder Umstände untersuchte, und 18 % während Verkehrskontrollen oder Verfolgungen. 62 % der Angriffe geschahen zwischen 18.00 und 06.00 Uhr. Dies zeigt die Bedeutung der Sichtverhältnisse für ein Sicherheitstraining auf. In einigen Fällen war der Polizist bei dem Angriff auch durch Nebel, Regen, totale Dunkelheit oder nur teilweise Beleuchtung behindert. Während diese Faktoren nicht die Angriffe auslösten, behinderten sie doch die Fähigkeit des Polizisten, wirkungsvoll zu reagieren.
Sieben der 52 Polizisten dieser Studie wurden entwaffnet und ihre Dienstwaffe gegen sie gerichtet.
65 % der Täter, die einen amerikanischen Polizisten angegriffen hatten, sagten, dass der Angriff auf den Polizisten impulsiv, ungeplant oder aus der Situation heraus geschehen war. Ein Drittel der Täter sagte, dass nichts, was die Polizisten getan haben würden, die Angriffe verhindert hätte.
Als Absichten zum Zeitpunkt des Angriffs wurden genannt:
– Flucht oder Vermeidung einer Verhaftung (38 %),
– den Polizisten zu töten (19 %),
– den Polizisten zu erschrecken (14 %),
– den Polizisten zu verwunden (7 %),
– den Polizisten kampfunfähig zu machen (2 %).
Mit einer Ausnahme griff der Täter als Erster an. 31 % glaubten, dass der Polizist durch den Angriff überrascht wurde. 19 % der Täter beschrieben den Polizisten als fähig oder professionell, während eine gleiche Anzahl sagte, dass der Polizist angesichts des Angriffs unvorbereitet schien oder unentschlossen (Pinizzotto et al. 1997, 1998).
Zum Vergleich die Studie von Polizisten, die im Dienst getötet wurden (FBI, 1992): 57 % der Täter beschrieben das Verhalten des Opfers während der Konfrontation als „unvorbereitet“ oder „überrascht“. 39 % beschrieben das Verhalten des späteren Opfers als „bedrohlich“ oder „laut“.
Offensichtlich entsprach nur diese letztere Gruppe dem von Toch (1969) beschriebenen Muster der von Polizisten (ungewollt) provozierten Personen. Man kann also sagen, dass die Angriffe zumeist
a) nicht vom Polizisten provoziert wurden und
b) vom Täter nicht geplant waren,
sondern sich im Verlauf der Interaktion entwickelten (s. a. Sessar et al., 1980 für Deutschland). Darauf war aber der Polizist zumeist nicht vorbereitet. In einer Situation, in der er problemlösend handeln sollte, blieb er passiv oder handelte irrational.
In einem Fall näherte sich der Polizist einer Person, die offensichtlich stark unter Drogen stand. Er wartete nicht ab, bis die von ihm angeforderte Verstärkung kam. Aber bei der Konfrontation war er nicht in der Lage, den Täter zu kontrollieren, der Täter lief zum Streifenwagen. Der Polizist teilte über sein Sprechfunkgerät seinen Kollegen mit, dass der Täter in das Auto eindrang und nun das Gewehr des Polizisten hatte.
In diesem Fall ist besonders interessant, dass der Mörder angab, dass der Polizist viel Zeit gehabt hatte, ihn davon abzuhalten, in das Auto zu gelangen und das Gewehr an sich zu nehmen. Der Mörder behauptete, dass er nicht die Absicht gehabt habe, den Polizisten zu töten, dass sich aber zufällig ein Schuss aus dem Gewehr gelöst habe, der dann den Polizisten getötet habe.
Читать дальше