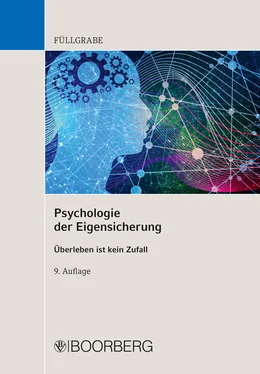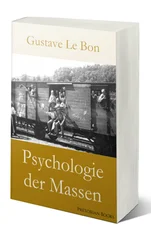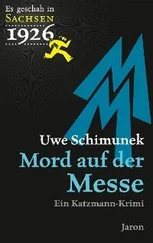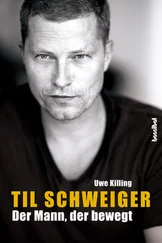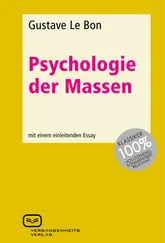Gibb (1961) hatte bei der Beobachtung von verschiedenen Gruppen festgestellt, dass die Gesprächsatmosphäre durch sechs Prinzipien entweder konstruktiv, vertrauensvoll gestaltet werden kann oder zu defensiver Kommunikationführen kann. Gibb versteht unter „defensiv“, dass die andere Person nur noch darauf aus ist, ihr Selbstbild zu wahren und nicht mehr dem Gesprächspartner zuhört, für Hinweise, Informationen und Belehrungen nicht mehr zugänglich ist. Defensive Kommunikation kann ausgelöst werden, wenn man
• die andere Person bewertet, statt ihr (Fehl-)Verhalten zu beschreiben ,
• den Eindruck erweckt, es ginge nur darum, Kontrolle über die Person auszuüben, und nicht darum, ein Problem zu lösen. Eine polizeiliche Kontrolle kann deshalb problemlos sein, wenn deutlich wird, dass es um die legale und friedliche Lösung eines Sachproblems geht und nicht um eine willkürliche Amtshandlung,
• den Eindruck erweckt, man wolle den anderen manipulieren. Hier geht es um das Problem der Fairness. Eine polizeiliche Handlung kann deshalb auch dann Akzeptanz finden, wenn sie mit negativen Sanktionen verbunden ist, vorausgesetzt, sie wird als fairangesehen,
• psychologische Distanzzeigt und z. B. kein Verständnisfür den Standpunkt der anderen Person hat (ohne diesen unbedingt zu akzeptieren),
• Überlegenheit demonstriert, statt Gleichrangigkeit betont,
• dogmatischargumentiert, statt differenziert und problembezogen zu argumentieren.
Gibb (1961) hat auf der Grundlage seiner Beobachtung von Menschen etwas Wichtiges zu der Bedeutung und Gewichtigkeit dieser Prinzipien festgestellt: Wenn man von einem Gesprächspartner als fair angesehen wird, als jemand, der den Standpunkt des Partners zur Kenntnis nimmt (ohne ihn unbedingt zu billigen), kann man auch Fehlverhalten direkt ansprechen, ohne Widerstand auszulösen. (Dies ist auch ein Erfolgsrezept der Provokativen Therapie, s. Farrelly & Brandsma, 1986.) Das bedeutet konkret: Wenn man seine Maßnahmen erklärt und begründet, wird selbst dann weniger Widerstand ausgelöst, wenn man eine negative Maßnahme durchführt (z. B. Geldstrafe verhängt). Und auch bei einer Vernehmung, beim Lügenentlarven usw., wird derjenige eher Erfolg haben, der als fair angesehen wird bzw. den Prinzipien von Gibb folgt (s. Füllgrabe, 1995).
Ein Missverständnis muss hier vermieden werden. Menschen möchten nicht von anderen manipuliert, übervorteilt, ausgenutzt werden. Interessant ist aber, dass Straftäter durchaus akzeptieren, dass es zu der Berufsrolle eines Polizisten gehört, sie zu überführen, oder eines Richters, sie zu verurteilen. Dies führt dann zu der unerwarteten Reaktion, dass mancher Straftäter aus dem Gefängnis an „seinen“ Polizisten schreibt. Offensichtlich wurde von ihnen der Interaktionspartner (Polizist, Richter usw.) als fair angesehen, obwohl er ihnen eigentlich Nachteile beschert hat. Hätte dieser aber seine polizeilichen Maßnahmen nicht konsequent und erfolgreich durchgeführt, wäre dies als unprofessionell angesehen worden und der Polizist oder Richter nicht als Respektsperson.
Wie leicht defensive Kommunikation ausgelöst und eigentlich vermieden werden kann, zeigt das Verhalten eines deutschen Polizisten bei einer Personenkontrolle. Als der Polizist von den überprüften Studenten nach dem Grund seiner Maßnahmen gefragt wurde, sagte er sinngemäß, dass er seine Gründe dafür hätte und dass er ihnen dafür keine Rechenschaft schuldig sei. Dies löste bei den Studenten den Eindruck der Willkür und damit Verärgerung aus, und die Situation hätte leicht eskalieren können.
Betrachten wir noch einmal den von Toch (1969) beschriebenen Fall. Der Polizist machte einen von Gibb beschriebenen Fehler: Er betonte die Kontrolle über den Bürger, statt das Problem zu beschreiben. Ein Hinweis auf den Grundder Bitte, die Hände aus den Taschen zu nehmen, der Hinweis, dass man die Möglichkeit einer Waffe überprüfen und ausschließen wolle, was den Wunsch nach einer friedlichenAmtshandlung/Interaktion verdeutlicht hätte („Wir alle wollen doch, dass wir gleich friedlich auseinandergehen können!“), hätte vermutlich Kooperation ausgelöst. Härtere Maßnahmen wären dann immer noch möglich gewesen!
Auch auf einen verbalen Angriff des Bürgers hätte man angemessen reagieren können, etwa wenn dieser höhnisch gesagt hätte: „Sind Sie feige?“, „Sie haben wohl Angst, dass ich ein Messer im Mantel habe?“ Der Polizist hätte je nach dem Ausmaß seines Humors, seiner Schlagfertigkeit usw. reagieren können. Die Skala derartiger Äußerungen könnte reichen von aufgabenorientierten Hinweisen bis hin zu persönlichen Aussagen: „Das ist eine Routinemaßnahme!“, „Ich tue nur meine Pflicht!“, „Sicher ist sicher!“, „Lieber vorsichtig als tot.“ Sprachgewandte Personen könnten vielleicht auch in einer solchen Situation noch Humor einsetzen, etwa mit Übertreibungen im Sinne der Provokativen Therapie von Farrelly (Farrelly & Brandsma, 1986). Ein Polizist, der eine Durchsuchung kompetent und konsequent durchführt, könnte z. B. sagen: „Ich bin so ängstlich, dass ich mich kaum noch aus dem Haus traue.“ Dies wäre in einem derart grotesken Gegensatz zu seinem sachgemäßen Verhalten gewesen, dass seine Worte eigentlich das genaue Gegenteil ihres Inhaltes signalisieren: „Ich habe keine Angst, ich weiß, was man in dieser Situation tun muss. Ich habe die Situation unter Kontrolle.“ Übrigens wären seine Worte besonders wirkungsvoll gewesen, wenn er bei einem Verdächtigen eine Waffe gefunden hätte und trotzdem weitergesucht hätte. Da relativ viele Täter noch eine zweite Waffe versteckt haben, hätten seine Worte deutlich unterstrichen: „Du kannst mich nicht provozieren. Ich kenne alle deine Tricks!“
An dieser Stelle wird die Rolle von Humorfür die Fähigkeit, gefährliche Situationen zu vermeiden oder zu überleben, deutlich: „Lebenskompetente Menschen lachen oft bei Bedrohungen. Sie reagieren wie ein Kampfsportmeister, der von einem Kind angegriffen wird. Für sie existiert die Gefahr nicht, und das macht sie so entwaffnend“ (Siebert, 1996, S. 28). Offensichtlich bedeutet dies nicht, dass man die Gefahr ignoriert, sondern eher, dass man ihr die Bedrohlichkeit nimmt und so den Weg freimacht für eine konstruktive Bewältigung. Humor gestaltet nämlich die Reaktion eines Menschen in Krisen positiv und vermindert das Auftreten von Angst und Depression: „Solange man lachen kann, ist man nicht vollkommen unter der Herrschaft von Angst oder Furcht“ (Lefcourt, 1980, S. 218). „Ein Mensch, der humorvolle Bemerkungen macht, ist entspannt, wachsam und äußerlich auf die fragliche Situation konzentriert“ (Siebert, 1996, S. 189).
6. Der Verteidigungskreis
Der amerikanische Psychiater Kinzel untersuchte Häftlinge des Gefängnisses in Springfield, die zahlreiche Gewalttaten begangen hatten. Kinzel (1961) sagte jedem Häftling. „Ich werde mich Ihnen jetzt nähern. Bitte sagen Sie mir, dass ich stehen bleiben soll, wenn Sie glauben, dass ich Ihnen zu nahe bin.“ Kinzel ging auf den Häftling zu: „Hier?“ Der Häftling schüttelte den Kopf. Doch als Kinzel sich ihm noch weiter genähert hatte, veränderte sich dessen Verhalten plötzlich. Der Mann ballte die Hände zu Fäusten, zog sich zurück, wie jemand, der einen Angriff erwartet. Kinzel bemerkte dazu: „Es war fast, als ob er sich innerhalb eines unsichtbaren Kreises befände, in den niemand – auch kein noch so friedlicher Psychiater – ohne Konsequenzen eindringen konnte.“ Kinzel glaubte, dass das bloße Eindringen in den Verteidigungskreis bei bestimmten Männern Angst auslöst, die schnell zu einem irrationalen Angriff führen kann. Er testete seine Theorie an einer Gruppe von Häftlingen, die zu Gewalttätigkeiten neigten, und verglich ihre Reaktionen mit einer Gruppe von Gefangenen, die als friedfertig galten. Die aggressiven Häftlinge stoppten Kinzel durchschnittlich in einer Entfernung von rund 90 cm und zeigten wachsende emotionale Spannung und Feindseligkeit, je dichter er an sie herankam. Die nicht aggressiven Häftlinge hingegen ließen ihn sich auf die Hälfte der genannten Entfernung nähern.
Читать дальше