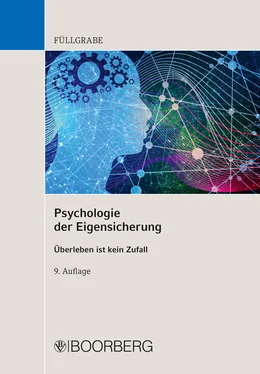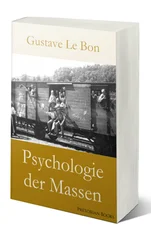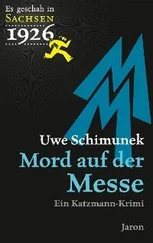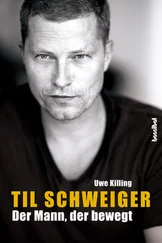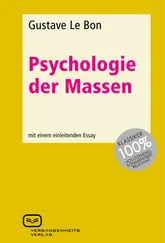Kapitel 3 Gewaltentwicklung und Gewaltvermeidung
1. Gewalt – spieltheoretisch gesehen
Bei der Analyse von gewalttätigen Männern und spezifisch von direkten Gewalttätigkeiten von Personen gegen Polizeibeamte benutzt Toch (1969) die Betrachtungsweise der Spieltheorie (s. a. Füllgrabe, 1997, 2016). Diese Betrachtungsweise sieht menschliches Verhalten so, wie es z. B. bei einem Schachspiel der Fall ist. Dort ist jeder Zug die rationale Reaktion eines Spielers auf den Zug des anderen Spielers. Beim menschlichen Verhalten sind, im Gegensatz zum Schach, diese „Spielzüge“ (= Verhaltensweisen) nicht immer rational (im Sinne von „vernünftig“), sondern manchmal sogar selbstschädigend oder eigentlich gegen die eigenen Interessen gerichtet. Solche Fälle können sein: Durch rechthaberisches Verhalten oder wegen der Bewahrung seines Selbstbildes (man will z. B. nicht als schwach erscheinen) provoziert man einen Streit, bei dem man leicht selbst zu Schaden kommen kann. Viele der von Toch (1969) beschriebenen Konflikte von Polizisten entsprechen diesem Muster.
Aber selbst wenn im Gegensatz zum Schach die einzelnen „Züge“ im menschlichen Verhalten nicht immer rational, also „vernünftig“ durchgeführt werden, entsteht das gleiche Muster: Wie beim Schach entwickeln sich die einzelnen Verhaltensweisen der handelnden Personen und die jeweiligen Reaktionen der jeweils anderen Personen allmählich in eine bestimmte Richtung, ähnlich der Endstellung beim Schach. Und dieses Endergebnis ist nicht „irgendwie“ plötzlich da, sondern hat sich in einem mehr oder minder langen Zeitraum entwickelt. Doch oft berücksichtigt man nicht die Interaktion, die gegenseitige Beeinflussung zweier Personen und den „Zeitpfeil“ und ist dann völlig von dem Endzustand eines zwischenmenschlichen Ereignisses, wie z. B. einer Gewaltsituation, überrascht. Eine Betrachtungsweise gemäß der zwischenmenschlichen Spieltheorie schärft dagegen den Blick dafür, was sich in der Situation abspielt, warum es sich so abspielt, wie es sich abspielt, und warum es sich in eine bestimmte Richtung hin entwickelt. Dies verhindert nicht nur Überraschungen, sondern es zeigt auch die Möglichkeiten, die Entwicklung in eine positivere Richtung (z. B. Gewaltfreiheit) zu lenken. Toch (1969, S. 35) hat es anschaulich formuliert: „In gewaltorientierten Begegnungen finden wir, dass Gewalt eher eingebautist als beabsichtigt.“ „Eingebaut“ bedeutet, dass die Art und Weise der zwischenmenschlichen Handlungen in eine bestimmte Richtung gehen können, hier z. B. Gewalt.
Gewalt muss also nicht unbedingt anfänglich beabsichtigt sein. Aber der Vorfall selbst entwickelt sich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, weil die Person(en) aufgrund ihrer Persönlichkeit die entsprechenden „Spielzüge“ dazu macht/machen. Die persönlichen Orientierungen bewirken charakteristische „Eröffnungszüge“ (Toch, 1969, S. 35), deshalb entwickelt sich die Interaktion in eine bestimmte Richtung. Man könnte bei jedem weiteren Zug die Richtung ändern, d. h. Gewalt vermeiden. Doch viele Menschen haben ein zu statisches Weltbild und betrachten nur sich selbst als handelnde Person und übersehen damit den Einfluss der Interaktion. Rational mag dies vielen Menschen einleuchten, taucht aber dann doch nicht in ihrem Denken und Handeln auf. Dies hat negative Folgen, z. B. bei der Gewaltentstehung. Wenn den „Spielern“ nicht bewusst wird, dass es ein „Spiel“ ist, wenn auch ein gewaltorientiertes, weil sie die „Spielregeln“ nicht kennen (z. B. das Gesetz der Straße), sehen sie die Veränderungsmöglichkeiten nicht. Deshalb eskaliert die Situation zur Gewalt. Es ist wie beim Untergang der TITANIC (1912): Die Schiffskatastrophe war keineswegs unvermeidlich. Aber allmählich hatte sich schrittweiseeine gefährliche Situation aufgebaut, die dann nach und nach zur Katastrophe führte (Füllgrabe, 1994b).
2. Gewaltorientierte Personen und ihre Mitspieler
Als Mitspieler in einem „Spiel“, das zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung führt (Toch, 1969), können auftreten:
1. Zwei gewaltbereite Personen.
2. Eine gewaltbereite Person, die den Vorfall in eine gewaltorientierte Richtung lenkt und die (zunächst) nicht gewaltorientierte Person in den Vorfall einbindet.
Die Personen müssen nicht unbedingt Gewalt von Anfang an bewusst einsetzen, aber durch ihr Verhalten lösen sie leicht Gewalt aus, wie Toch (1969) sehr ausführlich am Beispiel des „Widerstandsbeamten“ Jones schildert. Aber wie bei jeder zwischenmenschlichen Begegnung muss man beide Beteiligten betrachten. Und die Tatsache, dass Toch (1969) zehn unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen gewaltbereiter Straftäter fand, zeigt auf, dass ein Polizist immer damit rechnen muss, neben friedfertigen Bürgern auch einem „kalten Praktiker angewandter Gewalt“ begegnen zu können, um nur eine der von Toch ermittelten Persönlichkeitsstrukturen zu erwähnen.
Wie in diesem Buch gezeigt werden wird, kann man auch im Kontakt mit Gewaltbereiten durch sachgemäßes Handeln Gewalt vermeiden. Es gibt aber auch Personen, die sogar eine direkte Neigung zeigen, die Polizei zu provozieren. Toch zitiert (1969, S. 68 f.) dazu sein längeres Interview mit Jimmy, der z. B. Spottlieder auf die Polizei singt, eine Dose auf die Füße des Polizisten wirft und herabsetzende Bemerkungen macht. Er gewinnt Befriedigung durch die Tatsache, dass es den Polizisten erheblich irritiert, und freut sich, dass er die Kontrolle über die Interaktion hat. Er sieht gewissermaßen den anderen Menschen nicht als Kommunikations partneran, sondern als Bauern in einem Schachspiel oder als Marionette und sich selbst als Marionettenspieler. Doch wenn dann der andere sich nicht wie eine Marionette passiv alles gefallen lässt, sondern aktiv wird, wird dies als ungerecht, willkürlich usw. angesehen. Denn aus seiner Sicht sind ja seine Handlungen harmlos. Da er sich ungerecht behandelt fühlt, verliert er seine Beherrschung und schlägt wild und hilflos um sich. Dieses Beispiel zeigt also den Einfluss von Machtmotivation auf das Verhalten und die Gewaltentstehung auf.
3. Die vermeidbare Entwicklung von Gewalt
In manchen Fällen entsteht der Konflikt direkt aus der Interaktion . Dies ist z. B. dann der Fall, wenn sie derartig unangemessen und fehlerhaft ist, bedingt durch den Mangel an entsprechender kooperationsorientierter Einstellung und sprachlicher Kompetenz, dass man den anderen als bedrohlich, Angst einflößend ansieht oder als jemanden, der einen erniedrigt. Wie aus einem harmlosen Ereignis sich stufenweise Gewalt entwickeln kann, zeigt Toch (1969, S. 122 f.) an folgendem Beispiel auf:
Zwei Polizisten werden zu einer Familienstreitigkeit gerufen. Vor dem Haus steht der Verdächtige. Nur einer der Polizisten wird dann in eine sprachliche und körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Er sieht das Ereignis so: Der Verdächtige war bösartig und widerspenstig. Er hatte seine Hände in den Taschen seines langen Mantels. Ich war höflich und geduldig. Er nannte weder seinen Namen noch sein Alter. Der Anweisung, die Hände aus der Tasche zu nehmen, kam er nicht nach; er weigerte sich, dies zu tun.
An dieser Stelle kann man den Polizisten eigentlich verstehen. Hier wird von ihm ein wesentlicher Grundsatz der Eigensicherung berücksichtigt. Sobald man nicht die offenen Handinnenflächen eines Menschen sehen kann, kann man nie sicher sein, dass er nicht irgendeine Waffe darin verborgen hält.
Das Interview, das Toch mit ihm führt, enthüllt jedoch einige wichtige konfliktfördernde Faktoren:
Der Polizist wird durch die Dinge irritiert, die er als unverzeihliche Missachtung seiner Autorität ansieht („Seine Einstellung störte mich.“). Auf dieser Grundlage klassifiziert er den Mann als Störenfried („troublemaker“). Er deutete also das Verhalten des Mannes nicht als Reaktion seines eigenen Auftretens, sondern als eine situationsunabhängige Eigenschaft des Mannes.
Читать дальше