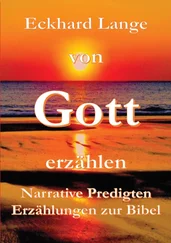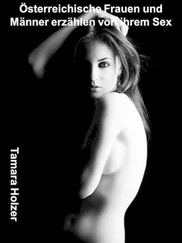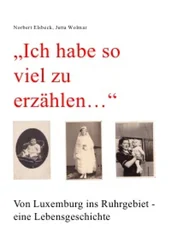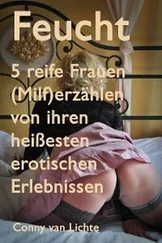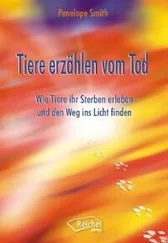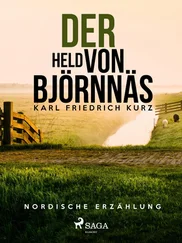1 ...6 7 8 10 11 12 ...41 Die folgenden Textpassagen können exemplarisch zeigen, dass die Fassung C den alten A-Text auf eine ganz andere Weise und mit völlig anderen Konsequenzen als die Fassung B bearbeitet.
Conlatinus macht es sich zur Gewohnheit, nach Viterbo zu reiten; seine Feinde erfahren davon:
| A 4355–58 |
B |
C |
|
[…] |
|
| Ze aller iungest nam erz im ze ainer emzechait, |
gnuog und vil gemait. |
er nam im deu emzichait: |
| daz er dikke ze Biterne rait, daz iz im harte begunde lieben. |
Collatinus dar vil oft rait durch sein chürtzweil; dar sint wol viertzig meil. daz vercherten dar nah schier |
diche er ze Biterne rait. es begunde im ser lieben da. |
| daz fraiscten di herren von Triere […] |
die herren da von Triere […] |
daz vraischten die von Trier sa […] |
Man sieht, dass die Bearbeiter von B und C unabhängig voneinander den vokalischen Halbreim lieben : Triere beseitigt haben; um dies zu erreichen hat jedoch der B-Redaktor viel radikaler eingegriffen als C. Dieser wendet eine sehr einfache Lösung an, indem er die Adverbien dâ und sâ hinzufügt; dagegen löst der B-Redaktor das vorhergehende Reimpaar auf, und zwar so, dass rait sich nicht mehr auf emzechait reimt (das Substantiv wird getilgt), sondern auf das vorausgehende Adjektiv gemait , das die Damen von Viterbo qualifiziert; der Redaktor fährt dann mit einem neuen Reimpaar fort, das eine zusätzliche Perspektive in die Erzählung einführt. Mit dem Hinweis auf die räumliche Entfernung ( wol viertzig meil ), die Conlatinus regelmäßig zurücklegt, wird sowohl die Attraktivität von Viterbo als Reiseziel als auch die Stärke von Conlatinus’ Gewohnheit unterstrichen. (Um auf die oben aufgeworfene Frage nach der Konsequenz, mit welcher die B-Fassung das Exemplarische herausstellt, zurückzukommen: An dieser Stelle scheint Conlatinus eine Verhaltensweise unterstellt zu werden, die an das Obsessive grenzt und daher dem sonst so vorbildlichen Protagonisten als charakterliche Schwäche ausgelegt werden kann.) Das darauffolgende Reimpaar mit dem reinen Reim schier : Triere (wohl haben wir mit Apokope von schiere in der mundartlich oberdeutschen Leithandschrift B1 zu rechnen) bringt einen weiteren neuen Aspekt in die Erzählung hinein, und zwar den der narrativen Prolepsis: Der Wechsel des Verbs – anstelle von vereischen (,erfahren‘) hat B verkêren (,ins Entgegengesetzte verkehren, vereiteln‘) – indiziert, dass dem Vergnügen, das Conlatinus an seinen regelmäßigen Aufenthalten in Viterbo findet, sehr bald durch seine Feinde ein Ende bereitet wird.
Obwohl die Eingriffe von C in sprachlicher Hinsicht minimal ausfallen und sehr nahe am alten Text von A bleiben, verändern sie die Dynamik der Erzählung in erheblichem Maße. So wie A die Geschichte erzählt, darf der Leser oder Zuhörer annehmen, dass zwischen der Herausbildung von Conlatinus’ Gewohnheit und der Entdeckung derselben durch die Trierer etwas Zeit verflossen ist: V. 4357 ( daz ez im harte begunde lieben ) schließt den ersten Vorgang mit einer resümierenden Aussage über die Wirkung ab, die die Viterboaufenthalte allmählich auf Conlatinus ausüben; V. 4358 ( daz fraiscten di herren von Triere ) leitet dann zum nächsten Vorgang über: Es kommt den Trierern zu Ohren, dass ihr Feind Conlatinus gern und regelmäßig in Viterbo ist ( daz kann sich auf den Inhalt der vorausgehenden drei Verse beziehen). Wie schnell die Trierer davon erfahren bleibt offen – sofort? nach längerer Zeit? Es entsteht somit eine narrative Leerstelle, die es dem Rezipienten ermöglicht, das Vergehen der Zeit zu imaginieren und zu spüren. Das vom C-Redaktor hinzugefügte Adverb sâ füllt die narrative Leerstelle aus: Die Trierer erfahren sofort von Conlatinus’ Aufenthalten. Das Reimwort dâ bewirkt obendrein, dass der Eindruck eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen Gewohnheit und Gefährdung entsteht: Conlatinus ist gern dort, in Viterbo, und so kann es nicht anders kommen, als dass seine Feinde sogleich davon erfahren.
Die Reduktion von Unbestimmtheit und die damit einhergehende Lösung der Spannung sind kennzeichnend für die Erzählregie der Fassung C. Dies demonstriert etwa der Dialog zwischen Tarquinius und der Königin, nachdem sie von der Wette zwischen den zwei Männern erfahren hat und die Wiederherstellung ihrer Ehre fordert. Hier nimmt der Bearbeiter erhebliche Kürzungen an seiner Vorlage, dem A-Text, vor:
| A 4653–61 Der kunic ir rehte sagete also er gewettet habete. diu kuniginne verstuont daz, daz iz ir ze vare getan was. si lac dem kunige an, si tet im manicvalte mane: er gewunne ir wider ir ere – ir gescæhe nie nehain herzelait so grozez mere – ode si gewunne niemer guot gemute. |
C der chunic ir rechte sagt, des wettes er nicht gedagt. deu chuniginne het daz für war, es wær ir getan ze var. si lag dem chunige an, si tet im manichvalt man. |
Der C-Bearbeiter verzichtet auf die indirekte Rede der Königin, die den Inhalt ihrer manicvalte mane referiert. In dem unmittelbar darauffolgenden Erzählabschnitt findet sich eine noch radikalere Kürzung. Die A-Fassung stellt die Reaktion von Tarquinius auf die Forderung seiner Frau in direkter Rede dar: Die Königin tue Conlatinus ein großes Unrecht; er sei ein guot kneht , seine Frau ein frumec wip ; er (Tarquinius) habe keinen Anlass, sie zugrunde zu richten. Von dieser Rede, in der Tarquinius sich weigert, der Forderung seiner Frau nachzukommen, gibt es in der C-Fassung keine Spur. Stattdessen fährt der Erzähler mit einer Rede der Königin fort:
| A 4667–70 Diu kuniginne begunde wainen. si sprah: ‘der triwen sin wir iemer mer gescaiden. du hast mih verlorn, ih enwil niemer mer in din bette komen’. |
C Deu chuniginne wainet ser. si sprach: ‘wir schaiden uns immer mer. mir werde mein laster e benomen, ich wil nimmer an dein bette chomen’. |
In der A-Fassung sind diese Worte eine Replik auf die Weigerung des Königs, gegen Conlatinus und Lukretia einzuschreiten. Da diese Weigerung in der C-Fassung fehlt, sind dieselben Worte keine Erwiderung mehr, sondern die unmittelbare Fortsetzung der manichvalt man , der zahlreichen Ermahnungen der Königin, die in der Drohung gipfeln, ihrem Ehemann den Geschlechtsverkehr zu verweigern. Die Kürzung zerstört die Dynamik des Gesprächs, wie es von A gestaltet wird. Dort kann man eine fortschreitende Intensivierung der rhetorischen Überzeugungsmittel beobachten, die die Königin einsetzt: Zunächst ermahnt sie ihren Mann; als ihre Worte ohne Wirkung bleiben eskaliert sie die Situation erst mit Tränen und dann mit Drohungen. Der König gibt dann der Forderung seiner Frau nach:
| A 4671–76 Der kunic sprach ir uber lanc zu: ‘waz ratest du daz ih dar umbe tuo?’ si sprach: ‘herre, wil du behalten minen list, ih rate dir daz du daz selbe wip erwirvest’. |
C Der chunic sprach ir aver zuo: ‘waz wil du daz ich dar umb tue?’ si sprach: ‘lieber herre mein, wil du mir gevolgich sein, ich rate dir sam mir mein leip, daz dir wirt daz selb weip’. |
| ‘entriwen’, sprah der kunic here, ‘des rates volge ih dir gerne’ |
‘entreuwen’, sprach er, ‘gern den rat ich von dir lern’. |
Die signifikante Änderung befindet sich im ersten Vers. In der A-Fassung reagiert Tarquinius auf die Tränen und Drohung seiner Frau uber lanc – nach einer längeren Pause. Damit gelingt es dem Erzähler, einen Denkprozess zu suggerieren, der beim König zu einer Meinungsänderung führt: Tarquinius lehnt die Forderung seiner Frau zunächst kurzerhand ab und gelangt erst nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss, er sollte ihr doch besser nachgeben. (Wieder ist Unbestimmtheit im Spiel, weil man ja nie genau erfährt, was der König während dieser längeren Gesprächspause alles überlegt.) In der C-Fassung wird das adverbiale uber lanc durch ein aver ersetzt, das – gleich, ob man es mit ,noch einmal‘ oder ,jedoch‘ übersetzt – im Zusammenhang völlig sinnlos ist: Es handelt sich hier um die erste Rede des Königs überhaupt, und es gibt nichts, wozu seine Worte in einem kontrastiven oder gegensätzlichem Verhältnis stünden. Die Dynamik des Gesprächs und das Spannende daran sind aus der Erzählung verschwunden: Den widerwilligen Gesprächspartner, auf den man mit immer drastischeren rhetorischen Mitteln (Forderung, Tränen, Drohung) einreden muss, sowie den spannungsvollen Ablauf des Dialogs – wird der König von seiner anfänglichen Weigerung abrücken oder bleibt er unnachgiebig? – ersetzt die C-Fassung durch ein einfaches Nacheinander von Verlangen und Nachgeben: Die Königin stellt ihre Forderungen mit Tränen und Drohungen, so dass der König einlenkt.
Читать дальше