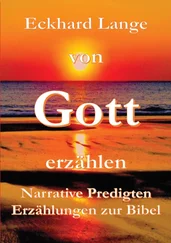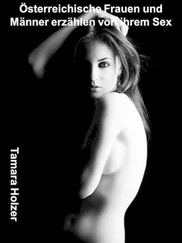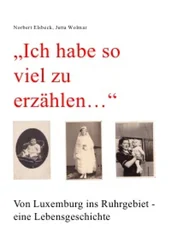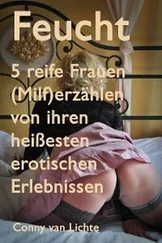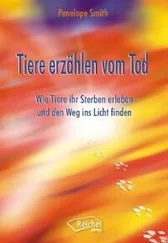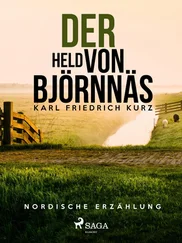1 ...7 8 9 11 12 13 ...41 Ob die spannungsarme Erzählregie von C ein bewusst verfolgtes Ziel des Bearbeiters war, oder ob sie das Nebenprodukt formaler Änderungen ist, lässt sich schwer bestimmen. Die Auslassung ganzer Reden durch den Redaktor spricht für eine mit Bedacht eingesetzte Erzählstrategie; andererseits muss man auch berücksichtigen, dass die veränderten Zeit- und Gesprächsdynamiken sehr oft mit der Herstellung von reinen Reimen und metrisch einwandfreien Vierhebern einhergehen. So begünstigt der Reim dâ : sâ , der die alte Assonanz lieben : Triere ersetzt, den Eindruck eines automatischen Fortschreitens von einer Situation (Conlatinus hält sich oft und gern in Viterbo auf) zu einer anderen (die Trierer haben es herausbekommen); der Vers Der ch ú nic spr á ch ir á ver z ú o ist ein Vierheber mit regelmäßiger Alternation von Hebung und Senkung, aus dem fünfhebigen Vers von A gebildet: Der k ú nic spr á ch ir ú ber l á nc z ú ; vielleicht wurde das Adverbiale uber lanc , das eine längere Denkpause auf der Seite des Königs suggeriert, einfach aus metrischen Gründen und ohne besondere Rücksicht auf die Gesprächsdynamik durch das kürzere aver ersetzt.
Die Frage – gewollte Strategie oder beiläufiges Nebenprodukt formaler Änderungen? – lässt sich erst durch weitere Untersuchungen der C-Fassung mit größerer Klarheit beantworten. Eines jedoch kann man bereits mit Bestimmtheit sagen: Die Redaktionen B und C sind eigenständige Bearbeitungen, die ihre Vorlage auf eigene Weise, mit eigenen Prioritäten und eigenen Wirkungen retextualisieren. Das ist ein wichtiges Ergebnis, zumal die Forschung immer wieder dazu geneigt ist, beide Fassungen über einen Leisten zu schlagen, da sie in den B- und C-Redaktionen kaum etwas anderes als die mehr oder weniger gelungene formale Neuerung der frühmhd. Fassung A sehen wollte.1 Jede Redaktion hat jedoch ihre Eigenart, die zu beschreiben eine künftige Aufgabe der Forschung und Literaturgeschichtsschreibung sein wird und – wie wir hoffen – durch die synoptische Neuedition der Kaiserchronik und die damit verbundenen Studien erst ermöglicht und erleichtert wird.2
Jan-Dirk Müller
Die Kaiserchronik 1 steht am Anfang der Auseinandersetzung volkssprachiger Geschichtskunde mit gelehrter Geschichtsschreibung. Es sind vor allem zwei Prinzipien, die ihren Stoff organisieren: die Chronologie und die strikte Abfolge der römischen Kaiser. Bekanntlich verstößt sie im Einzelnen gegen beide: Die Angaben der Regierungszeiten sind durchweg falsch, und die Reihe der Herrscher ist sowohl lückenhaft als auch um Namen erweitert, die nicht hineingehören. Trotzdem weisen beide Prinzipien nach allgemeiner Ansicht auf ein Geschichtsverständnis, das dasjenige einer volkssprachigen Laiengesellschaft von Grund auf transformiert.
Selten wurde die Gegenrechnung aufgemacht, der Anteil eines ‚anderen‘ Konzepts von Geschichte an der Kaiserchronik . Karl Stackmann hat auf einen Beitrag von Hanna Vollrath aufmerksam gemacht,2 die vom „Sog“ der mündlichen laikalen Kultur auf die litterate Kultur der Kleriker sprach:
Sie sagt, daß es während des jahrhundertelangen Nebeneinanders der zwei Kulturen, der mündlichen und der schriftlichen, im Mittelalter zu Rückwirkungen oraler Geschichtsauffassung auf die Träger der Schriftkultur gekommen ist.
Von dieser hat er das auf „literarischer Überlieferung“ gründende mittelalterliche Geschichtsdenken abgesetzt:
es ist ein Denken in der Dimension der Heilsgeschichte. Geschichte wird vorgestellt als eine gerichtete Bewegung, die von einem Anfang – der Schöpfung – her über eine geordnete Folge bedeutsamer Ereignisse bis zur Zäsur des Erscheinens Christi und von da über die Gegenwart weiter bis zu einem letzten Ziel – dem Jüngsten Gericht – führt. Für ein solches Denken ist eine klare Unterscheidung der Vergangenheit, des bereits zurückgelegten Weges, von der Gegenwart und der noch bevorstehenden Zukunft eine Selbstverständlichkeit.3
Die Kaiserchronik wird in der Regel in dieser Perspektive gelesen.4 Auch wo man einer theologisch-typologischen Deutung reserviert bis skeptisch begegnete und sich der Erzähltechnik, der narrativen Verknüpfung, dem Aufbau und dergleichen widmete, herrscht Konsens, dass die Kaiserchronik von der lateinischen Chronistik des 11. und 12. Jahrhunderts abhängig ist und in diesem Kontext erforscht werden muss.5 Mein Beitrag fragt nach Spuren einer anderen Geschichtsauffassung. Das ist eine Sichtweise, die sich u.a. in der Verschiebung des Schwerpunktes der Textanalyse abzeichnet. Zunehmend kommen bisher weniger beachtete Teile der Kaiserchronik in den Blick, wie z.B. die nachkarolingische Geschichte, in der sich deutlicher als in gelehrter Geschichtsschreibung das Selbstverständnis der Laiengesellschaft abzeichnet.6
Die Kaiserchronik will eine crônicâ sein (V. 17). Eine crônicâ rechnet von einem Gegenwartspunkt zurück und vermisst genau den Abstand zu denen, die vor uns wâren / unt Rômisces rîches phlâgen / unze an disen hiutegen tac (V. 21–23). Sie gehört also zum zweiten der von Stackmann skizzierten Typen. Seinen Anspruch sucht der Kaiserchronist durch ein möglichst lückenloses chronologisches Gerüst zu erfüllen, das die Geschichte des römisch-deutschen Kaisertums vollständig organisiert. Erst eine schlüssige Chronologie kann Basis einer kausalen Verknüpfung von Geschehnissen sein, die als wahrscheinlich gelten kann und den gelehrten Vorbehalt gegen die volkssprachige Geschichtskunde abweist. In der Tat dominiert die Ausrichtung der Kaiserchronik an der chronologischen Ordnung einen großen Teil des Textes und hat entsprechend die meiste Aufmerksamkeit in der Forschung gefunden, zumal wo die durch gelehrte Überlieferung gesicherte Geschichtszeit mit Sage kollidiert wie beim Ostgotenkönig Theoderich dem Großen.7 Doch ist das nur die eine Seite.
Mathias Herweg hat auf die eigentümliche narrative Struktur eines Textes hingewiesen, der für ein noch ungeübtes volkssprachiges Publikum bestimmt ist.8 In vielem bleibt das gelehrte Geschichtskonzept stecken. Bekanntlich nimmt die Kaiserchronik viel Sagenmaterial auf; insbesondere in den Randzonen des Textes bemüht sie sich nicht um eine exakte Chronologie. Es sind vor allem drei Komplexe, die sich dem chronologischen Prinzip entziehen: 1. die vielen Sagen und Legenden,9 die der Erzähler einschaltet, 2. die Vorgeschichte des kaiserlichen Rom und 3. der weltgeschichtliche Rahmen der Geschichte des römischen Reichs.10
Kurz zu eins: Die Ordnung, der der Kaiserchronist sein Material unterwirft, ist immer dann gefährdet, wenn der zu erzählende Stoff eine eigene Faszination entwickelt. Das ist vor allem bei den eingeschobenen Sagen und Legenden der Fall, die mehr oder minder beliebig in den chronologischen Rahmen gezwängt werden, ohne genauer zeitlich fixiert zu sein: ez bechom (V. 690, Veronikalegende); Eines tag es (V. 909, ein Verbrechen bei der Eroberung Jerusalems); Duo stuont iz unlange (V. 1235, Faustinianlegende); Aines tages kom iz sô (V. 4415, Beginn der – falsch datierten – Lucretia-Handlung); der cunich siechen began (V. 7813, Einsatz der Silvesterlegende) usw. Solche Zeitangaben sind in frühmittelalterlichen volkssprachigen Erzählungen überall da üblich, wo nicht, wie etwa im Heliand , die heilsgeschichtliche Ordnung der Geschichte genauere Bestimmungen verlangt.11 Das erzählenswerte Ereignis wird, so gut es geht, in die Herrscherchronologie eingefügt. Zu diesem Zweck muss Tarquinius, der Schänder der Lucretia, römischer Kaiser sein und viereinhalb Jahre und zwei Monate herrschen. Die Einschübe sind Relikte eines anderen Geschichtsverständnisses, das auf Bedeutsamkeit statt chronologische Vollständigkeit setzt.
Читать дальше