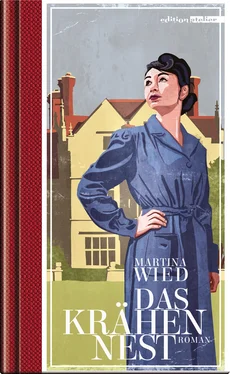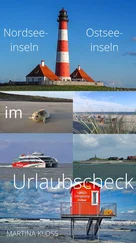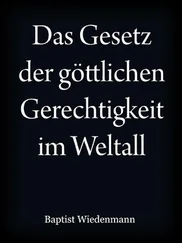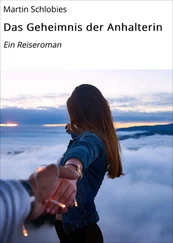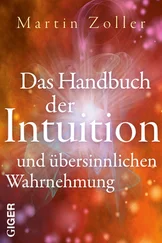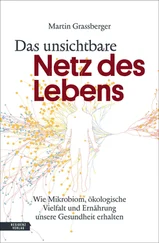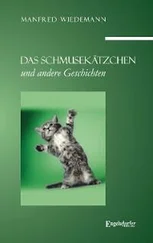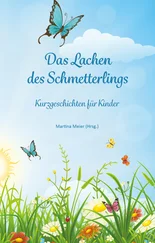Der erste Schultag verläuft ganz angenehm. Madeleine hat die Aufenthaltsbewilligung für ein »militärisch geschütztes Gebiet« in der Hauptstadt abwarten und dadurch vier Schultage versäumen müssen, die Schüler sind also gespannt, neugierig – und zufrieden, daß es überhaupt wieder eine französische Lehrerin als Nachfolgerin Mademoiselle Telliers gibt, die zu ihren Eltern nach den Vereinigten Staaten übersiedelt ist. Die ursprünglich in Aussicht genommene – geht es gerüchtweise in der Télème-Abtei um – habe im letzten Augenblick abgesagt, und Hermione, mit ihrem vielgerühmten Geschick im Menschen- oder Lehrerfang, hat im allerletzten eine treffliche Kraft gefunden: einen französischen Flüchtling wie Mademoiselle Tellier – und so etwas wie eine wissenschaftliche Berühmtheit. Wird sie sich nun den ungewöhnlichen Verhältnissen der Télème-Abtei anzupassen verstehen? Kommt sie vom Montmartre, vom Montparnasse, aus dem Quartier Latin, oder, Gott behüte, aus einem der eleganten Viertel nächst den Champs Elysées oder rings um den Parc Monceau herum? Wie wird sie sich mit der geringen Anzahl an Badezimmern, dem Mangel an Kleiderschränken, an Spiegeln und Teppichen abfinden?
Badezimmer, versichert Beatrice, die mehrere Sommer in der Bretagne verbracht hat, seien in französischen Privatwohnungen eine Seltenheit, überhaupt sei Reinlichkeit, seien sanitäre Anlagen den Galliern unbekannt, statt einer ordentlichen Dusche genügt eine Flasche mit Gummiball und ein Parfümschauer …
»Unter Louis XIV. – aber doch nicht heutzutage? …«
»Heute wie damals und fast überall, nur gibt es nicht überall ein Parfümfläschchen.«
»Es ist etwas daran«, mischt sich Juliet ein, »meine Tante Marjorie hat sich knapp vor dem Krieg nach Paris verheiratet. Ihr Bräutigam hat sie, aus besonderer Aufmerksamkeit, vor die Wahl gestellt: Salon oder Badezimmer? Natürlich könnten sie sich beides leisten, aber die Franzosen sind, scheint es, sehr sparsam, und die Wohnungen sehr teuer. ›Badezimmer, selbstverständlich‹, sagte die Tante Marjorie. Das hat bei ihrer neuen Familie scharfe Kritik herausgefordert. Man ist es sich schuldig, einen Salon zu haben, wo, wann – wie oft man badet, geht hingegen niemanden etwas an, gleich um die Ecke rechts, in der Rue Cardinet, ist eine öffentliche Badeanstalt, dorthin geht man einmal im Monat, das genügt.«
Juliets Zuhörerinnen schütteln sich vor Lachen. Sie haben ganz vergessen, daß nicht viele in der Télème-Abtei öfter als einmal im Monat zu einem ordentlichen heißen Bad kommen, man behilft sich, wie man kann. Im übrigen, wird entschieden, ist es nicht unsere Sorge, wie Madame sich in die hiesigen Verhältnisse schickt, sondern wie wir uns mit ihr abfinden.
Madeleines Zimmer in den Stallungen hat einen roten Fliesenfußboden, weißgestrichene Wände, gebräuntes Gebälk als Decke. Es ist erfreulich kahl, als Wandschmuck dienen dicke Heizröhren, die an zwei Seiten der Decke sowohl wie dem Fußboden entlang laufen, und eine Siedetemperatur verbreiten. Man muß hier das Fenster Tag und Nacht offenhalten, tröstet sich Madeleine, die im vergangenen Trimester in einem feuchtkalten Kloster, wo alles schimmelte, rostete oder Grünspan ansetzte, nicht wenig gefroren hat.
»Und wo«, fragt sie die Sekretärin, die sie eingeführt hat, »bring’ ich meine Sachen unter?«
– Eine schöne Person; sie erinnert mich – denkt Madeleine, – an den Lionardo in der Wiener Liechtensteingalerie. Das Haar trägt sie aufgesteckt, wie die Kaiserin Elisabeth es trug, ist das jetzt hier Mode? Und gar in Verbindung mit Männerhosen? Die Frauenzimmer hier scheinen alle zweigeschlechtlich zu sein, vom Fuß bis zur Mitte männlich, von da ab aber können sie sich nicht genug tun an Weiblichkeit: Busen, Hüften, Zöpfe, Locken, komplizierte Frisuren oder langes offenes Haar. Haben sie keine Empfindung für das Zwitterhafte ihrer Erscheinung, oder taugt es ihnen, bedienen sie sich seiner zweckhaft? –
»Ihre Sachen?«, antwortet mit einer Gegenfrage die Sekretärin, »hinter dem Vorhang dort, oder hier, in dem grünen Wandschränkchen.«
Das Wandschränkchen erweist sich als mit vielerlei männlichem Kleinkram angefüllt; hinter dem Vorhang gibt es rohe und rauhe Holzgestelle, worauf man, ohne sie zu beschädigen, weder Bücher noch Toilettegegenstände unterbringen dürfte.
»Vielleicht«, fragt die Ankömmlingin schüchtern, »könnten die Bretter fortgenommen und ein paar große Nägel in die Wand darüber eingeschlagen werden? Dann möchte ich meine Kleider und Mäntel an meinen mitgebrachten Haken dort aufhängen. Es fehlt auch ein Spiegel: Aus Aberglauben nehme ich auf Reisen keinen mehr mit, seit mir einmal unterwegs einer zerbrochen wurde, ich habe dann wirklich sieben Jahre Unglück gehabt. Jetzt ist die Zahl meiner Unglücksjahre schon so angewachsen, daß ich keine weiteren riskieren kann.«
»Abergläubisch?«, fragt die Sekretärin wohlwollend, als ob sie zu einem Kinde spräche, »das finde ich ja ganz reizend, um so mehr«, fährt sie mit schiefgelegtem Kopf fort, »als es eigentlich nicht zu Ihnen paßt, Sie machen doch sonst einen so überlegenen Eindruck. Es hat mich ordentlich gefreut, wie Sie der Frau Hermione gleich klargemacht haben, was Sie als Ihre Position ansehen und daß die Gute – oder vielmehr gar nicht Gute – mit Ihnen nicht so umspringen darf, wie mit uns anderen: Es war sozusagen ein Lehrstück – ich hoffe nur, sie wird sich die Lehre merken.«
»Glauben Sie? Nun, es war gewiß nicht meine Absicht, hier, und gleich bei der ersten Begegnung, mich, wie man in Wien sagen würde, ›auf die Hinterfüße zu stellen‹, ich habe mich ganz einfach uneingeschüchtert so verhalten, wie es meine Art ist. Die Wahrheit zu sagen, geht es mir auf die Nerven, wenn ich sehe, daß die Flüchtlinge, besonders die belgischen, deutschen und österreichischen, vor unseren Wirten oder Gastfreunden kriecherisch und würdelos vergessen, was ihnen zukommt, oder, und das ist noch schlimmer, so tun, als ob sie daheim in Palästen gewohnt und von Silber gespeist hätten, auch wenn man ihren Allüren anmerkt, daß sie sich erst gestern das Messer in den Mund zu stecken abgewöhnt haben. Wenn die Dame Hermione es mit solchen zu tun hatte, kann man ihre Arroganz – obschon sie sich nicht rechtfertigen läßt – doch verstehen …«
»Ach nein, die ist ihr schon angeboren, sie hat es hier fast immer mit einer Elite von Lehrkräften zu tun, gerade deshalb freut es sie, solche, die im kleinen Finger mehr wissen und können als die ganze Hermione, ihre wirtschaftliche Überlegenheit fühlen zu lassen. Ihnen hätte man selbstverständlich ein besseres Zimmer als dieses anweisen müssen und können, es steckt schon Absicht dahinter, wenn Sie so primitiv untergebracht werden, es mangelt doch hier am Nötigsten …«
»Wenn man«, sagt Madeleine vorsichtig – man kann nicht wissen, ob diese scharmante junge Sekretärin ihre Kritik an der Prinzipalin nicht als Fangfrage aufgestellt hat, mit der Absicht, Madeleines allfällige Klagen ehestens höheren Ortes zu melden – »ein wenig mehr als vierzig Jahre in einigem Komfort zugebracht hat, merkt man nicht gleich, ob, was man selbst für ein Minimum nimmt, woanders vielleicht schon als Maximum gilt. Finden Sie meine Ansprüche sehr unbescheiden?«
»Gar nicht unbescheiden, bloß«, sagt gedehnt in ihrem slawischen Tonfall die Sekretärin, »vielleicht unerfüllbar. Soviel an mir liegt, möchte ich gewiß alles tun, um Sie zufriedenzustellen. Wenn es nicht geht, sollen Sie wenigstens wissen, daß ich mich redlich darum bemüht habe, nur fehlt es mir leider an Autorität. Ich bin erst seit ungefähr einem Jahr hier, und man muß schon eingesessen sein, um etwas zu erreichen.«
»Wann ist man hier ›eingesessen‹?«
»Im dritten Jahr fängt es an, aber die wenigsten bringen es so weit.«
Читать дальше