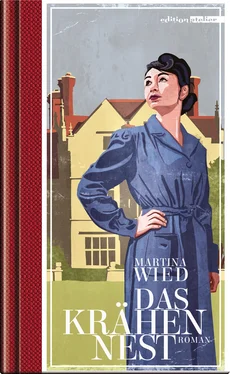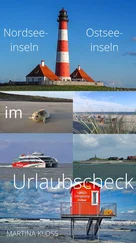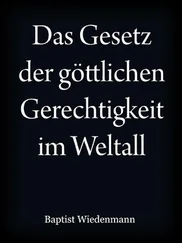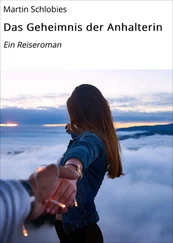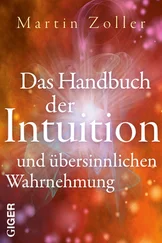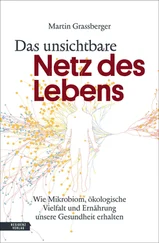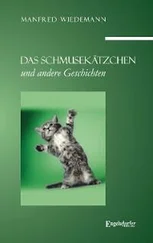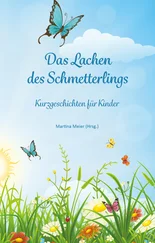Zum erstenmal, seit er seinen Besitz an dem nun zahnlückenhaft ausgebrochenen Rande der Hauptstadt gegen dieses abgelegene und verfallene Gut ausgetauscht hatte, fühlte Leontes sich unsicher, an seiner Verantwortlichkeit gepackt, gefährdet, aufgeregt. Er ließ, und zwar auf eigene Kosten, Chemiker aus den verläßlichsten Laboratorien der Residenz kommen, die alle Quellen und Brunnen auf dem Lavendelhof nach möglichen Viren analysierten. Die Quellen und Brunnen gaben in der üblichen Zusammensetzung, welche wir in der Ebene zu finden gewohnt sind, allerdings mit einem in solchen Lagen ungewöhnlichen Kalkreichtum, durchaus unverdächtiges, bekömmliches Wasser. Leontes, nahezu enttäuscht in seinem Bestreben, ein konkretes Gebrechen, dem man irgendwie beikommen könnte, für die Epidemie verantwortlich zu machen, dachte nun – nicht ohne den von ihm zu Rate gezogenen Fachleuten ein Lächeln zu entlocken – an die Erde, der das von den Kindern verzehrte Gemüse, oft als Rohkost genossen, entsprossen war: Eine gute, vielleicht von Kalidünger etwas überanstrengte Erde war es; schließlich ließ Leontes die in solchem Überfluß vorhandene Milch seiner acht mageren, hochblonden Kühe (die überdies vor dem Gebrauch noch pasteurisiert wurde) untersuchen: Es war eine nicht sehr fetthaltige, aber bazillenfreie Milch. Leontes stand vor einem Rätsel: Wenn Wasser, Erde, Milch gesund waren – warum sind dann die Kinder erkrankt? Wo verbarg sich das Gift, das ihren Organismus durchseuchte, woher strömte es in die jungen Körper über? Und wieso war er selbst – Leontes, war Hermione, seine Frau, und seine Tochter Miranda vor der Ansteckung gefeit? (Aber, das hätte ihm zu denken geben müssen, nicht Arthur, sein Sohn, der, im Gegenteil, einer der von der Seuche am schwersten, bis zur Lebensgefahr Ergriffenen war!)
Dysenterie ist keine Krankheit, die wen immer auf die Vermutung brächte, ihr Ursprung sei anderswo als im Körperlichen zu suchen; noch der verbissenste Psychoanalytiker hielte es für ausgeschlossen, daß man einen Ruhrkranken in seine Behandlung überstellen könnte. Nicht so die Zöglinge der Télème-Abtei-Schule: Sie nannten ihre Krankheit »die Pest«, es gesellte sich bei ihnen zu den höchst empfindlichen physischen Qualen jenes Grauen, jene übernatürliche Angst, die seit altersher einzig durch Aussatz und Pest, unter allen Seuchen, erweckt wird. Die Zöglinge der Schule auf dem Lavendelhof beurteilten einander gegenseitig danach, ob sie diese Prüfung mit Anstand, Würde, Tapferkeit – oder kläglich winselnd, jammernd und sich selbst bemitleidend hinnahmen; man konnte nicht mehr daran zweifeln, daß sie die Heimsuchung (obschon die Télème-Abtei ja den Religionsunterricht abgeschafft hatte und den sonntäglichen Kirchgang dem religiösen Bedürfnis des einzelnen anheimgab) als eine Art stellvertretenden Leidens ansahen, wodurch sie sich von der Feigheit, die in ihrer Flucht auf das Land verborgen war – jetzt nämlich nannten sie’s ohne jede Beschönigung so –, freikauften.
Als die Krankheit, wie man annehmen durfte, erloschen war (später erwies sich’s allerdings, daß die meisten der neu eintretenden Zöglinge und der hinzukommenden Lehrer sie nachholen mußten, ja sogar, daß viele, die gleich von der ersten Ansteckung betroffen worden waren, Rückfälle erlitten), merkte Leontes, daß unter seinen Schutzbefohlenen eine Seelenmüdigkeit überhandnahm, die ihre Auffassungsgabe, ihren freiwilligen Fleiß, die Gaben, die sie so hoch über die Gleichaltrigen in anderen Schulen hinausgehoben hatten, herabminderte. Man müsse die Kinder, riet Hermione ihm, zu zerstreuen trachten, wie wär’s mit einer Kinoanlage? »Falls du«, erwiderte Leontes mit jener Stimme, die, eine Mischung von Eis und Stahl, wenn er sich an seine Gattin wendete, so oft aus ihm hervorbrach, »die Kosten auf dein Konto übernehmen wolltest – bitte!«
Es wäre, überlegte er, nicht nur billiger, sondern auch weitaus erziehlicher, das junge Volk zu eigener Leistung anzuregen, wir sollten die auch anderwärts zum Trimesterende üblichen Theateraufführungen überdies zwischendurch, mit musikalischen Darbietungen abwechselnd, zu einer regelmäßigen Einrichtung machen, so zwar, daß alles – die Herstellung der Dekorationen wie die Regie, die Auswahl der Stücke – den Zöglingen überlassen bliebe; selbstverständlich aber dürfte über diesen Geistesübungen der Sport nicht vernachlässigt werden. Übrigens …; trotz der scharfen Ablehnung, die seine Gattin von ihm erfahren hatte, erwog Leontes dennoch die Anschaffung einer Tonfilmeinrichtung. Gefahr bestand nämlich, daß man eine Anzahl von Zöglingen an andere, inzwischen gleichfalls evakuierte Schulen, die unweit des Lavendelhofs elegantere, bequemere und – fügte Leontes mit einem innerlichen Seufzer hinzu – hygienisch ein wandfreiere Unterkommen gefunden hatten, verlöre: dem mußte mit allen Mitteln, auch wenn sie beträchtliche Auslagen erforderten, vorgebeugt werden.
Der Prinzipal berief eine Versammlung des Lehrstabes ein, mit der Tagesordnung: »Wie unterhalten wir unsere Buben und Mädel während des Wochenendes?« – Gut und schön, Samstag, das versteht sich, der übliche Fußballwettkampf, an dem ja, erstaunlicherweise, auch eine Anzahl der Schülerinnen großes Interesse nahm, aber immerhin bloß ein passives; die meisten wollten selber den ihnen gemäßen Sport betreiben, Hockey oder Netzball …, »à propos: Ich hörte soeben, eines der Netze sei zerrissen. Ist bereits Ersatz bestellt worden?«
Die Angelegenheit »Netzball« wird weitläufig erörtert, bis man zu anderer Erheiterung der weiblichen Jugend – die ja beim Netzball stärker beteiligt ist als die männliche – übergehen kann.
»Bei schlechtem Wetter aber? Pingpong? Wir haben zwei Tische und sechsundsiebzig Mädchen. Vier oder fünf darunter spielen Schach, überraschend genug nicht einmal schlecht, und zwei bis drei Dutzend Bridge – obschon ich Kartenspiele in meinem Hause nicht gern sehe. Auch nehmen bloß die Ungeistigen, und vor allem die Unmusikalischen, daran Interesse, denken wir jetzt an die Geistigen und Musikalischen: Die meisten Mädel und auch eine hübsche Anzahl Burschen spielen Klavier, wie viele, nebstbei? Dann haben wir sechzehn oder siebzehn Geiger und Geigerinnen, vier Cellisten. Ein halbes Dutzend ungefähr bläst Flöte: Daraus läßt sich schon ein brauchbares Hausorchester zusammenstellen.«
»Immerhin wäre das Arbeit, nicht Unterhaltung.«
»Für solche, die mit Feuereifer dabei sind, zumindest erziehliche Unterhaltung.«
»Und wie viele werden diesen Vorschlag mit verkniffenen Lippen aufnehmen? Das gehört in die Arbeitswoche, unsere Freizeit wollen wir anders zubringen, in der Stadt sind wir ins Kino gegangen, werden sie sagen …«
»Bravo, da haben wir’s ja: eine Kinoeinrichtung, machen wir uns selbständig.«
»Wissen Sie vielleicht, wenn auch nur annähernd, wieviel so etwas kostet, Antonius? Nun, ich weiß es, denn ich habe diese große Ausgabe bereits erwogen – und, wiewohl sie in gewissem Mißverhältnis zu dem, was Anstalten mit bedeutend höherem Schulgeld sich leisten, stünde, war ich bereit, dieses finanzielle Opfer zu bringen –, da kamen die Einschränkungen im Stromverbrauch: Wir können doch nicht gut an dunklen Wintermorgen in unerleuchteten Schulzimmern sitzen, oder übers Wochenende die Milch im Frigidaire sauer werden lassen – bloß um samstags Diana Durbin zwitschern zu hören und sonntags ›Phantasia‹ aufzuführen! Sie, als Philologe, Antonius, dürfen sich ja solche Phantasien leisten, ich aber, als Doktor der Politischen Ökonomie, besitze einen gewissen Sinn für Proportion, vielmehr, ich bin sogar dazu verpflichtet, ihn in Anwendung zu bringen …«
Nach dieser Stabsversammlung, der auch die beiden weiblichen Mitglieder der Lehrerschaft angewohnt hatten, nahm Leontes einige seiner jüngeren Professoren beiseite. Des Prinzipals gute Laune war von ihnen noch weit stärker gefürchtet als seine unvorhersehbaren Zornesausbrüche. Diese konnte man schweigend, gebeugten Nackens, wie ein Gewitter, über sich hinbrausen lassen, war er aber aufgeräumt, dann erwartete er lachende oder lächelnde Beistimmung zu seinen witzigen Bemerkungen: recht peinlich für die Zuhörer.
Читать дальше