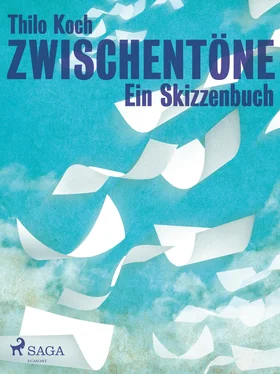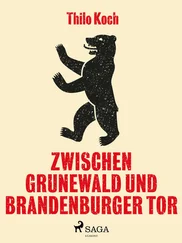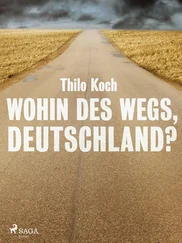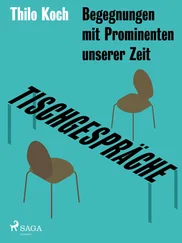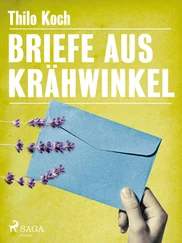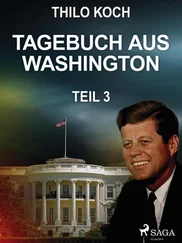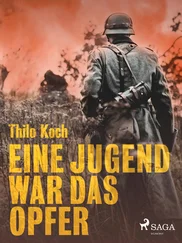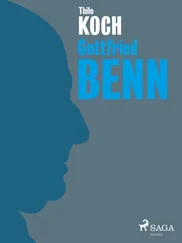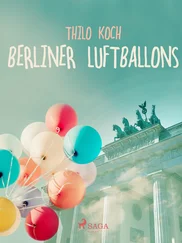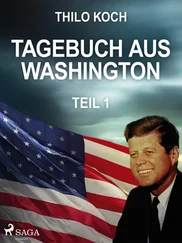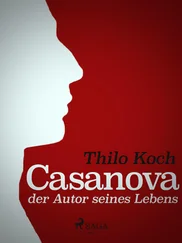Sonnenwendfeuer und Scheiterhaufen, Bücherverbrennung,
das Ja zum totalsten der Kriege.
Tausend, zehntausend Tonnen Phosphor und Sprengstoff:
Lützowplatz, Hansaviertel, Bahnhöfe –
und über die Wohnungen, Fabriken, Geschäfte
der größten kontinental europäischen Stadtlandschaft
Bomben und Minen, eine Sintflut von Feuer.
Der Mensch stirbt, wenn mehr als die Hälfte
seiner Haut verbrannt ist –
Diese Stadt lebte weiter.
Heute nun: ein verzahntes Ineinander
von Karthago nach dem » . . . esse delendam«,
Neonreklamen und Neo-Kapitalismus.
Das westliche Hongkong für politische Flüchtlinge.
Die Arbeiter bilden die stärkste Partei.
Alle Filme der Welt.
Südfrüchte, Bücher und gute Stoffe,
der Dernier cri aller Moden
zwischen Paris und Tokio, Sydney und New York:
im einzigen Schaufenster des Westens
hinter dem Eisernen Vorhang.
Berlin führt das Doppelleben des Mondes,
angestrahlt nur auf einer Seite
und mit verödetem Gürtel
zur Zone eines verfinsterten Schweigens hin.
Nichts mehr von Gloria,
Klingklang und Luxus nicht,
Arbeit nicht viel,
etwas mehr als genug große Worte,
auch die zutreffenden (»Tapfres Berlin!«)
machen bankrott. Müde Menschen,
laute, wortkarge, törichte, überbewußte –
viele, zu viele Menschen.
Doch zusammen ein Schlag, der nicht umkommt,
verhältnismäßig wenig korrupt,
seltsam offen und wach und, wenn es sein kann,
tolerant und hemdsärmelig treu;
wißbegierig und vorlaut, anpassungsfähig und zäh
wie das Kaninchen im märkischen Sandfeld,
doch immer geheim auf Gelegenheit hoffend
zu Hochherzigkeiten.
Nicht schön, nicht leuchtend, auch einladend nicht
ist Berlin, und doch kann diese Stadt Heimat sein,
Heimat und Zentrum.
Heimat gerade denen,
die sonst fremd sind überall in der Welt.
Zentrum diesem schwierigen Volke der Deutschen,
dem fleißigen, immer gestaltlosen
zwischen Auflösung und Verkrampfung.
»Komm her oder bleib«, sagt Berlin,
»ich mach dir nichts vor.
Morgen kann vieles anders sein,
wie gestern vieles anders war;
aber ich bin gegenwärtig.
Das wäre nicht viel?
Wenn du willst, ist es alles.«
Durch die Mark nach Schwerin
Die Treppe zum Wohnhaus ist ganz zerfallen, die Leute gebrauchen sie als schiefe Ebene. Denn bewirtschaftet ist der Hof: es steht ein Knecht zwischen großen Pfützen. Das Strohdach der Scheune hat quadratmetergroße Löcher, die Sparren starren gegen den preußischblauen Frühlingshimmel. Die fast unbefestigte Dorfstraße besteht aus Schlaglöchern bis zu einer Tiefe von zwanzig Zentimetern. Mit zwanzig Stundenkilometern rumpelt unser »Ikarus«, ein ungarischer Bus, durch dieses märkische Elend. Bei der Ausfahrt lese ich auf dem gelben Schild: »Manker«. Das Dorf liegt in der Nähe von Neuruppin. Man hat uns über eine Umleitung gefahren. Lag an der Fernverkehrsstraße etwas, das wir nicht sehen sollten?
Ludwigslust: Links vor der kleinen Brücke, die zum Restaurant hinüberführt, ein Glaskasten mit »Sichtwerbung«. Die Bar des Hauses wird empfohlen. Drinnen riecht es bürgerlich-muffig, wie seit Jahrzehnten. Die Fleischbrühe mit Ei ist vorzüglich und kostet 65 Pfennig. Der Kollege neben mir zahlt für ein Glas chinesischen Tee und eine Flasche Selters 50 Pfennig. Ein Kalbsfilet mit Beilagen kostet 3,70 D-Mark (Ost) ohne Marken – gegen 100 g Fleischmarken nur 2,95 DM. Unter den Nachspeisen steht Ananas mit Schlagsahne obenan – es ist eine Wochentags-Karte. Der Kellner im schwarzen Anzug ist höflich und schnell; er könnte Steward auf einem Luxusdampfer gewesen sein. Auf den Tischen saubere weiße Decken.
Es ist schon dunkel, als wir das Parkhotel in Ludwigslust verlassen. Wir haben in dieser »HO-Gaststätte« relativ gut und preiswert gegessen; das Grabower Bier war nicht übel, und das Kännchen Mokka für 1,20 DM (Ost) ließ sich trinken, schmeckte etwas sehr frisch geröstet, war aber »reine Bohne«. Auf einem Schild vor dem Konsum einer kleinen Ortschaft lese ich allerdings im Vorbeifahren: »Kaffee eingetroffen – 100 Gramm 8 Mark.« Hat das HO-Restaurant für den Eigenbedarf Sonderpreise?
In den kühlen Aprilhimmel über Ludwigslust ragen überraschend viele Antennen. Ich zähle an einer Straße allein sieben. Es sind eigentümlich hohe Fernsehantennen mit allen Schikanen. Man kann mit ihnen zweifellos das West-Fernsehen über die Strahler in Hamburg empfangen.
Die Kollegin mir gegenüber schaltet ein kleines Lämpchen ein, das auf dem Tischchen zwischen uns montiert ist. »Ikarus«, der volkseigene Bus aus Budapest, das Transportmittel des »Presseamtes beim Ministerpräsidenten«, mit dem wir kollektiv verfrachtet werden, »Ikarus« ist den Abteilen der 1. Klasse in russischen D-Zügen nachgebildet. Er rumpelt robust über die Interzonenstraße Hamburg-Berlin. Wir schalten das idyllische feudale Glühwürmchen wieder aus, denn uns fasziniert die Dunkelheit in den Dörfern und Städten, durch die wir rumpeln und donnern.
Es ist acht Uhr abends. Nur wenige Fenster überhaupt erleuchtet, dann aber trübe, 25 er Birnen. Und dazu noch das Fenster verhängt. Nicht ein einziges Mal bietet sich zutraulicher Einblick in eine Wohnstube, eine Küche, wo doch jetzt gewiß wie überall auf der Welt um diese Zeit die Familie um den Tisch sitzt. Ist der Krieg hier eigentlich wirklich auch schon viele Jahre vorbei? »Kohlenklau!« Wer erinnert sich noch? Heute heißt es für die Leute hinter den verdunkelten Fenstern: »Wattfraß!«
Wer einmal so durch die Nacht der Sowjetzone nach Berlin gefahren ist, der versteht, daß diese Stadt in der Vorstellung der 17 Millionen Menschen in der Zone einem Stern gleich über dem grauen Einerlei der 14 Bezirke schwebt.
Aber Pointierung soll uns nicht ungenau machen. Das »platte Land« ist natürlich überall weniger glanzvoll als die Großstadt. Wer aus einem Heidedorf nach Hamburg kommt, steht auch verwirrt; wer umgekehrt mit feinen Stadtschuhen in einen Kuhstall tritt, fühlt sich ausgesetzt. Zumal, diese märkischen Dörfchen und mecklenburgischen Kleinstädte waren auch zu Kaisers Zeiten arme Flecken mit geduckten Dächern und geduckten Rücken; wenig Licht, und Berlin war auch damals die weithin strahlende Attraktion, das lockende Babel.
Nur: die heute an der ewig zu kurzen Decke herumschnippeln, die da heute preußische Zucht und Ordnung auf ihre Weise predigen – die leben von »Perspektiven«: Milch und Honig für jedermann. Das ist der falsche Zungenschlag einer Partei, die ihre Legitimation aus dem sozialen Versprechen bezieht. Und nicht einmal dieses Versprechen hält sie.
Schwerin allerdings präsentiert sich lustiger. Die jungen Mädchen, selbst die, die die abfahrenden russischen Soldaten mit blauen Halstüchern schmücken, mit Blumen, tragen sich westlich. Ihre engen Hosen und bunten Anoraks, die roten Ballettschuhe und die betont kurzen oder betont langen Haare wirken wie ein Affront inmitten von Gestalten, die aus einem Film von 1938 sein könnten. Eckige Schultern der Schneiderkostüme, weite Hosen der Männer, Mäntel lang übers Knie hinunter.
Auch die Stoffmuster sind noch die gleichen, und die Stoffqualität scheint recht wollarm zu sein. In einem Schaufenster sehe ich Schuhe. Gewiß, es gibt welche für 25 oder 35 Mark. Aber ein fester Halbschuh mit Kreppsohle ist für 112 DM (Ost) ausgestellt. »Und dann fehlt immer die richtige Größe«, sagt eine Frau unaufgefordert und geht weiter.
Diese Jugend strebt ganz unverkennbar eine amerikanische Note an. Man weiß ja, wie jazzbegeistert sie ist. Und das Regime läßt es zu. Auch in Moskau, dem großen, fernen, hier oft so nahen Vorbild.
Читать дальше