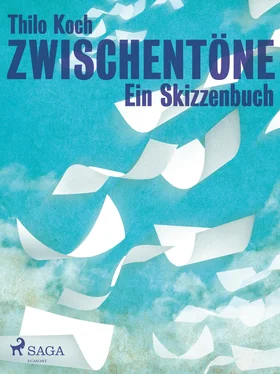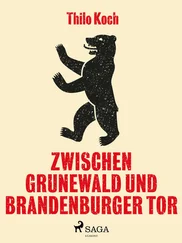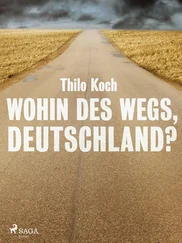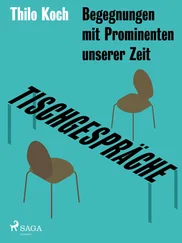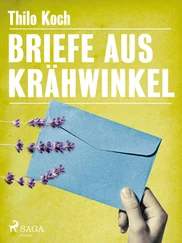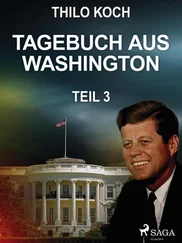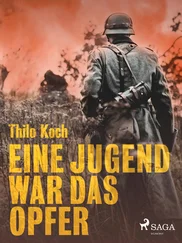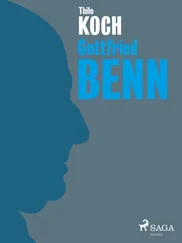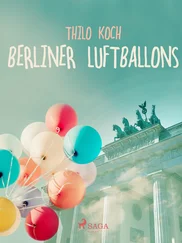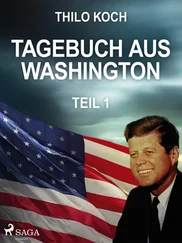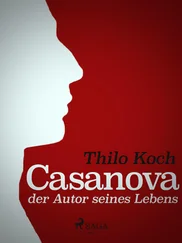Funkelnde, glitzernde, in Akkorden weich hupende, dahingleitende, regenbogenfarbig glänzende Rudel von Automobilen, weiße, schwarze Pneus auf rotem Asphalt. Blitzende Lichtgirlanden über Straßen, Cafés, Promenaden. Lachende Seitenblicke aus dunklen Augen, schmiegsames Jerseygewebe gibt weiße Schultern frei, modelliert Taillen und mehr. Rauchende Herren in spitzen Schuhen, doppelt geschlitztem Rock und kurzem Kraushaar. Ein südlich perlendes Idiom garniert zierlich leere Höflichkeiten um den ganzen süßen Tanz.
Luxus – es gibt ihn hier ganz beiläufig. Und er ist angenehm. Für die exklusive Creme, die ihn hat, vielleicht weniger als für den Zuschauer, der ihn bewundert – wie ein kunstvoll inszeniertes Stück auf dem Theater, eine Geschichte aus den Tausendundein-Nächten. Dort unter den hundertjährigen Platanen sitzen und der Harmonie eines Abends mit halbgeschlossenen Augen zuhören . . .
Es sei auch hier nicht alles vierzehnkarätig, und was da gleißt, wäre billig? Warum Neid? Ist es nicht schön, daß Watteau »die Einschiffung nach Kythera« gemalt hat? Wird’s weniger schön dadurch, daß niemand diese rosa-him-melblau verdämmernde Insel der Seligen je erreichte? Die happy few, sollen sie doch glücklich erscheinen; denn wer von ihnen wandelt schon wirklich »droben im Licht«.
Das Verlangen nach dem dreihundertpferdigen Wagen, der Villa am Meer, der geheimnisvollen Dame dort drüben hinter dem Eisbecher, unter der rot-weißen Markise – das alles ist harmloser als der finstere Hunger nach Macht, der immer die verzehrt, die das läßlich egoistische Menschenvolk bessern, gewaltsam zu Sittenstrenge und Einfachheit erziehen wollen.
Gleichmütig rückt der Zeiger der großen Blumenuhr im Englischen Garten von Sekunde zu Sekunde. Hier stand ich schon einmal, vor einigen Jahren: Eisenhower traf Bulganin und Chruschtschow. Viele tausend Stunden zeigte diese einzigartige Uhr inzwischen an. Wie ihr Zeiger, so drehte sich um die eigene Achse und kam kein Stück von der Stelle auch: die deutsche Frage. Und nun? Vier großmächtige Außenminister sind versammelt, um abermals den Stein den Berg hinaufzuwälzen.
Eine unzählbare indische Familie, dunkel getönt und sahribunt in einem riesigen Plymouth mit Haifischflossen; ein Zwei-Meter-Neger neben mir im Zoll auf dem Flughafen; flinke Japaner mit Brille unter jeder Arkade – das ist seit den selig-unseligen Völkerbundzeiten jahrauf, jahrab so. Internationale Konferenzen? Kein Genfer Bürger fragt danach.
Die schweizerische Akkuratesse wird in Genf gemildert durch einen Stich romanisches »Laisser-aller«. Da bröckelt schon mal der Putz, und das »merci« des Telefonfräuleins klingt zwitschernd wie in Paris. Die jungen Mädchen mit den Augen im Trauerrand, den blaßrosa Lippen und der Nymphenmähne haben das Zwei-Parteien-System: hie Bardot, hie Vlady. Es wippt der Rock im Frühlingshauch, und weiter oben schwankt es auch (das Herz).
Das männliche Gegenstück, die Studenten, sind ein Cocktail aus »St.-Germain-des-Prés-Existentialismus« und Texas. Die amerikanische Note dominiert, obwohl die Eidgenossen nicht in der NATO sind. Kennzeichen: Jeans, Haltung: relaxed und Hindenburg-Frisur.
Aus der Espresso-Bar tönt’s wie in München und Hamburg: »Ciao, Ciao, Bambina . . .« Ich ziehe abends das »Bavaria« vor, ein Münchner Bier unter Karikaturen von Stresemann und Briand. Hier haben die einmal den Silberstreifen »Frieden« mitsammen erstritten – beim deutschen Bier. Auch damals ging’s um Erbfeindschaft. Heute sehe ich keinen Minister mit dem Kollegen von der Gegenseite ins »Bavaria« gehen. Den Genfern ist’s Wurscht – Felix Helvetia . . .
Verlorene Zeit – wiedergefunden
Die Zeit der Könige und ihrer Schlösser scheint für unser politisches Gefühl Jahrtausende zurückzuliegen. Und doch hat unsere ältere Generation noch den Trommelwirbel der farbenprächtigen Wachablösung im Ohr, die goldene Equipage der Hoheiten vor Augen. »Fridericus Rex, unser König und Herr . . .« – das mag begeistert oder mürrisch gesungen worden sein, oft und oft, auf dem Exerzierplatz vorm Charlottenburger Schloß. Pferde bestimmten noch das Straßenbild, in dem es an kokettierenden Demoisellen, stutzerhaften Rokoko-Kavalieren, schnauzbärtigen Gardekürassieren nicht fehlte.
Aus alten Kupferstichen tritt uns diese Welt noch entgegen. Und aus den königlichen Parks, Lusthäuschen, Galerien und Kuppeln, die erhalten blieben. Ein Schimmer vom Glanz versunkener Epochen stimmt uns lyrisch. Gern, vielleicht allzugern vergessen wir die Not, die Unterdrückung feudaler Jahrhunderte vor den majestätischen Proportionen, dem gediegenen Luxus. Berlins Schlösser wurden vom Kriege besonders hart verwüstet. 1943 brannte das schönste vollkommen aus, das Charlottenburger. Napoleon fand 1806, als er Berlin erobert hatte und hier wohnte, es sehe Versailles sehr ähnlich. Unersetzliche Porzellane, Tapeten, Möbel, Stuckarbeiten und Intarsien gingen verloren. Ganz unwiederbringlich die Fresken von Pesne an Decken und Wänden.
Fünfzehn Jahre nach der zerstörenden Bombennacht erhob sich aus dem musterhaft gepflegten Park eine glänzende neue Fassade. Kupfergedeckt ragt die 48 Meter hohe Kuppel Eosanders von Goethe über dem Mittelteil; die steinernen Gladiatoren hüten das äußere Tor. In der Mitte des Hofes: Andreas Schlüters »Großer Kurfürst«. Dieses riesige Bronze-Reiterstandbild hat im Baedeker zwei Sterne; es ist eines der schönsten Bildwerke des ganzen europäischen Barock. Früher stand es auf der Langen Brücke, versank dann auf einem Transport für drei Jahre im Wasser. Nun thront der schwere Kurfürst wieder auf seinem schweren Pferd und blickt ins Weite; es scheint ihn nicht zu kümmern, daß sein Brandenburg in den Staub sank – für immer. Rechts ist der lange Flügel, den Friedrich der Große von seinem Baumeister Knobelsdorff anfügen ließ, ebenfalls ganz wiederhergestellt – und zentralgeheizt, denn hier gibt es jetzt die schönsten Sonderausstellungen der Inselstadt Berlin.
Die »Nationalgalerie der ehemals Staatlichen Museen« zeigte hier zuletzt Lovis Corinth, aus Anlaß seines hundertsten Geburtstages. Bisher gab es wohl noch nie eine solche Zusammenfassung der besten Werke des Ostpreußen, der zusammen mit Liebermann und Slevogt das große Berliner Dreigestirn der Zeit vor dem ersten Weltkrieg bildete. Die derbe Sinnlichkeit Corinths muß damals schockiert haben. Die Akte und Stilleben, die Blumenstücke bersten vor Kraft und Farbe. Überraschend geistig, ja psychologisch, daneben die Porträts: Eduard Graf Keyserling, Friedrich Ebert – vor allem aber: er selbst. Nach dem Schlaganfall im 54. Lebensjahr ist die dionysische Fülle dahin, die Sinnlichkeit vergessen, der starke Puls nur noch matt. Aber das letzte Selbstbildnis und die »Ausgeschütteten Blumen« des Todesjahres 1925 sind die schönsten Stücke der Ausstellung. Er war teilweise gelähmt, als er das schuf, seine Hand zitterte. Und doch sprach erst jetzt ganz unabgelenkt sein Genius. Früher schäumt und brodelt die Lebensfreude so stark, schlägt sein Realismus manchmal so wild zu, daß übertriebene, manchmal sogar kitschige Effekte die Bilder schreien lassen. Jetzt entstehen Landschaften aus dem Alpenvorland, die zu den ewigen Meisterstücken der Malerei zählen: die Komposition apollinisch souverän, die Farbe aber noch kühn und saftig; über allem jedoch der gebrochene Schimmer des Bewußtseins der Vergänglichkeit, der verklärt und bewegt.
Der Blick aus den tiefen Fenstern des Knobelsdorff-Flügels schweift ungehindert durch den vorfrühlingshaft kahlen Park. Spaziergänger in warmen Mänteln noch, die die Stille und heiter gemessene Kultur dieser Oase im Trubel der großen Stadt genießen. Freilich wird es dauern, bis die jungen Linden und Blumen den erneuerten Stein in jenes poetische Grün wieder einbetten, das erst ganz die Illusion zurückgibt von einer guten, alten, verlorenen und wiedergefundenen Zeit.
Читать дальше