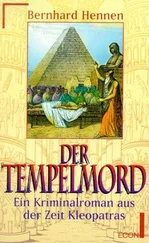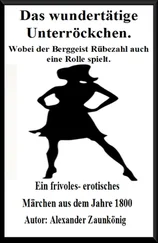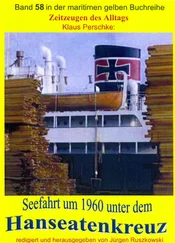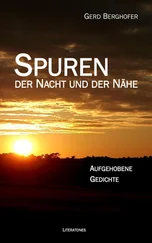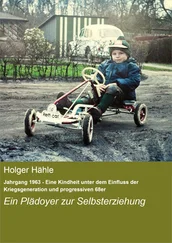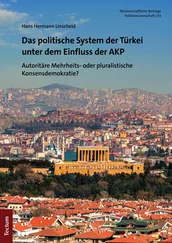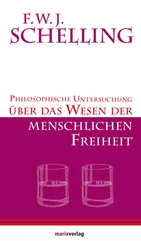Die Energiewirtschaft ist im Begriff, aufgrund der flächendeckenden Einführung von hochauflösender digitaler Messtechnik ein deutlich datengetriebenerer Wirtschaftszweig zu werden, als dies bisher der Fall war. Angesichts der zahlreichen energiewirtschaftlichen Intermediäre auf den verschiedenen Wertschöpfungsstufen, Millionen von potenziell einbindbaren Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen und der diversen in Betracht kommenden Validierungsgegenstände (z.B. Messwerte aus Smart Metern oder dem Erzeugungsort einer bestimmten Energiemenge) sind zahlreiche neue energiewirtschaftliche Geschäftsmodelle unter dem Einsatz der Blockchain-Technologie denkbar. Diese müssen sich allerdings insbesondere am bestehenden Rechtsrahmen des Regulierungs- und Datenschutzrechts messen lassen.
16Boehme-Neßler, Unscharfes Recht, S. 502. 17Burgwinkel, in: Burgwinkel, Blockchain Technology, S. 3 (47); Böhme/Pesch, DuD 2017, 473. 18Vgl. zu Smart Contracts die Ausführungen unter Teil 2 B.V. 19Zur medialen Rezeption Simmchen, MMR 2017, 162; Blocher, AnwBl 2016, 612ff.; McLean/Deane-Johns, CRi 2016, 97. 20Vgl. hierzu das unter Pseudonym veröffentlichte Whitepaper von Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System; Sixt, Bitcoins, S. 1ff. 21Burgwinkel, in: Burgwinkel, Blockchain Technology, S. 3 (48); grundständig zu Krypotowährungen siehe Pesch, Cryptocoin-Schulden; Hötzel, Virtuelle Währungen; Engelhardt/Klein, MMR 2014, 355ff.; Omlor, MMR 2018, 428ff.; Omlor, ZIP 2017, 1836ff.; Seitz, K&R 2017, 763. 22Zu den Herausforderungen im Rahmen eines ICOs Krüger/Lampert, BB 2018, 1154ff.; Brocker/Klebeck, RdF 2018, 288ff. 23Zu den Herausforderungen für Gesetzgeber und Rechtswissenschaft Omlor, ZRP 2018, 85ff. 24Vgl. Auffenberg, NVwZ 2015, 1148ff. 25Vgl. Plitt/Fischer, NZA 2016, 709ff. 26Zur Veränderung und Ausspähen von Daten durch Aufbau eines Botnetzes zur Bitcoin-Erzeugung BGH, Beschl. v. 21.7.2015 – 1 StR 16/15, ZD 2016, 174. 27Vgl. Goger, MMR 2016, 431ff.; Heine, NStZ 2016, 441ff.; Safferling/Rückert, MMR 2015, 788ff.; Rückert, MMR 2016, 295ff. 28Zur immaterialgüterrechtlichen Einordnung von Kryptowährungen Hohn-Hein/Barth, GRUR 2018, 1089 (1091f.); zu Gebrauchtsoftwarelizenzen auf der Bitcoin-Blockchain Blocher/Hoppen/Hoppen, CR 2017, S. 337ff. 29Zu ‚Antitrust by Design’ und Blockchain vgl. Louven, InTeR 2018, S. 176 (177). 30Grundlegende ertragsteuerliche Fragen werden etwa skizziert bei Boehm/Pesch, MMR 2014, 75 (76); Kuhlmann, CR 2014, 691 (696). 31Vgl. zu Bitcoin in der IFRS-Bilanzierung Thurow, IRZ 2014, 197ff. 32EuGH, Urt. v. 22.10.2015 – C-264/14, MMR 2016, 201ff. – Hedqvist. 33Vgl. Pesch/Böhme, DuD 2017, 93ff.; Böhme/Pesch, DuD 2017, 473ff.; Martini/Weinzierl, NVwZ 2017, 1251ff.; Schrey/Thalhofer, NJW 2017, 1431 (1433ff.). 34Zu möglichen Anwendungsbereichen vgl. dena, Blockchain in der integrierten Energiewende, S. 36–78; BDEW, Blockchain in der Energiewirtschaft, S. 33–41. 35BMWi/BMF, Blockchain-Strategie der Bundesregierung, S. 3. 36BMWi/BMF, Blockchain-Strategie der Bundesregierung, S. 23f. 37Vgl. BNetzA, Die Blockchain-Technologie, S. 24ff.
C. Schnittstellen von Energie- und Datenschutzrecht
Die Regelungsbereiche des Energiewirtschafts- und Datenschutzrechts sind untrennbar miteinander verbunden.38 Vor allem die Einführung intelligenter Messsysteme hat eine fundamentale Änderung der datenschutzrechtlichen Probleme und Risiken zur Folge.39
Am Themenfeld ‚Smart Metering‘ zeigt sich plakativ der Koordinationsbedarf zwischen Regulierungs- und Datenschutzrecht.40 In den §§ 49ff. MsbG wurde ein sektorspezifisches Datenschutzrecht für den Bereich des intelligenten energiewirtschaftlichen Messwesens geschaffen, um einer Zersplitterung der Rechtsmaterie vorzubeugen und deren Grundrechtsrelevanz zu berücksichtigen.41 Das MsbG wurde allerdings zu einem Zeitpunkt erlassen, zu dem sich das europäische Datenschutzrecht erheblich im Umbruch befand. Am 25.5.2018 hat die Datenschutz-Grundverordnung42 (DS-GVO) nach zweijähriger Übergangszeit gemäß Art. 94 Abs. 1, 99 Abs. 2 UAbs. 1 DS-GVO Geltung erhalten und ist nach Art. 99 Abs. 2 UAbs. 2 DS-GVO i.V.m. Art. 288 Abs. 2 AEUV in all ihren Teilen verbindlich sowie unmittelbar in jedem Mitgliedstaat anwendbar.43 Sie schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen, insbesondere deren Recht auf den Schutz personenbezogener Daten nach Art. 1 Abs. 2 DS-GVO.
Trotz des grundsätzlichen Anwendungsvorrangs der DS-GVO als Verordnung hat der nationale Gesetzgeber durch sog. Öffnungsklauseln in vielen Konstellationen die Möglichkeit, spezifischere nationale Regelungen zu schaffen, zu erhalten oder auch Betroffenenrechte zu beschränken, beispielsweise nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 2, Abs. 3 oder Art. 23 DS-GVO.
Der deutsche Gesetzgeber hat von dem ihm eingeräumten Handlungsspielraum in Teilen bereits Gebrauch gemacht. Mit dem Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz44 (DSAnpUG-EU) wurde unter anderem das vollkommen neu gefasste Bundesdatenschutzgesetz (BDSG n.F.) erlassen. Die datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte wurden in §§ 32–37 BDSG n.F. spezifischer ausgestaltet.45 Das BDSG n.F. ist dabei weiterhin ein Auffanggesetz, das bereichsspezifische nationale Datenschutzregelungen zulässt und gegenüber diesen subsidiär ist.46
Mit dem ‚Zweiten Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680‘ (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU – 2. DSAnpUG-EU), das am 25.11.2019 im Bundesgesetzblatt verkündet wurde47, wurde der deutsche Kanon der bereichsspezifischen Datenschutznormen weiter an die DS-GVO angepasst. Dieses umfangreiche Artikelgesetz sieht bereichsspezifische Änderungen an datenschutzrechtlich relevanten Normen in insgesamt 155 Fachgesetzen vor. Unter anderem wurde in Art. 90 des 2. DSAnpUG-EU eine – größtenteils redaktionelle – Anpassung der datenschutzrechtlichen Vorgaben des MsbG vorgenommen.48
Durch die Geltung der DS-GVO und die jeweils ergänzend heranzuziehenden nationalen Regelungen wurde das Datenschutzrecht in ein komplexes Mehrebenensystem umgewandelt, das sich durch bislang noch weitgehend ungelöste Abgrenzungsfragen auszeichnet. Auch das Verhältnis der §§ 49ff. MsbG zur DS-GVO bedarf noch einer grundlegenden methodischen Klärung49, obwohl das MsbG seit Herbst 2016 in Kraft ist und der Smart-Meter-Rollout bereits in Teilen gestartet ist. Auf den insgesamt 146 Seiten des Regierungsentwurfs zum Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende vom 17.2.201650 findet die DS-GVO keine Erwähnung. Es wird lediglich konstatiert, dass der Entwurf mit dem geltenden EU-Recht und Völkerrecht vereinbar sei.51
38So auch Bräuchle, Datenschutzprinzipien in IKT-basierten kritischen Infrastrukturen, S. 34. 39Wolff, in: Gundel/Lange, Digitalisierung der Energiewirtschaft, S. 95 (98). 40Vgl. Schneider, in: Körber/Kühling, Regulierung, S. 113 (134). 41BT-Drs.18/7555, S. 3; Karsten/Leonhardt, RDV 2016, 22. 42Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27.4.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. L 119, S. 1. 43Die DS-GVO wurde zuletzt angepasst durch das Corrigendum 8088/18 des Europarats v. 19.4.2018, ABl. L 127 v. 23.5.2018; die Berichtigung der deutschen Sprachfassung erfolgt ab S. 47 des Anhangs zu diesem Corrigendum. 44Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU – DSAnpUG-EU) v. 30.6.2017, BGBl. 2017 I, S. 2097. 45Vgl. Dix, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, DSGVO, Art. 23 Rn. 28. 46Vgl. § 1 Abs. 2 BDSG n.F.; BT-Drs. 18/11325, S. 79. 47BGBl. 2019 I, S. 1626. 48Vgl. BMI, Referentenentwurf zum 2. DSAnpUG-EU v. 21.6.2018, S. 368–373; BT-Drs. 19/4674, S. 321–325; BGBl. 2019 I, S. 1679–1681. 49Keppeler, EnWZ 2016, 99; Bretthauer, ZD 2016, 267; Bretthauer, EnWZ 2017, 56; Diedrich, in: Steinbach/Weise, MsbG, § 52 Rn. 2; Bartsch/Rieke, EnWZ 2017, 435 (441). 50BT-Drs. 18/7555. 51BT-Drs. 18/7555, S. 65.
Читать дальше