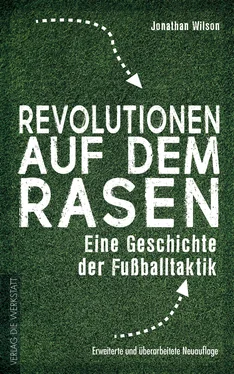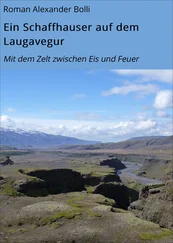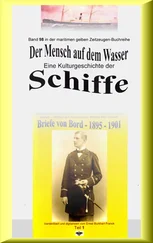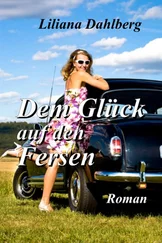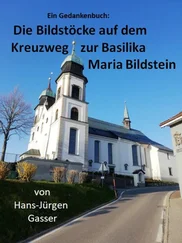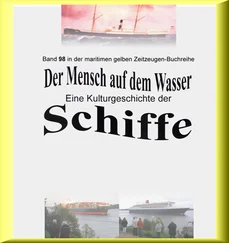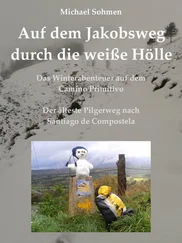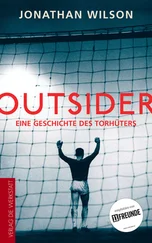Nerz’ Assistent Sepp Herberger, der die Bundesrepublik Deutschland 1954 zum Gewinn der Weltmeisterschaft führen sollte, wohnte dem Spiel nicht bei. Er sah sich vielmehr das Viertelfinale zwischen Italien und Japan an. Als Herberger im Mannschaftsquartier gerade sein Abendessen – Eisbein mit Sauerkraut – verdrückte, überbrachte ihm ein anderer Trainer die Nachricht von der Niederlage Deutschlands. Herberger schob seinen Teller beiseite und rührte nie wieder ein Eisbein an.
Einige Zeit nach dem Turnier wurde er zu Nerz’ Nachfolger ernannt und ging sofort zu einem stärker am Donaufußball orientierten Spiel über. Dazu holte er Adolf Urban und Rudi Gellesch von Schalke 04 in die Mannschaft und beorderte den eleganten und recht trinkfesten Halbstürmer Otto Siffling von Waldhof Mannheim auf die Mittelstürmerposition. Dadurch erlangte die Mannschaft eine deutlich größere Flexibilität, die am 16. Mai 1937 beim 8:0-Sieg gegen Dänemark in Breslau ihren Höhepunkt erreichte. „Der Roboterstil, den die Leute Deutschland so gerne anhängen, wurde ins Reich der Legenden verbannt“, schrieb der Journalist Gerd Krämer. „Die Fußballkunst triumphierte.“
Allerdings waren die Deutschen bei Weitem noch nicht so begabt oder kunstfertig wie die Österreicher, und die Ostmark dominierte auch das Verbrüderungsspiel. Die spätere Mythenbildung mag die Tatsachen etwas verschleiert haben. Gewiss ist jedoch, dass Sindelar in der ersten Halbzeit eine Reihe von Chancen ungenutzt ließ. Angesichts der Regelmäßigkeit seiner knapp neben dem Pfosten vorbeirollenden Schüsse wurde selbst in zeitgenössischen Berichten die Frage aufgeworfen, ob er sich über die Deutschen – und einen möglichen Befehl, keine Tore zu erzielen – lustig machen wollte, indem er absichtlich daneben zielte. Mitte der zweiten Halbzeit verwertete Sindelar schließlich einen Abpraller, und als sein Freund Schasti Sesta einen Freistoß mittels Bogenlampe zum zweiten Treffer nutzte, feierte er diesen mit einer kleinen Tanzeinlage vor der mit Nazigrößen besetzten Ehrentribüne.
In den folgenden Monaten lehnte es Sindelar, der nie einen Hehl aus seinen Sympathien für die Sozialdemokraten machte, wiederholt ab, für Sepp Herbergers vereinte „großdeutsche“ Mannschaft zu spielen. Im August 1938 kaufte er das Café von Leopold Drill, einem Juden, der den Betrieb unter massivem Druck der Nazis hatte aufgeben müssen. Je nachdem, welcher Darstellung man Glauben schenken will, waren die von Sindelar gezahlten 20.000 Mark entweder ein fairer Preis oder auf schändlichste Weise opportunistisch. Für seinen Widerwillen, nationalsozialistische Plakate aufzuhängen, zog er sich zwar die Missbilligung der Behörden zu. Sindelar dem Widerstand zuzurechnen, wie dies manche getan haben, würde jedoch zu weit gehen.
Am Morgen des 23. Januar 1939 brach sein Freund Gustav Hartmann auf der Suche nach Sindelar die Tür seiner Wohnung in der Annagasse auf. Er fand ihn tot und unbekleidet neben der bewusstlosen Camilla Castagnola, die seit gerade einmal zehn Tagen seine Lebensgefährtin gewesen war. Sie starb später im Krankenhaus. Beide fielen einer durch einen defekten Ofen hervorgerufenen Kohlenmonoxidvergiftung zum Opfer. Zumindest war dies die Darstellung der Polizei, als sie zwei Tage darauf ihre Untersuchungen einstellte. Der Staatsanwalt allerdings war auch sechs Monate später noch zu keinem Ergebnis gekommen. Nichtsdestotrotz befahlen die nationalsozialistischen Behörden, den Fall zu schließen.
In einer 2003 produzierten Dokumentation der BBC behauptete Egon Ulbrich, ein Freund Sindelars, dass ein Kommunalbeamter bestochen worden sei, um den Tod als Unfall zu den Akten zu legen. Dadurch wäre sichergestellt gewesen, dass Sindelar ein Staatsbegräbnis erhielt. Das war nicht der einzige Erklärungsversuch. Am 25. Januar 1939 behauptete ein Artikel in der österreichischen Kronen Zeitung , dass alles darauf hindeute, dass Sindelar Opfer eines Mordes durch Vergiften geworden sei. In seinem Gedicht „Auf den Tod eines Fußballspielers“ äußerte Friedrich Torberg den Verdacht, dass es sich auch um den Selbstmord eines von der „neuen Ordnung“ abgelehnten Mannes gehandelt haben könnte. Später wurde kolportiert, dass Sindelar oder Castagnola oder sogar beide Juden gewesen seien.
Nun stimmt es zwar, dass Sindelar für Austria Wien, den Verein des jüdischen Bürgertums, gespielt hatte. Auch stammte er aus Mähren, von wo aus zahlreiche Juden nach Wien umgesiedelt waren. Seine Familie jedoch war katholisch. Es ist auch gut vorstellbar, dass die Italienerin Castagnola jüdische Wurzeln gehabt haben könnte. Dann allerdings müsste sie diese so gut versteckt haben, dass sie in der Woche vor ihrem Tod trotzdem die Genehmigung erhielt, Miteigentümerin einer Kneipe zu werden. Vielsagend aber ist, dass sich Nachbarn einige Tage zuvor über einen schadhaften Schornstein in dem Mietshaus beschwert hatten.
Die verfügbaren Indizien sprechen dafür, dass es sich bei Sindelars Tod um einen Unfall handelte, und doch überwiegt das Gefühl, dass Helden nicht einfach einen ganz alltäglichen Tod sterben können. Es passt einfach zu gut ins Bild eines jeden romantischen Freidenkers, dass dieser Sportkünstler, dieser Liebling der Wiener Gesellschaft, Seite an Seite mit seiner jüdischen Freundin im Österreich der Nazizeit vergast worden ist. „Der brave Sindelar folgte der Stadt, deren Kind und Stolz er war, in den Tod“, schrieb Polgar in seinem Nachruf. „Er war so verwachsen mit ihr, dass er sterben musste, als sie starb. Aus Treue zur Heimat – alles spricht dafür – hat er sich umgebracht: Denn in der zertretenen, zerbrochenen, zerquälten Stadt leben und Fußball spielen, das hieß, Wien mit einem abscheulichen Gespenst von Wien betrügen. … Aber kann man so Fußball spielen? Und so leben, wenn ein Leben ohne Fußball keines ist?“
Auch an seinem Ende blieb der Kaffeehaus-Fußball heldenhaft romantisch.
KAPITEL 5
Organisiertes Chaos
Die Sowjetunion erlebte erst spät einen Fußballboom. Dann aber machte Fußball dort eine radikale Entwicklung durch, unbeeinflusst von historisch gewachsenen Ansichten über die „richtige“ Art zu spielen. Bereits in den 1860er Jahren hatten britische Seeleute im Hafen von Odessa Fußball gespielt. Eine Beschreibung in der Zeitschrift The Hunter vermittelt einen Eindruck von dem Chaos und der Körperbetontheit des damaligen Spiels. „Es wird von Leuten mit kräftigen Muskeln und starken Beinen gespielt – ein Schwächling wäre in solch einem Gewühl nur Zuschauer“, schrieb der Reporter amüsiert und missbilligend zugleich.
Erst in den 1890er Jahren wurde Fußball allmählich besser organisiert. Wie in so vielen Ländern spielten die Briten dabei eine entscheidende Rolle, zunächst in Sankt Petersburg und später in Moskau. So gründete Harry Charnock, Generaldirektor der Morosow-Textilfabrik, jenen Verein, aus dem später Dynamo Moskau entstehen sollte. Er hoffte, damit seine Arbeiter vom Wodkatrinken abhalten zu können. Auf dem Höhepunkt sowjetischer Mythenbildung hieß es, dass Dynamo Moskau als Vereinsfarben Blau und Weiß gewählt habe, um jene beiden Elemente zu symbolisieren, ohne die der Mensch nicht leben kann: Wasser und Luft. Tatsache ist aber, dass Charnock, der aus Blackburn stammte, sein Team einfach in den Farben seines Lieblingsklubs, der Blackburn Rovers, kleidete.
Die weiter westlich gelegenen Regionen wurden naturgemäß stärker von Mitteleuropa beeinflusst. Als in Lemberg im Rahmen einer Sportartenvorführung des Sportklubs Sokol 1894 das erste Fußballspiel auf heute ukrainischem Boden stattfand, gehörte die Stadt noch zu Österreich-Ungarn.
Die Briten waren längst verschwunden, als 1936 eine nationale Liga geschaffen wurde. Bereits 1908 hatte die Dominanz der Ausländer ein Ende gefunden, als die russische Mannschaft von Sport den Aspeden-Pokal, die Stadtmeisterschaft von Sankt Petersburg, gewann. Die frühe Form des 2-3-5 war auch nach der Änderung der Abseitsregel im Jahr 1925 vorerst die Standardformation geblieben. Da die UdSSR aufgrund der FIFASanktionen fast nur gegen ausländische Amateurmannschaften spielen konnte, fiel zunächst nicht auf, wie groß der Rückstand der Sowjets war.
Читать дальше