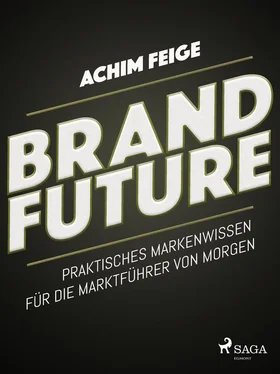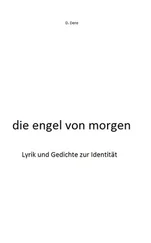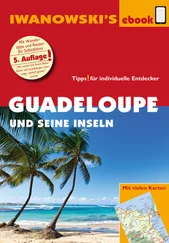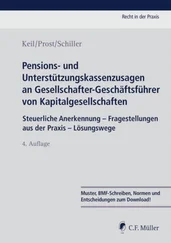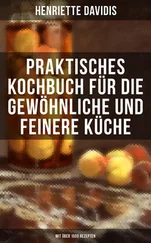Neue Lösungswege, die gleichzeitig Komplexität reduzieren
Diese acht vorgenannten Meilensteine des gesellschaftlichen Wandels und die sich daraus ergebenden Herausforderungen machen klar, dass eine Fortsetzung der bisherigen Vorgehensweise in der Markenführung nicht mehr den gewünschten Erfolg bringen kann und Sie nicht in die Nummer-eins-Position bringt. Denn die alten Methoden der Manipulation, der Massenmedienwerbung, der monologischen Kommunikation, der reinen, subtanzlosen Kreativität, der Imitation der Wettbewerber, der Segmentierungen nach Soziodemografie zielen über kurz oder lang an den wesentlichen Bedürfnissen der Konsumenten und ihrer Mediennutzung vorbei. Wie kann die Antwort lauten?
1. Variante: Übervereinfachung und Regression
Wie vermeidet man in solchen Situationen des Übergangs, der Komplexität und der Unübersichtlichkeit einen Rückzug auf bislang Bewährtes? Man wünscht sich regressiv back to the roots , zurück zu den Wurzeln, und verschanzt sich hinter den alten Faustregeln wie zum Beispiel: «Eine Marke ist eine Marke, weil man sie erkennt», oder sucht Halt in Übervereinfachungen wie keep it strictly simple and stupid. Statt die Waffen zu strecken und gar das Ende des Marketings überhaupt oder ein postmodernes «Alles geht» auszurufen, die Preise zu senken und damit jede Hoffnung auf qualifizierte Markenführung fallen zu lassen, ist es sicher empfehlenswerter, sich dem Wandel zu stellen und neue Lösungswege zu beschreiten. «Man soll die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher», hat Albert Einstein treffend gesagt.
2. Variante: Kompliziertheit und Normierung
Wo sind solch neue Lösungswege und Ansätze zu finden? Man versucht, auf die neue und zunehmende Komplexität in typisch deutscher Manier mit einem Buch zu reagieren, das anhand einer Vielzahl von Paragraphen einzelne Aspekte erfolgreicher Markenführung benennt, ohne konkrete, ganzheitliche und schnelle Lösungswege aufzuzeigen. Man würde auf Komplexität mit Kompliziertheit und Normierung reagieren. Entscheidender Nachteil für die Praxis ist die Tatsache, dass die Normierung den fortwährenden Veränderungsprozess der Rahmenbedingungen überhaupt nicht berücksichtigen kann. Daher gehe ich anders vor.
3. Variante: Die «simplexe» Theorie von BrandFuture
BrandFuture zäumt das Pferd quasi von hinten auf und wählt einen komplexitätswissenschaftlich bewährten Ansatz, um die Komplexität zu reduzieren. Dieser Ansatz erkennt die Komplexität der Markenführung an. Aber er reduziert die Positionierungsoptionen nicht auf vier Dimensionen Preis, Premium, Service und Emotion, wie ich es heute immer noch manchmal erlebe. Gleichzeitig ist er einfach genug anwendbar. Es verschafft eine gefühlte Einfachheit in der Anwendung auf höherer Ordnungsebene und ist daher, neudeutsch, «simplex».
Statt sich bereits am Anfang in unzähligen Einzelheiten zu verlieren, lassen sich unter Rückgriff auf die Evolutionstheorie Gesetzmäßigkeiten für die Markenentwicklung definieren. Indem wir uns dadurch methodisch auf eine höhere Ebene begeben, reduziert sich die Komplexität, ohne aber unzulässig zu vereinfachen. Auf diese Weise können wir uns zunächst über die wesentlichen Erfolgsfaktoren – die sieben Gebote – für ein nachhaltiges Überleben und Gedeihen einer Marke bewusst werden.
Kapitel 2
Sieben Gebote als grundlegende und zeitlose Gesetze für die Markenführung
Die Relevanz der modernen Evolutionstheorie für das Führen von Marken ergibt sich aus der memetischen Definition von Marke, die diese als lebendes System versteht. Ähnlich den Genen wollen sich die Informationsträger einer Marke, die Meme, replizieren. Für die entscheidende Frage, welche Meme beziehungsweise Marken sich im hoch kompetitiven Umfeld langfristig behaupten werden, sind die gleichen Erfolgsfaktoren ausschlaggebend wie im Universalprinzip der Evolution: Fitness und Sexiness. Diesem Prinzip sind alle lebenden Existenzformen von der Bakterie bis zur Marke untergeordnet. Grundlegend für die Bedeutung dieser Prinzipien in der Markenführung ist die evolutionäre Markendefinition.
Für den Begriff «Marke» sind unterschiedlichste Definitionen im Umlauf. Unter der Internetadresse markenlexikon.de finden sich zurzeit denn auch rund fünfzig Ansätze zum Thema Marke und Markenführung. Dies erklärt sich teilweise damit, dass Markenführung eine sehr junge und daher noch «unreife» Kommunikationswissenschaft ist, die deshalb noch unter einer babylonischen Sprach- und Begriffsverwirrung leidet, und es im Übrigen in den Kulturund Geisteswissenschaften per se viele Wahrheiten gibt.
Die einen verstehen unter Marke nur das Logo, das Corporate Design und die Werbung. Die anderen sehen Marke als Verdichtung von rationalem und emotionalem Nutzen, der in kreativen Kampagnen ausgedrückt wird. Andere setzen Marke mit Bekanntheit gleich. Doch was helfen 90 Prozent Bekanntheit, wenn Menschen die Marke nicht haben wollen? Dann ist sie bestenfalls eine «OutBrand».
Historisch betrachtet entstand die Marke, um in erster Linie als Vertrauens- und Qualitätsgarant die Distanz zwischen Hersteller und Endkonsument zu überbrücken. Der Marketing-Guru Philip Kotler meint, eine Marke sei etwas Gekennzeichnetes, «ein Name, Begriff, Zeichen, Symbol, eine Gestaltungsform oder eine Kombination aus diesen Bestandteilen zum Zwecke der Kennzeichnung der Produkte oder Dienstleistungen eines Anbieters oder einer Anbietergruppe und zu ihrer Differenzierung gegenüber Konkurrenzangeboten».
Dies ist aber eine nur auf die kommunikative Oberfläche reduzierte Definition, die der Leistung und Substanz einer Marke nicht gerecht wird. In den 1990er-Jahren kam die Theorie der «fraktalen Marken» auf: Danach sind Marken Einheiten, die sich selbstähnlich verschiedensten Nischen anpassen, ohne ihre übergreifende Identität zu verlieren. Das ist meines Erachtens eine gute Definition, die aber auf Grund ihrer Herkunft aus der System- und Chaostheorie keine Anhänger gefunden hat. Vor kurzem hat sich der Begriff «Love-marks» etabliert, der Marken bezeichnet, zu denen eine tiefe emotionale Bindung der Kunden existiert und die von jenen geliebt werden. Das ist zwar wieder ein Versuch der Vereinfachung, der aber zumindest eine Fangemeinde inbesondere in der Werbeindustrie gefunden hat.
Dauerhaft bewährt hat sich die leistungsbasierte Betrachtung von Hans Domizlaff. Domizlaff formulierte bereits 1939 die «22 Gesetze der natürlichen Markenbildung», die unter anderem eine Marke als verdichteten Ausdruck einer spezifischen Spitzenleistung definieren. Diese Sicht rückt in den Vordergrund, dass Marken vor allem durch Einlösung von Leistungsversprechen und nicht nur durch Kommunikation von Botschaften mittels Werbung entstehen. Je besonderer und einzigartiger eine Leistung ist, desto größer ist die Chance, eine erfolgreiche Marke zu entwickeln. Ausgedrückt wird diese besondere Leistung unter anderem durch stilistische Elemente wie zum Beispiel Farbe, Form, Symbole oder die «One Word Equity», das Wort, das für die Marke steht und mit ihr assoziiert wird. So wird die Marke zu einer charaktervollen, einzigartigen Gestalt mit klarem Markenleistungsvorteil. Es bleibt keine kommunikative Hülle oder nur ein «Zeichen» der Unterscheidung.
Diese These wird von der aktuellen Trusted-Brands-Studie 2007 von Readers Digest gestützt, in der 27 000 Europäer nach ihren vertrauenswürdigsten Marken gefragt wurden. Die zwei entscheidenden Kriterien für vertrauenswürdige Marken sind zum Ersten die Produktqualität (73 Prozent), also die Kernleistung der Marke, und zum Zweiten die persönliche Erfahrung (72 Prozent) mit der Marke. Eine Marke wird also nicht nur, aber nur zum geringen Teil durch die Werbung gemacht!
Читать дальше