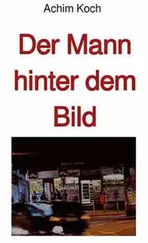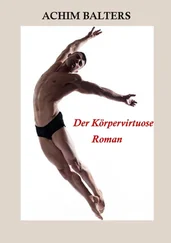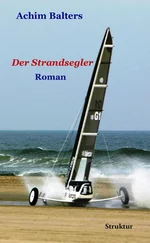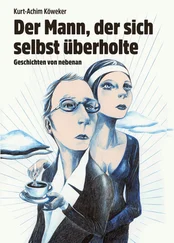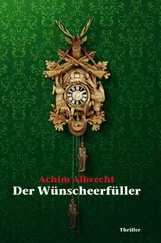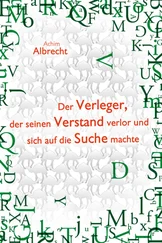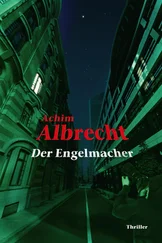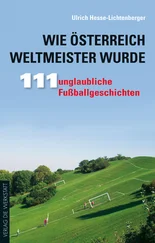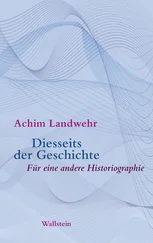Die Erstbesteigung des höchsten Gipfels des Olymps, des Mytikas, erfolgte durch zwei Schweizer Bergsteiger und einen griechischen Führer: Daniel Baud-Bovy, Fred Boissonnas und Christos Kakalos. Sie erreichten den Gipfel am 2. August 1913. 57Ein Jahr später, ohne Kenntnis der Erstbesteigung, erklommen Francis Farquhar und Aristides Phoutrides den dritthöchsten Gipfel Skala und brachten erstmals eine umfangreiche Photodokumentation von ihrem Aufstieg mit. 58
Im Jahr 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde schließlich der Schweizer Geograph Marcel Kurz vom griechischen Ackerbauministerium mit einer exakten topographischen Aufnahme des Olympmassivs betraut. Vier Jahre später publizierte er das Werk »Le Mont Olympe« (1923) mitsamt zwei hervorragenden Karten, die bis heute grundlegend sind (  Abb. 37). 59Das Buch bietet außerdem zahlreiche Photographien, die eine visuelle Vorstellung des Gebirges erlauben. Darüber hinaus ist die Forschungsgeschichte aufgearbeitet. Eines der Fotos zeigt den mittlerweile friedlich gewordenen Räuberhauptmann, der einst Richter entführt hatte.
Abb. 37). 59Das Buch bietet außerdem zahlreiche Photographien, die eine visuelle Vorstellung des Gebirges erlauben. Darüber hinaus ist die Forschungsgeschichte aufgearbeitet. Eines der Fotos zeigt den mittlerweile friedlich gewordenen Räuberhauptmann, der einst Richter entführt hatte.
Das Buch von Kurz aus dem Jahr 1923 und die Arbeit von Heuzey aus dem Jahr 1860 sind bis heute die einzigen wissenschaftlichen Monographien zum Olymp. 60Aus archäologischer Sicht sind nur wenige Studien zu dem Berg erfolgt, ein archäologischer Survey des Gebirges hat noch nicht stattgefunden, und bislang wurden nur wenige archäologische Stätten identifiziert. 61Auch ansonsten haben sich die klassischen Altertumswissenschaften kaum mit dem Berg beschäftigt. 62Eine Studie zur bildlichen Darstellung bzw. zu den Raumvorstellungen des Berges fehlt, obschon es Untersuchungen zu Einzelaspekten wie etwa dem Bild der Götterversammlung gibt. 63Auch die Klassische Philologie und die Alte Geschichte ignorieren den Berg weitgehend. 64In den letzten Jahren sind zwar im Zuge des sogenannten spatial turn, der sich übergreifend mit kulturellen Aspekten von »Räumen« befasst, Berge in der Antike verstärkt ins Interesse der Kulturwissenschaften getreten, doch bleibt der Olymp weiterhin faktisch unbeachtet. 65
Ein nicht unwichtiger Aspekt der Erforschung des Olymps ist die Frage danach, was das Wort »Olympos« überhaupt bedeutet. Der Versuch einer Beantwortung der Frage ist allerdings fruchtlos. Denn die Wortbedeutung des Begriffs Olympos ist ungeklärt. Verschiedene Vorschläge wurden gemacht. So weist der Sprachforscher August Fick den Namen einer »vor-pelasgischen« Sprachstufe zu. 66Diese Herleitung macht es sich einfach, verlagert sie doch die Antwort in eine dunkle mythische Vorzeit. Der Religionswissenschaftler Martin P. Nilsson hält den Namen ebenfalls für vorgriechisch und möchte ihn auf ein ansonsten unbekanntes Wort für »Berg« zurückführen. 67Eine allgemein akzeptierte Deutung des Namens gibt es nicht. 68Bei der Überlegung, dass Olympos eine vorgriechische Bezeichnung für Berg sei, spielt die Verbreitung des Bergnamens in Mittelmeerraum eine Rolle (  Abb. 47). Der Name ist vielerorts für große Berge belegt, 69doch ist gerade die Verbreitung in Gebieten, die nicht im griechischen Kerngebiet liegen, wie etwa Zypern und Lykien, ein Hinweis darauf, dass keine gemeinsame Sprachform vorliegt, sondern dass die Verbreitung des Namens auf die Vorbildfunktion des nordgriechischen Berges zurückgeht, dessen Etymologie weiterhin unsicher bleibt.
Abb. 47). Der Name ist vielerorts für große Berge belegt, 69doch ist gerade die Verbreitung in Gebieten, die nicht im griechischen Kerngebiet liegen, wie etwa Zypern und Lykien, ein Hinweis darauf, dass keine gemeinsame Sprachform vorliegt, sondern dass die Verbreitung des Namens auf die Vorbildfunktion des nordgriechischen Berges zurückgeht, dessen Etymologie weiterhin unsicher bleibt.
Auch die antiken Etymologien des Namens Olympos vermögen keine überzeugenden Erklärungen zu liefern. Ein hellenistischer Text, der fiktiv dem Universalgelehrten Aristoteles zugeschrieben wurde und das byzantinische lexikalische Sammelwerk Etymologicum magnum möchten Olympos von dem griechischen Wort hololampes (»ganz leuchtend«) ableiten und verweisen auf eine Stelle in der Odyssee des Homer, welche den Olymp als strahlend hell beschreibt. 70Leider ist dies keine sprachwissenschaftlich akzeptable Etymologie, sondern eine gelehrte Spielerei mit einem Homerzitat, sodass die Bedeutung des Namens Olympos ungeklärt bleiben muss. 71Auch die mythologische Herleitung des Namens von einem Lehrer des Zeus namens Olympos, von dem Zeus laut dem griechischen Geschichtsschreiber Diodor (1. Jh. v. Chr.) den Beinamen Olympios übernommen habe, 72kann nicht überzeugen und ist wahrscheinlich eine von zwei Varianten der Vorstellung, dass Zeus einen Lehrer namens Olympos gehabt habe. Einen solchen soll es auch auf Kreta gegeben haben, und er wurde von Zeus getötet und bestattet. Auch dabei handelt es sich um eine sekundäre Aitiologie, also eine nachträgliche Erklärung des Namens. 73Dass der Berg nach einem weit hergeholten Beinamen des Zeus benannt wurde, ist eher unwahrscheinlich. Naheliegender ist, dass Zeus seinen Beinamen von dem Berg Olympos bekam, dessen Etymologie im Dunkeln bleibt.
2 Texte: Ambiguität: Der Berg-Himmel
Der Olymp ist in der Vorstellung der Griechen von Beginn der schriftlichen Überlieferung präsent. 1Schon bei Homer findet sich die Vorstellung, dass der Sitz der Götter auf dem Olymp lag. Dabei ist der Olymp als Berg, und zwar als ein konkreter Berg in Thessalien und Makedonien, gedacht. Zugleich können wir eine parallele Vorstellung beobachten. Bei Homer und insbesondere in der Folgezeit löst sich die Vorstellung vom Olymp als eines konkreten Berges in Nordgriechenland, und der Olymp bekommt eine übertragene Bedeutung und wird mit dem Himmel gleichgesetzt. Trotzdem bleibt die Vorstellung des Olymps als eines Berges bestehen, auch wenn diese nicht dominiert. Der Olymp ist also ein Berg-Himmel. Wir werden im Folgenden sehen, dass bereits Homer kein kohärentes, theologisch scharf abgegrenztes Bild des Olymps entwirft, sondern Ambiguität (Doppeldeutigkeit) den Olymp charakterisiert und daraus die panhellenische, gesamtgriechische Attraktivität des Olymps resultiert.
Wie üblich bei der Beschäftigung mit griechisch-römischer Kultur, stellt Homer den Ausgangspunkt dar. Das griechische Pantheon, die Welt der Götter und ihre Zuordnungen, wurde von Homer im späten 8. Jh. v. Chr. fixiert und geprägt. Der griechische Historiker Herodot schreibt im 5. Jh. v. Chr. in seinen Historien Folgendes über die griechische Götterwelt:
»Aber woher jeder einzelne Gott stammte oder ob sie schon immer alle da waren, wie sie aussahen, das wußten die Griechen sozusagen bis gestern und vorgestern nicht. Hesiod und Homer haben meiner Meinung nach etwa 400 Jahre vor mir gelebt, aber nicht mehr. Sie haben den Stammbaum der Götter in Griechenland aufgestellt und ihnen ihre Beinamen gegeben, die Ämter und Ehren unter sie verteilt und ihre Gestalt klargemacht. Die Dichter, die vor diesen Männern gelebt haben sollen, kamen meiner Meinung nach erst später.« (Hdt. 2,53) (Übersetzung: Josef Feix)
Soweit Herodot, der formuliert, wie sehr die von Homer und Hesiod überlieferten Vorstellungen prägend für das griechische Pantheon waren. 2Wir wenden uns damit dem zu, was Homer über den Olymp schreibt.
Als expliziten Beleg dafür, dass der Olymp von Homer als Berg, und zwar als ein konkreter Berg in Nordgriechenland, aufgefasst wurde, kann man eine Stelle aus seinem Epos Odyssee nehmen. Darin wird berichtet, dass Otos und Ephialtes, zwei aufrührerische Söhne des Meeresgotts Poseidon, den Olymp stürmen und die unsterblichen Götter angreifen wollten: 3
»Die drohten sogar den Unsterblichen auf den Olymp zu tragen,
das Getümmel des vieltobenden Kriegs,
und strebten, den Ossa auf den Olymp zu setzen und auf den Ossa
den blätterschüttelnden Pelion, damit der Himmel ersteigbar wäre,
Читать дальше
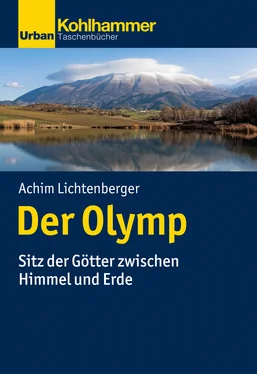
 Abb. 37). 59Das Buch bietet außerdem zahlreiche Photographien, die eine visuelle Vorstellung des Gebirges erlauben. Darüber hinaus ist die Forschungsgeschichte aufgearbeitet. Eines der Fotos zeigt den mittlerweile friedlich gewordenen Räuberhauptmann, der einst Richter entführt hatte.
Abb. 37). 59Das Buch bietet außerdem zahlreiche Photographien, die eine visuelle Vorstellung des Gebirges erlauben. Darüber hinaus ist die Forschungsgeschichte aufgearbeitet. Eines der Fotos zeigt den mittlerweile friedlich gewordenen Räuberhauptmann, der einst Richter entführt hatte.