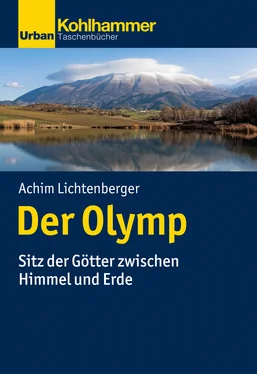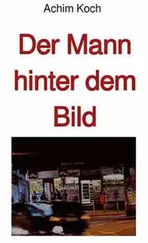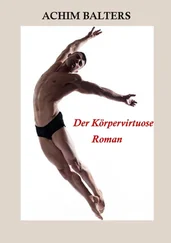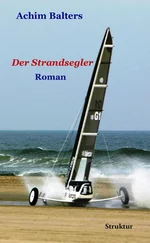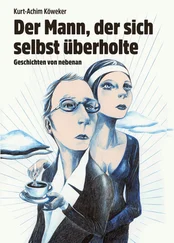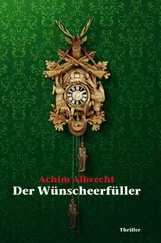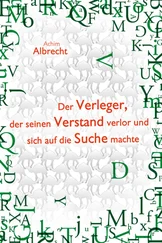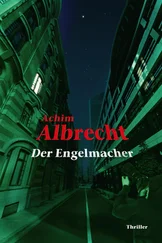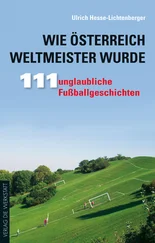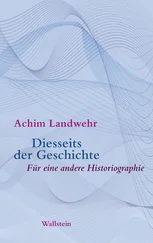Dies ist eine bemerkenswerte Charakterisierung, die möglicherweise auf die tatsächliche Beobachtung und Anschauung der Wolken in den Gipfeln des Olymps zurückzuführen ist. Allerdings bedeutet das noch nicht zwingend eine Gleichsetzung von Himmel und Olymp, denn der Himmel scheint den Olymp zu umgeben, so auch in einer anderen Stelle der Ilias:
»wenn vom Olympos eine Wolke zieht in den Himmel
aus dem Äther, dem göttlichen, wenn Zeus einen Sturmwind ausspannt.« (Hom. Il. 16,364–365)
Eine Rede des Zeusbruders Poseidon kann als weiteres Zeugnis für eine solche Vorstellung herangezogen werden, wenn er sagt:
»Denn drei Brüder sind wir von Kronos her, die Rheia geboren:
Zeus und ich und als dritter Hades, der über die Unteren Herr ist.
Dreifach ist alles geteilt, und jeder erhielt seinen Teil an Ehre.
Ja, da erlangte ich, das graue Meer zu bewohnen immer,
als wir losten, und Hades erlangte das neblige Dunkel,
Zeus aber erlangte den Himmel, den breiten, in Äther und Wolken.
Die Erde aber ist noch allen gemeinsam und der große Olympos.« (Hom. Il. 15,187–193)
Auch bei der bereits besprochenen dramatischen Episode mit der Auftürmung der Berge Pelion, Ossa und Olymp durch Otos und Ephialtes, um den Himmel zu erstürmen, wird eine Unterscheidung zwischen Himmel und Olymp deutlich. 22
Insbesondere in den letzten beiden zitierten Passagen der Ilias wird zwischen Olymp, einer Zwischenschicht »Äther« und dem Himmel unterschieden, wobei der Olymp, wie auch aus anderen Textzeugnissen Homers deutlich wird, in den »Äther« hereinragt und der »Äther« wiederum in den Himmel. Unterhalb von »Äther« und Olymp ist die Luft (aer). 23
Dann wieder gibt es Texte, bei denen Olymp und Himmel mehr oder weniger gleichgesetzt erscheinen, so etwa in der Ilias:
»Und sie stiegen heraus auf das Ufer und schwangen sich in den Himmel
und fanden den weitumblickenden Kroniden, und um ihn saßen die anderen
alle versammelt, die seligen Götter, die immer seienden.
Und sie (Thetis) setzte sich neben Zeus, den Vater, und Platz machte ihr Athene.
Und Here legte ihr einen goldenen schönen Becher in die Hand
und erfreute sie mit Worten, und Thetis trank und reichte ihn zurück.
Und ihnen begann die Reden der Vater der Männer und der Götter:
›Gekommen bist du zum Olympos, Göttin Thetis (…)‹.« (Hom. Il. 24,97–104)
Hier scheint eine Gleichsetzung oder zumindest ein sehr enges Beieinander von Olymp und Himmel vorzuliegen.
Das Verhältnis zwischen Himmel und Olymp bleibt diffus, und auch eine andere Stelle zeigt dies. Am Beginn des achten Gesangs der Ilias fordert Zeus die anderen Götter zum Seilziehen heraus, um seine Autorität zu sichern. Derjenige, der sich gegen ihn stelle, habe keine Chance: 24
»›Dann wird er erkennen, wieweit ich der Stärkste bin von den Göttern allen!
Wenn aber – auf! Versucht es, Götter! Daß ihr alle es wißt:
Hängt ein Seil, ein goldenes, auf, herab vom Himmel,
und alle faßt an, ihr Götter, und alle Göttinnen!
Doch werdet ihr nicht vom Himmel auf den Boden niederziehen
Zeus, den höchsten Ratgeber, auch nicht, wenn ihr noch so sehr euch mühtet.
Doch sobald auch ich dann im Ernste ziehen wollte:
Mitsamt der Erde zöge ich euch hinauf und mitsamt dem Meer;
und das Seil bände ich dann um die Spitze des Olympos,
und in der Schwebe hinge dann das alles.
Soweit bin ich überlegen den Göttern, überlegen den Menschen!‹
So sprach er, und die waren alle stumm in Schweigen,
von dem Wort betroffen, denn sehr gewaltig hatte er gesprochen.« (Hom. Il. 8, 17–29)
Diese Episode unterstreicht in eindrücklicher Weise die Zwischenstellung des Olymps zwischen Himmel und Erde. Wir sehen also, dass es in den homerischen Epen ein Nebeneinander von Vorstellungen gibt, die einerseits den thessalisch-makedonischen Berg Olymp als Sitz der Götter identifizieren. Andererseits gibt es auch ein universalistisches Verständnis, welches den Olymp in einen weit entfernten, überirdischen, himmlischen Raum versetzt. Diese Ambiguität des Olymps, die bereits bei Homer angelegt ist, ist prägend für die nachfolgenden Jahrhunderte griechisch-römischer Kulturgeschichte. Gerade weil Homer keine Klarheit herstellt, müssen wir davon ausgehen, dass die Ambiguität widerspruchsfrei ausgehalten wurde. 25Es ist wohl gerade diese Universalisierung des nordgriechischen Berges, die eine Integration des Göttersitzes in lokale griechische Götterwelten ermöglichte, und so den Olymp zu einem Bezugspunkt machte, der jenseits der Lokalität des nordgriechischen Berges lag. 26Nun wenden wir uns den Textstellen zu, die uns etwas mehr darüber mitteilen, wie man sich den Göttersitz bzw. die Göttersitze auf dem Olymp vorzustellen hat.
Aus dem vorangegangenen ist deutlich geworden, dass der Olymp der Göttersitz war und die Götter hier wohnten. 27Weitere Homerstellen verfestigen dieses Bild. So gibt es zahlreiche Stellen, in denen der Olymp explizit als athanaton hedos, als »Sitz der Unsterblichen« bezeichnet wird. 28Konkretisiert wird dieses Bild des Sitzes durch Erwähnungen, dass die Götter dort auf dem Olymp ihre domata (Häuser) haben. 29
Besonders lebendig wird die Vorstellung von dem Leben in den Häusern auf dem Olymp am Ende des ersten Gesangs der Ilias, wo es um einen Streit während einer Götterversammlung im Zeuspalast auf dem Olymp geht. Gerade hat sich Hera, die Gattin des Zeus, für die Trojaner eingesetzt, als es zu einem finalen Machtwort des Göttervaters kommt. Dieser hat keine Lust mehr, mit seiner Frau weiter verbal zu händeln, und droht ihr eheliche Gewalt an: 30
»Da antwortete und sagte zu ihr der Wolkensammler Zeus:
›Unbändige! Immer mußt du ›denken‹, und ich kann dir nicht entgehen!
Ausrichten aber kannst du dennoch nichts, und immer nur ferner
Wirst du meinem Herzen, und das wird dir noch schrecklich sein!
Doch wenn dieses so ist, so wird es mir eben so lieb sein!
Aber setz dich nieder in Schweigen und gehorche meinem Wort!
Kaum werden dir sonst helfen, so viele da Götter sind im Olympos,
Wenn ich dir nahe komme und die unberührbaren Hände an dich lege!‹
So sprach er. Da fürchtete sich die Kuhäugige, die Herrin Here,
Und sie setzte sich schweigend nieder und bändigte ihr Herz.
Und aufgebracht waren im Haus des Zeus die Götter, die Uranionen.
Doch unter ihnen begann Hephaistos, der kunstberühmte, mit den Reden,
Seiner Mutter zu Gefallen, der weißarmigen Here:
›Wirklich! Heillose Dinge sind das und nicht mehr erträglich!
Wenn ihr zwei der Sterblichen wegen derart streitet
Und vor den Göttern ein Gezänk aufführt! Und gar keine Freude
Wird mehr sein an dem guten Mahl, wenn das Gemeinere obsiegt!
Der Mutter rede ich zu, wenn sie es auch selbst erkennt,
Unserem Vater zu Gefallen zu sein, dem Zeus, daß nicht wieder
Der Vater streite und uns das Mahl zusammenwerfe.
Denn ist er gewillt, der Olympier, der blitzeschleudernde,
Uns von den Sitzen zu stoßen – er ist ja der bei weitem Stärkste.
Aber gehe du ihn an mit freundlichen Worten!
Gleich wird uns dann der Olympier wieder gnädig sein!‹
So sprach er und sprang auf, und den doppelt gebuchteten Becher
Legte er seiner Mutter in die Hände und sagte zu ihr:
›Ertrage es, meine Mutter! Und halte an dich, wenn auch bekümmert!
Daß ich dich nicht, so lieb du mir bist, vor meinen Augen
Geschlagen sehe. Dann könnte ich dir, so bekümmert ich bin,
Nicht helfen. Denn schwer ist es, dem Olympier entgegenzutreten!
Denn auch ein andermal schon, als ich dir beizustehen suchte,
Ergriff er mich am Fuß und warf mich von der göttlichen Schwelle.
Читать дальше