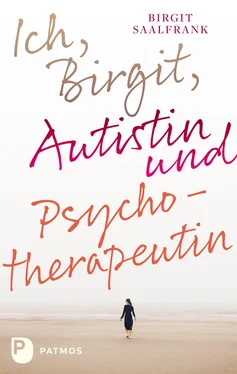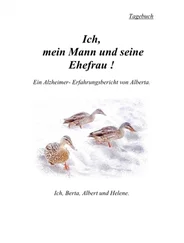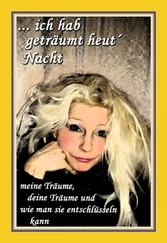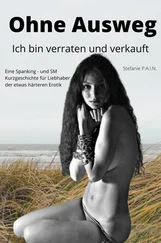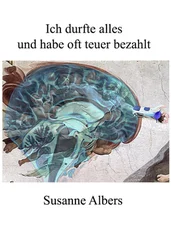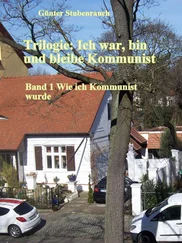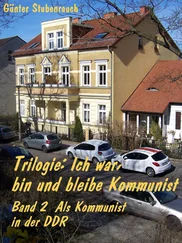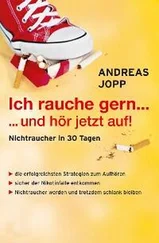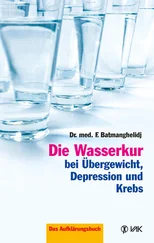Vor jedem Training erhielten wir von Heiko einen Plan, was wir an diesem Tag trainieren sollten. Wenn ich meine Serie sah, die ich springen sollte, hatte ich große Angst. Gleichzeitig wusste ich, dass ich sie bald gesprungen haben würde. In dieser Zeit litt ich sehr stark unter den genannten Selbstentfremdungsgefühlen beim Springen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es in meiner Macht liegt, die Sprünge zu steuern, sondern dass mein Körper das irgendwie alleine ohne mich hinbekommen muss.
Kürzlich schaute ich abends einen Livestream der Trampolin-Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Der Reporter unterhielt sich mit einem Fachmann und plötzlich fiel der Ausdruck »Lost move syndrome (LMS)«. Ich wurde hellhörig und recherchierte im Internet, was damit gemeint war. Dort stieß ich auf einen Fachartikel aus dem Jahr 2015 von Jenn Bennett und anderen Forschern über LMS. Es tritt demzufolge vorzugsweise bei Sportlern aus dem artistischen Formenkreis (Kunstturnen, Wasserspringen, Trampolinspringen) auf. Ganz plötzlich verlieren erfahrene Sportler die Fähigkeit, ein bestimmtes automatisiertes Bewegungsmuster auszuführen, zum Beispiel eine Salto- oder Schraubendrehung. Diese Unfähigkeit hat emotionale, kognitive und andere schwerwiegende Folgen. Der Betroffene hat eine ausgeprägte Angst vor der Übungssequenz, auch Ärger, Frustration und Ohnmachtsgefühle kommen vor. Er kann sich im Geist nicht mehr vorstellen, wie man zum Beispiel einen bestimmten Sprung absolviert. Wenn er daran denkt, visualisiert er nur missglückte Sprünge. Beschrieben wird auch das Gefühl, dass jemand anderes als man selbst die Kontrolle über den Sprung hat. Zudem haben die Betroffenen kein Gefühl mehr für die Lage des eigenen Körpers im Raum. Negative Gedanken kreisen im Kopf und können zu Schlafstörungen führen. Der erlebte Vertrauensverlust in sich selbst kann ausgeprägte Selbstzweifel zur Folge haben. Viele betroffene Athleten müssen ihren Sport deswegen aufgeben.
All das kam mir so bekannt vor! Zum ersten Mal nach fast dreißig Jahren fand ich in diesem Artikel eine Beschreibung der Zustände, die ich selbst so schmerzlich und angstvoll beim Wasserspringen erlebt hatte. Das kannten also auch andere. Und es gab sogar eine Bezeichnung dafür!
Als ich siebzehn Jahre alt war, bekam unsere Springergruppe für mehrere Wochen Besuch von Springern aus den USA. Mit diesen zusammen fuhren wir zu einem Lehrgang nach Italien. Trotz meiner Ängste, meiner Schwierigkeiten bezüglich der Orientierung im Raum und meiner wiederkehrenden Depersonalisationserlebnisse trainierte ich – mal besser mal schlechter – weiter meine Sprünge.
Wir sprangen im Freibad von Villafranca in Lunigiana in der Toskana, besichtigten aber auch den schiefen Turm von Pisa und die Marmorsteinbrüche von Carrara. In dieser Zeit in Italien war ich teilweise sehr aufgekratzt und gab mich kontaktfreudig und extravertiert. Aus meiner heutigen Sicht befand ich mich damals sehr in meinem »falschen Selbst« – ein Ausdruck, den Alice Miller in ihrem Buch »Das Drama des begabten Kindes« beschreibt. Für mich bedeutete das: Meine Mutter hatte mir immer gesagt, dass es wichtig sei, dass man lustig und fröhlich sei und die anderen Menschen durch interessante Erzählungen mitreißen und dadurch Interesse für sich wecken müsse. Das tat ich nun in Italien. Kurz danach fuhr ich mit meinen Eltern und meiner Schwester für drei Wochen nach Österreich zum Wandern. Während des Urlaubs gab es regelmäßig Streit in der Familie. Ich war gereizt und dachte häufig ängstlich an meine Sprünge beim Training. Im Freibad unseres Urlaubsorts übte ich gelegentlich Salto vorwärts vom Beckenrand. Ich hatte Angst, dass ich das Gefühl für das Springen noch mehr verlieren würde, als es ohnehin schon der Fall war, wenn ich jetzt nicht dranblieb mit Üben. Meine Unbeschwertheit war komplett verschwunden. Während ich den Kreta-Urlaub im Jahr zuvor noch sehr genossen hatte, ging es mir inzwischen psychisch deutlich schlechter.
An einem Tag ging ich alleine auf einen Flohmarkt und fand dort zufällig ein Buch über Schizophrenie. Ich hatte Angst, es zu kaufen, fürchtete, dass mich jemand dabei entdecken könnte, den ich kannte. Schließlich kaufte ich es trotzdem. Tief in meinem Inneren war ich überzeugt, dass ich psychisch sehr krank war, aber meine Umwelt erfolgreich darüber hinwegtäuschte. Dieses Buch habe ich jedoch nie gelesen. Da ich keine Erklärungen für meine Entfremdungsgefühle hatte, befürchtete ich, an Schizophrenie zu leiden. Ich hatte solche Angst davor, mich in den Schilderungen des Buches wiederzuerkennen und meinen Verdacht bestätigt zu sehen!
In der Schule hatte ich schon lange das Gefühl, jeden Tag auf extrem anstrengende Art und Weise neu beginnen zu müssen, ohne auf meine bisherigen sozialen Fähigkeiten zurückgreifen zu können. Wenn ich in der ersten Stunde im Unterricht saß, fühlte es sich so an, als ob es eine unsichtbare Mauer zwischen mir auf der einen Seite und den anderen Schülern und dem Lehrer auf der anderen Seite gäbe. Meine Sprache war in meinem Körper gefangen, ich konnte sie nicht herauslassen, denn sie wäre an dieser Mauer nach innen auf mich zurückgeworfen worden, ohne dass die anderen Menschen meine Worte hätten hören können. Trotzdem zwang ich mich täglich zum Sprechen im Unterricht, da ich auch mündlich die Noten haben wollte, die meinem schulischen Leistungsstand entsprachen. Die ersten Worte, die ich mich dann jeden neuen Tag im Unterricht sagen hörte, fühlten sich immer völlig selbstentfremdet an. Ich hörte mich selbst wie von außen, hatte dabei nicht das Gefühl, dass die Worte aus meinem eigenen Körper kamen. Mithilfe dieser ersten Sätze, die ich unter jeweils großer Kraftanstrengung aus mir herausbrachte, gelang es mir jedoch, die unsichtbare Mauer immer wieder zu durchbrechen. In den folgenden Stunden konnte ich mich im Unterricht mündlich beteiligen und war zuweilen sogar recht redselig – bis zum nächsten Tag, da ging alles wieder von vorne los.
Der siebzehnte Geburtstag war der schlimmste überhaupt. Ich wusste nicht, wen ich einladen sollte, denn innerhalb der Springergruppe feierte man nicht zusammen Geburtstag. Gleichzeitig dachte ich, dass ich das endlich einmal tun sollte, und lud deshalb meine ganze Klasse zu mir ein. Es kam aber nur ein Junge. Ich schämte mich entsetzlich und versuchte gleichzeitig, mir das nicht anmerken zu lassen – zeig niemals, dass du verletzlich bist!
Ich erinnere mich auch, dass ich in meiner Jugendzeit darauf hoffte, bald mein eigenes Leben zu beginnen, um dann endlich eine Psychotherapie machen zu können. Während ich noch zu Hause wohnte, kam das für mich nicht infrage, denn dann hätte ich vor meinen Eltern zugeben müssen, dass es mir nicht gut ging, und ihr Bild ihrer kompetenten Tochter wäre zusammengebrochen.
In unserer Familie herrschte vor allem bezogen auf die Bewertung durch meine Mutter eine Art Rollenverteilung. Ich war in ihren Augen diejenige, bei der alles glattlief, die mit dem Leben und der Schule bestens und ohne jegliche Hilfestellung zurechtkam. Meine Schwester wurde von meiner Mutter konstant als »Problemkind« betrachtet, was ich nicht nachvollziehen konnte. Oftmals wehrte ich mich gegen diese Zuschreibungen, aber es hatte keinen Zweck. Ich blieb festgelegt auf diese hochfunktionale Rolle, in der ich mich nicht wiederfand und nicht in meiner wahren Persönlichkeit gesehen fühlte. Ich wusste, dass ich Hilfe benötigte, aber ich kam nicht auf die Idee, sie in der Gegenwart zu suchen, d. h. mir aktuell ein professionelles Gegenüber zum Reden zu suchen. Ich wagte auch nicht, mit anderen über diese bedrohlichen Themen zu sprechen. Sie mussten mich für völlig verrückt halten, wenn sie davon erfahren würden. Ich hatte Angst vor der Psychiatrie und davor, einem professionellen Helfer gegenüberzusitzen, der dann sehen würde, wie extrem krank ich wirklich war, und der mich dann vielleicht in die Psychiatrie einweisen würde. Zudem dachte ich: Wenn ich erzähle, wie es mir wirklich geht, werde ich völlig verrückt. Indem ich diese bedrohlichen Gefühle und Gedanken für mich behielt, hatte ich sie einigermaßen unter Kontrolle. Solange ich sie nicht aussprach oder aufschrieb, existierten sie nicht.
Читать дальше