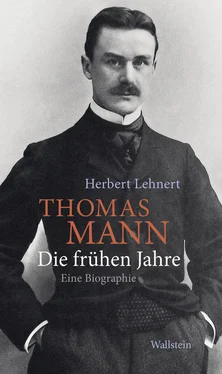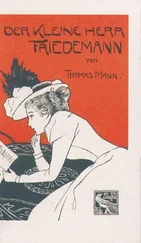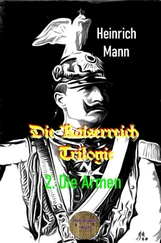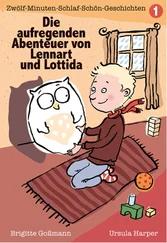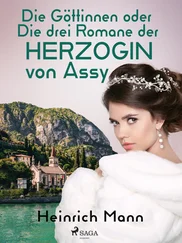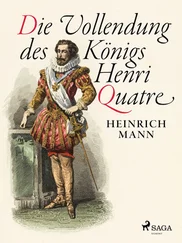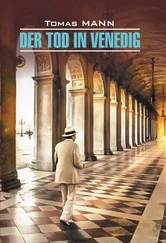1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Obwohl für Ärzte und Juristen bestimmt, die sich mit sexuellen Anomalien befassten, wurde Krafft-Ebings Werk als Aufklärungsbuch gelesen. Krafft-Ebing nennt die Homosexualität »conträre Sexualempfindung« und behandelt sie in allen Auflagen, ausgenommen der letzten von 1902, als Krankheit. Er hatte, was in Wahrheit nur soziale Vorurteile seiner Zeit waren, zu physiologischen Bedingungen erklärt, darunter die sexuelle Passivität der Frau,[70] oder, dass »eine sozialen sittlichen Interessen dienende sexuelle Stellung des Weibes nur als Ehefrau denkbar« sei.[71] Zugutezuhalten ist ihm jedoch, dass er – der herrschenden Meinung entgegen – dafür eintrat, dass Homosexualität angeboren sei und darum nicht strafbar sein dürfe. Allerdings verstand er die Sexualität als nur der Fortpflanzung dienend und bestand darum lange darauf, auch die angeborene Homosexualität als eine krankhafte Anomalie anzusehen. Erst in der 12. Auflage, die nach seinem Tod 1902 erschien, hörte Krafft-Ebing auf, die Homosexualität als Krankheit zu erklären. Er hielt »erworbene« Homosexualität für möglich und für heilbar, wenn der Patient nicht entschieden gegen weibliche Sexualität abgeneigt war.
Großen psychischen Schaden muss unter Homosexuellen damals eine Überzeugung Krafft-Ebings angerichtet haben, die er mit der damaligen Medizin teilte: Masturbation könne »Neurasthenie« zur Folge haben, und diese könne Homosexualität hervorrufen.[72] Das musste bei jungen Männern mit homosexuellen Trieben Schuldgefühle erwecken und Selbstverachtung zur Folge haben.[73] Durch Einfluss von Homosexuellen erworbene Homosexualität hielt Krafft-Ebing für behandelbar. Er empfiehlt Willensakte, Verhaltenstherapie und, mit zögernder Vorsicht, suggestive Hypnose, als Mittel, den »conträren« Trieb zurückzudrängen. Folgen der Krafft-Ebing-Lektüre und des allgemein herrschenden Mangels an Wissen über die menschliche Geschlechtlichkeit zeichnen sich in den viel späteren Tagebüchern Thomas Manns ab. Dort verzeichnet Thomas Mann »Pollutionen« und auto-erotische Handlungen mit Ärger und Selbstkritik, vermutlich aus Angst vor den von Krafft-Ebing behaupteten Folgen.[74]
Krafft-Ebing zitiert und erwähnt mehrfach das Buch von Albert Moll, Die conträre Sexualempfindung (1891),[75] das er mit einem Vorwort versehen hatte und das mehrere Auflagen erlebte. Moll behandelte Probleme der Psychiatrie in Die Zukunft ,[76] einige seiner Artikel in dieser Zeitschrift handelten von Forschungen zur Hypnose,[77] über die er auch Bücher veröffentlichte. Die verschiedenen Phänomene der »conträren Sexualempfindung«, auch die psychischen, beschreibt er sachlich. Verweiblichung komme vor, sei aber nicht die Regel. Moll hält Homosexualität in den allermeisten Fällen für angeboren, wenn er sie auch, wie Krafft-Ebing, für eine krankhafte Perversion erklärt. Homosexualität entstehe aus einer Degeneration des Nervensystems.[78] Er sagt aber auch, Homosexuelle seien keine »entnervte Gruppe«, es gebe kräftige und gesund aussehende Menschen unter ihnen,[79] Homosexualität komme häufiger in der »besseren Gesellschaftsklasse« vor, weil es dort mehr nervöse Veranlagung gebe.[80] Moll schreibt auch, dass es Homosexuelle gebe, deren Liebe sich nur psychisch äußere.[81] Er argumentiert gegen die üblichen Vorurteile, tritt dafür ein, »widernatürliche Unzucht« nicht mehr zu bestrafen und führt berühmte Männer an, die wahrscheinlich homosexuell waren: Michelangelo, Shakespeare, Winckelmann, Prinz Heinrich von Preußen, Platen und Ludwig II. von Bayern. Moll bestreitet die Gerüchte über die Homosexualität Friedrichs II. von Preußen. Obwohl er eine Therapie für wenig aussichtsreich hält, will er ihre Möglichkeit nicht ganz ausschließen. Für relativ erfolgversprechend hält er sie im Fall der Bisexualität, die er »Hermaphrodisie« nennt.[82]
In München behandelte Dr. Albert Freiherr von Schrenck-Notzing Homosexuelle, geleitet von der Annahme, dass die Homosexualität eine krankhafte Störung sei, die in der frühen Jugend eine Ursache habe und durch Hypnose zu heilen sei. Schrenck-Notzing verfasste die Monographie Die Suggestions-Therapie bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes. Mit besonderer Berücksichtigung der conträren Sexualempfindung (1892). Er hatte schon 1888 einen Homosexuellen durch Hypnose dahin gebracht, dass er in einem Bordell einen normalen Coitus vollzog.[83] Vermutlich war der Geheilte bisexuell. Seitdem behandelte Schrenck-Notzing Homosexuelle in seiner Münchener Praxis und beschrieb Erfolge in einem Buch.[84] Durch Experimente mit Hypnosen, die in metaphysische und parapsychologische Bereiche vordringen wollten, machte er von sich reden. Thomas Mann muss von ihm gewusst haben. Er notierte sich seine Adresse erst nach Januar 1899 in Notizbuch 3 (Nb.I, 167).[85] In den zwanziger Jahren nahm er an Schrenck-Notzings Experimenten teil. Thomas Manns Pläne zu einem Berlin-Aufenthalt im August 1895 könnten eine mögliche Konsultation Albert Molls vorgesehen haben. Die erhaltenen Briefe an Otto Grautoff lassen allerdings eher den Schluss zu, dass Thomas Mann sich entschieden hatte, mit seiner Bisexualität zu leben. Er fuhr damals nicht nach Berlin.
Die Briefe an Otto Grautoff I
Eine allzumenschliche Seite des angehenden Schriftstellers Thomas Mann lernen wir kennen in seinen Briefen an den Lübecker Schulfreund Otto Grautoff. Im Lebensabriss von 1930 charakterisierte Thomas Mann die Beziehung zu diesem Freund, auf die Schulzeit zurückblickend, so:
Fast während der ganzen Dauer dieser stockenden und unerfreulichen Laufbahn verband mich mit dem Sohn eines fallierten und verstorbenen Buchhändlers eine Freundschaft, die sich in phantastischem und galgenhumoristischem Spott und Hohn über »das Ganze«, namentlich aber über die »Anstalt« und ihre Beamten bewährte.[86]
Die Freundschaft hielt mehr als zehn Jahre über die Schulzeit hinaus und manifestierte sich in Form eines Briefwechsels, von dem nur Thomas Manns Handschriften erhalten sind; sie beginnen im September 1894. Es ist nicht der gesamte Briefwechsel erhalten, einige der Briefe liegen nur zerrissen oder in miserablem Zustand vor.[87] Was erhalten ist, ist unentbehrlich für unser Verständnis von Thomas Mann.
Grautoff war ein Jahr jünger als sein Freund und lange sein Mitschüler. Er kam aus einer gut-bürgerlichen, aber verarmten Familie. Ein Großvater war Bibliotheksdirektor. Grautoff wollte Schriftsteller werden; seine Familie besorgte ihm eine Lehrstelle in einer Buchhandlung in Brandenburg an der Havel. Grautoff hatte im April 1894 diese Lehre begonnen und litt unter seiner eingeschränkten Existenz als armer Lehrling im provinziellen Brandenburg. Thomas Mann dagegen war seine Lehre losgeworden, hatte die Erzählung Gefallen geschrieben, die im November veröffentlicht werden sollte und erfreute sich seiner Freiheit.
Obwohl Thomas Mann während des letzten Schuljahres die Freundschaft eines Grafen Vitzthum und einiger anderer Mitschüler vorgezogen und die mit Grautoff vernachlässigt hatte (21, 49), hielt dieser an der Beziehung fest und suchte Rat und Hilfe von Thomas Mann. Auch er wollte schreiben, wollte die Lehre in Brandenburg aufgeben, nach Berlin ziehen und sich dort durch freie Mitarbeit in Zeitungsredaktionen über Wasser halten. In seinem ersten erhaltenen Brief vom September 1894 rechnete Thomas Mann dem Freund realistisch vor, dass er in Berlin mit den geringen Mitteln, die er von seiner Familie bekam, nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten könne. Im folgenden Brief vom 22. September spottet er über eine andere Idee Grautoffs, der ihm verkündet hatte, zur Bühne gehen zu wollen. Als »Antrittsrolle« empfiehlt Thomas Mann dem Freund, zwischen Romeo und Julia zu wählen. Nach einer nicht mehr leserlichen, bewusst getilgten Passage heißt es weiter: »und würdest durch wahres Empfinden eine unsägliche Wirkung erzielen, etwa bei den Worten: ›Komm, Nacht … […]‹«. Thomas Mann zitiert aus der deutschen Übersetzung des Monologs der Julia, in Shakespeares Romeo und Julia , dritter Akt, zweite Szene, in der Julia ihr Liebesverlangen ausspricht. Julia sehe nichts als Unschuld in inniger Liebe Tun. Diese Worte unterstreicht Thomas Mann und fügt hinzu: »Verzeih, wenn ich neckisch wurde« (21, 29). Wer den Text des Briefes verstümmelt hat, wollte etwas Peinliches verbergen. Das »Tun in inniger Liebe« im Monolog der Julia ist der Vollzug ihrer heimlichen Ehe. Vermutlich hat Grautoff während der Gespräche in Lübeck über beider homoerotische Sehnsüchte oder in einem seiner Briefe erklärt, dass er seinen Freund Thomas liebe. Ein solches Geständnis würde Thomas’ Gefühl der Überlegenheit gegenüber Grautoff erklären. Auf Thomas Manns Spott muss Grautoff empfindlich und zornig reagiert haben. Thomas schreibt im nächsten Brief, er habe von seinem Freund »wuchtige Schläge« erhalten, dabei habe er nur »Spott und Ulk« ausdrücken wollen (TM / OG, 9). Die Freunde nannten eine satirisch übertreibende Sprache, die es mit der Wahrheit nicht allzu genau nahm, »gippern« (21, 28).
Читать дальше