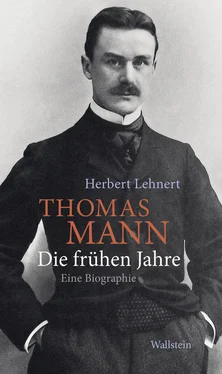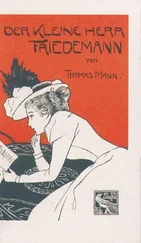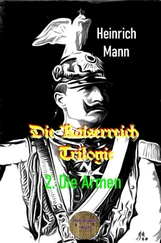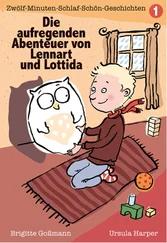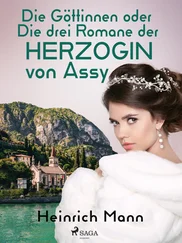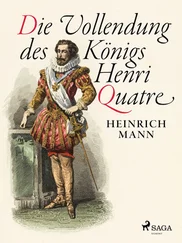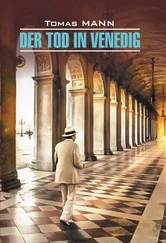Die Welt-Skepsis Schopenhauers und die Idee der zwecklosen, freien Kunst als Erlösung von den Verstrickungen der Welt hat lange auf Thomas Mann und auf sein Schreiben gewirkt. In Betrachtungen eines Unpolitischen nennt er ›Erotik‹ das tiefste Wesen der Metaphysik Schopenhauers (13.I, 79), weil er als Philosoph den ›Willen‹ als den Weltgrund erkennen wollte, als Kants ›Ding an sich‹. Dieser Weltgrund sollte aber nicht fassbar und nicht als Objekt begreiflich, und doch im Bewusstsein der Menschen spürbar sein – vor allem in der Erotik, der geschlechtlichen Begierde.
Auch das Interesse für Nietzsches Philosophie teilte Heinrich mit dem Bruder. Thomas’ Essay Heinrich Heine, der »Gute« in Der Frühlingssturm! zeugt schon 1893 von einer ersten Kenntnis Nietzsches zu der Zeit in Lübeck, als Thomas engen Kontakt zu Heinrich pflegte. 1894 notiert sich Thomas Mann in einem Notizbuch Passagen aus Nietzsches Jenseits von Gut und Böse (Nb.I, 33 f., 36 f.). Um die Jahreswende 1894 /95 merkt er sich zur Anschaffung vor: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik , Unzeitgemäße Betrachtungen , Menschliches, Allzumenschliches, Morgenröthe und Fröhliche Wissenschaft (Nb.I, 50). Der Band 8 der Großoktavausgabe von Nietzsches Werken in Thomas Manns Nachlassbibliothek hat den Besitzervermerk »Thomas Mann 1895« und enthält Der Fall Wagner , Götzendämmerung , Nietzsche contra Wagner , Der Antichrist und sämtliche Gedichte. 1896 legt der junge Thomas Mann Morgenröthe und Die fröhliche Wissenschaft dazu. Der Band 7, mit Jenseits von Gut und Böse und Zur Genealogie der Moral erschien erst 1899, aber Heinrich Heine, der »Gute« und ein ungenaues Zitat in einem Brief an Otto Grautoff vom 17. Februar 1896 (21,72; vgl. KSA 5, 352) beweisen, dass er wenigstens Teile von Zur Genealogie der Moral schon vorher kannte, vermutlich aus Heinrichs Bibliothek. Ein minimales Zitat aus Also sprach Zarathustra findet sich in Notizbuch I: »Wohlan! Noch einmal« (Nb.I, 51; KSA 6, 199). Das notierte er sich vielleicht als Gegengewicht zu Schopenhauers Pessimismus. Wenn man die beschränkten Geldverhältnisse Thomas Manns in den 90er-Jahren bedenkt, dann sind die Anschaffungen vieler Bände der Großausgabe von Nietzsches Werken nur dadurch zu erklären, dass er schon zu dieser Zeit ein intensives Nietzsche-Studium betrieb.
1905 schrieb Thomas Mann von einer »Schule von Geistern, die Nietzsche in Europa geschaffen hat«. Diese Schule identifiziere den »Begriff des Künstlers mit dem des Erkennenden« (14.I, 86). Diese Aussage beschreibt wohl eher Thomas Manns Rezeption Nietzsches und Schopenhauers als eine »Schule«. Die Moralkritik Nietzsches war in einer lebendigen, gewählten und trotzdem eingängigen Sprache verfasst und ließ das traditionelle Weltbild als Gottes Schöpfung und Ordnung hinter sich. Eine neue Ordnung aller Werte war gefragt. Wie aber konnte diese Ordnung gelehrt werden, wenn das moderne Denken keine absolut gültige Metaphysik als Grundlage des Denkens und Wissens gelten ließ? Nietzsche lieferte die Antwort: Der freie, überlegene Geist denkt kreativ, ist nicht in ein System gebunden, muss nicht konsistent sein: »Du solltest Gewalt über dein Für und Wider bekommen und es verstehen lernen, sie aus- und wieder einzuhängen, je nach deinem höheren Zwecke. Du solltest das Perspektivische in jeder Wertschätzung begreifen lernen« (KSA 2, 20; aus der späten Vorrede zu Menschliches, Allzumenschliches von 1886) »Für« und »Wider« sind Gegensätze, die der Denker »aushängen« oder »einhängen« kann, auf eine allgemein gültige Metaphysik verzichtend. Solche Gedanken mussten einem jungen Mann, der nach einer Orientierung sucht, imponieren.
Die Darstellung der Wirkung Nietzsches auf Thomas Mann in Lebensabriss von 1930 ist gefärbt von einer Nietzsche-Skepsis, die sein Widerstand gegen den aufkommenden Nationalsozialismus nötig gemacht hatte. Eine solche Nietzsche-Skepsis deutet sich schon in seinem Widerstand gegen Heinrichs Roman Die Göttinnen oder die drei Romane der Herzogin von Assy (1902) an, deren Protagonistin Nietzsches starkes Leben zum Vorbild nimmt. Von Anfang an bezog Thomas Mann Nietzsches »Pathos der Distanz« auf den modernen Künstler, der die Gewöhnlichen überragte, die an überkommenen Konventionen festhielten. Als Schlagwort stellt Thomas Mann »Pathos der Distanz« schon in der Erzählung Der Wille zum Glück (1896) ein.
Thomas Manns Wagner-Liebe begann in seiner Lübecker Jugendzeit (GW XI, 418 f.).[66] Das Stadttheater inszenierte Lohengrin jedes Jahr in der Zeit von 1889 bis 1894, Tannhäuser jedes Jahr seit 1890, 1893 auch Die Meistersinger von Nürnberg . Emil Gerhäuser sang als Gast in der Spielzeit 1893–1894, Thomas Manns letztem Jahr in Lübeck, in Lohengrin und Tannhäuser. [67] Auf »die gewaltigen Wagner-Gerhäuser-Abende« blickt Thomas Mann in der Besprechung einer Operette im Frühlingssturm! zurück (14.I, 24).
In Rom erlebte er 1897, wie der Kapellmeister Vessella Wagners Musik gegen opponierende Liebhaber italienischer Musik durchsetzte. Eine nicht erhaltene Notiz von diesem Ereignis ist in die Betrachtungen eines Unpolitischen eingegangen (13.I, 88–90). In Buddenbrooks leitet die Erinnerung an einen Besuch der Oper Lohengrin Hannos schlimme Erfahrungen in der Schule ein. Buddenbrooks enthält die bedenkenswerte Wagner-Kritik des Organisten Pfühl. Sehr früh, wahrscheinlich schon in Lübeck, las Thomas Mann Nietzsches geistreiche satirische Schrift Der Fall Wagner mit Zustimmung und Genuss. Er kritisiert Wagner als Person, aber bewundert seine Größe als Komponist und liebt seine Musik. Öffentlich wird seine Kritik Wagners als wesentlicher Bestandteil des bürgerlichen Theaters mit dem Versuch über das Theater (1907).
Thomas Manns übernimmt in seiner Prosa oft Wagners epischen Aufbau seiner Musikdramen aus Motiven, die durch Wiederholungen den musikalischen Zusammenhalt des Werkes bekräftigen (so genannte »Leitmotive«). Manns Prosa kann wie eine Partitur gelesen werden, die auch komische Anspielungen enthält. Die Handlung von Buddenbrooks kann man als Parodie von Der Ring des Nibelungen lesen: Wie Wagners Ring beginnt der Roman mit einer Hauseinweihung und einer Geldforderung. In Manns Novelle Tristan übernimmt ein Schriftsteller, mehr komisch als tragisch, die Rolle von Wagners Tristan in Tristan und Isolde , was nicht hinderte, dass die Handlung der Novelle Isolde / Gabriele liebend in ihren Tod treibt. Eine Zeit lang versäumte der junge Thomas Mann in München keine Aufführung von Tristan und Isolde (21, 121).
Von Bruder Heinrich wissen wir, dass er 1891 Richard von Krafft-Ebings Psychopathia sexualis gelesen hat.[68] Wahrscheinlich las er das Buch mit Gedanken an den jüngeren Bruder und empfahl es ihm zwei Jahre später, vermutlich 1893, als er längere Zeit mit Thomas in Lübeck zusammen war. Dieser erwähnt die Lektüre Krafft-Ebings in einem Brief an Otto Grautoff vom 10. Juli 1896.[69] Er habe das Buch in der Zeit seiner »völlige[n] körperlichen Entwicklung« gelesen. Das war wohl das Frühjahr 1893, als Mann achtzehn Jahre alt wurde und vertrauten Umgang mit Heinrich hatte. An Grautoff schreibt er, dass ihm durch die Lektüre von Krafft-Ebing und dem Psychiater Albert Moll bewusst geworden sei, was der »W.-Roman« bedeutet habe. Er meint seine verdrängte Liebe zu seinem Mitschüler Willri Timpe. »Hässliche[ ] Tragikomödien« hätten sich in ihm nach dem Bewusst werden von Krafft-Ebing und Moll abgespielt. Deren Sexualpathologie brachte ihn zu der Einsicht, dass sein homoerotisches Verlangen keine vorübergehende Entwicklungsstörung war, sondern, dass er anders fühlte als die Mehrheit der Männer.
Читать дальше