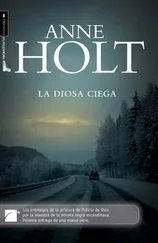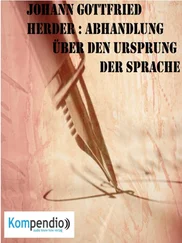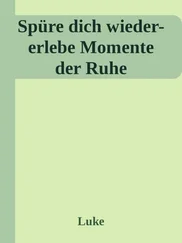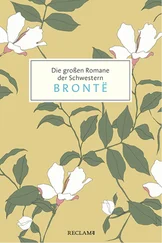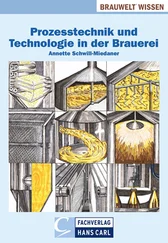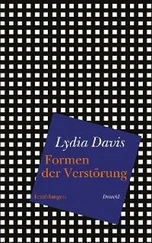1 ...8 9 10 12 13 14 ...24 In der deutschen Gegenwartssprache gibt es Reste dieser früher sehr verbreiteten Kompression der Aussage durch Verwendung von Partizipialformen, welche im angeführten Beispiel zwar das griechische Original kopieren, dabei aber keinesfalls als griechische (oder jeweils lateinische) Entlehnungen zu behandeln sind, da die Möglichkeit ihrer Verwendung als solche schon von deren Verankerung im eigenen grammatischen System zeugt. Doch ist das Ausmaß dieser Kompression (als prädikative Attribute) in modernen germanischen Sprachen im Vergleich zu den älteren Stufen der Indogermania sehr bescheiden, vgl. dt. Ein spannendes Buch lesend ging Wolfgang die Straße entlang. Die Sätze des Typs ?? Die Straße entlang gehend , dabei ein spannendes Buch lesend , auf Passanten und Autos wenig achtend und kaum bemerkend , was sich um ihn tat, auf eine Laterne stoßend , schrie Wolfgang vor Schmerz auf sind zwar theoretisch verständlich, doch trotzdem kaum mehr grammatisch. Dagegen leben derartige Kompressionen in Form von Gerundivum-Kompressionen in der Slavia weiter, vgl. russ. Идяпо улице, читаяинтересную книгу, не смотряпо сторонам и не замечаяни пешеходов, ни людей, Вольфганг, натолкнувшисьна столб, вскрикнул от боли. Freilich ist auch der russische Satz stilistisch alles andere als mustergültig, doch ist er im Unterschied zum deutschen Satz grammatisch völlig korrekt und in jeder Hinsicht akzeptabel. Grund dafür liegt auf der Hand: Die overte Finitheit hat sich in der Germania in einem viel stärkeren Maß als in der Slavia entwickelt und dominiert heutzutage die Satzsyntax in dem Maß, dass dieser Fakt in der Grammatikschreibung widergespiegelt wird, indem Finitheit zum Satzkriterium sine qua non erhoben wird. Doch ist dieses formale Kriterium u.E. keinesfalls ausreichend, um verblosen sowie in- und afiniten Sätzen den Satzstatus (hier: Nebensatzstatus) abzusprechen, gleichgültig, ob es sich um (overte oder coverte) Ellipsen oder aber um nichtelliptische Satzkompressionen handelt. Noch weniger kann Finitheit als oberes Gebot für Satzstatus aus sprachtypologischer Sicht bewertet werden.
Im Weiteren werden nun pragmatisch bzw. textsortenspezifisch bedingte Verwendungsweisen afiniter Formen im Deutschen in einem kurzen historischen Aufriss behandelt, wobei die Entwicklungsetappen der deutschen Sprache im Mittelpunkt stehen, in denen Afinitheit besonders stark eingesetzt wurde und spezifische Funktionen erfüllte, welche später aufgegeben oder stark eingeschränkt, mitunter auch völlig umgedeutet und gerade an explizite Finitheit gebunden wurden.
4 Afinitheit im kurzen historischen Aufriss
Das Auslassen der finiten Verbformen als syntaktisch-stilistisches Verfahren ist im hochdeutschen Diskurs seit der spätmittelhochdeutschen Zeit (14. Jh.) vereinzelt belegt (vgl. Ebert 1993: 442). Die Frühbelege afiniter Verbalperiphrasen, die eher als Zufallsfunde denn als Ergebnisse einer systematischen Materialerhebung zu werten sind, finden sich beispielsweise im Egerer „Buch der Gebrechen“ aus dem Jahre 1379. Nichtsdestotrotz verleiten derartige Einzelfunde zu dem Schluss, dass die syntaktischen Kurzformen – entgegen der kursierenden Hypothese – bereits den mittelalterlichen Schreibern geläufig waren (vgl. Macha 2003: 25).
Eine systematische Verwendung der finitlosen Satzstrukturierung fällt aber erst in das 16. und 17. Jahrhundert, also in die Spätphase des Frühneuhochdeutschen, in der ein Wechsel von älteren, dialektal differenzierten Schreibvarianten zu modernen und einheitlichen Schreibformen stattfindet und wo die einst unumstößliche Autorität der mündlichen Überlieferung zunehmend durch die Ausbildung schriftlicher institutioneller Kommunikation verdrängt wird. Diese neue Qualität der Schriftlichkeit betrifft vor allem den kanzleisprachlichen Schreibusus, sodass man auch davon ausgehen kann, dass der Hang zur afiniten Konstruktionsweise eine der typischen Erscheinungen der frühneuhochdeutschen Kanzleisyntax ist (vgl. Ebert 1993: 442). Im Schriftverkehr des 17. Jahrhunderts ist die Auslassung der finiten Verbformen fast zur Regel geworden, was wiederum dazu geführt hat, dass in vielen Texten die ausgiebig eingesetzten Kurzformen das dominierende Satzmuster bilden (vgl. a.a.O.).
Diese Auslassungstendenzen, die in frühneuzeitlichen Texten massenhaft vorkamen, gingen im Laufe des 18. Jahrhunderts spürbar zurück. In sprachreflexiven Texten zeitgenössischer Autoren (z.B. bei Gottsched) wurden sie als normwidrig stigmatisiert, da sie gegen die Kriterien von Wohllaut und Deutlichkeit verstießen (vgl. Konopka 1996: 140f.). Dies verursachte wiederum eine Reihe von strukturellen Änderungen im Bereich der Text- und Satzgestaltung, welche sich zuletzt darin äußerten, dass der afinite Satzbaustil zugunsten der vollständigen Verbalstrukturen verworfen wurde.
Die Möglichkeit afiniter Satzgestaltung ist jedoch nie zugrunde gegangen. Wie die durchgeführten Korpusrecherchen belegen, expandiert die afinite Konstruktionsweise in der deutschen Gegenwartssprache in neue Domänen der Schriftlichkeit. Das Belegmaterial ist deswegen so heterogen und umfangreich wie noch nie zuvor. Augenfällig ist auch das differenzierte Funktionsprofil der historischen und gegenwartssprachlichen Satzstrukturen: War die Afinitheit im historischen Diskurs auf besondere Nebensatztypen beschränkt, liegt sie heute vornehmlich im Hauptsatzparadigma vor und übernimmt verschiedene textsortenspezifische und kommunikative Aufgaben, von Komprimierung über emphatische Markierungen bis hin zu stilistischer Variierung (vgl. Schönherr 2018: 566).
5 Afinitheit als textsortenspezifisches Phänomen
Betrachtet man afinite Konstruktionstypen in einem geschichtlichen Querschnitt, so fällt auf, dass Afinitheit vornehmlich an Texte gebunden war, die einen hohen sozialen Status besitzen. Hierher gehören vor allem die oben bereits erwähnten Kanzleitexte als im hohen Grad (durch vorgegebene Strukturmuster) standardisierte, zum Teil stark formelhafte Texte, die zur Regelung von sämtlichen Rechts- und Geschäftsvorgängen dienten. Die Einbettung der einzelnen Texte in den kanzleisprachlichen Diskurs bewirkt, dass sie nicht nur in formaler, sondern auch in inhaltlicher Sicht gewisse Affinitäten aufweisen. So sind sie u.a. durch Komplexität der darin beschriebenen Sachverhalte gekennzeichnet, woraus sich dann als Begleiterscheinung die natürliche Notwendigkeit einer sprachökonomischen Auslassung entbehrlicher Satzteile, darunter gerade der finiten (Hilfs-)Verben ergeben hat.
Umgekehrt kommen in Texten, die der gesprochenen Sprache besonders nahestehen oder einen sehr einfachen thematischen Gehalt aufweisen, nur selten afinite Konstruktionen vor (vgl. Admoni 1967: 190). Somit kann festgehalten werden, dass der afinite Satzbaustil ein spezifisches Merkmal der Kanzleitexte, ja ein „Kanzleiusus“ (Rösler 1995) ist.
Was nun die gegenwartssprachlichen Domänen der Verwendung afiniter Konstruktionen anbelangt, so liegt ein weitgehender Gebrauchswechsel vor: Afinite Konstruktionen werden heute tendenziell in Texten mit abgeschwächter kommunikativer Ausrichtung (z.B. in Tagebüchern, vgl. dazu u.a. Fernandez-Bravo 2016) verwendet, in denen nicht so stark auf die Finitheit geachtet wird wie z.B. in narrativen Texten. Textsortenspezifisch ist dies leicht erklärlich, sind ja Tagebücher generell eine nichtkommunikativ (da ausschließlich autoreferentiell) konzipierte Textsorte, sodass ihr Verfasser sich auf Sprachformen begrenzen darf, welche für ihn ausreichend verständlich sind und keine empfängerseitig begründete Akribie grammatischer Norm verlangen. Andererseits werden sie als Mittel verwendet, das zur stärkeren kommunikativen Geltung eines Textes beitragen kann. Schließlich kommen sie im mündlichen Register vor, meist in elliptischen und / oder emphatischen Kontexten, wo sie unterschiedliche pragmatische Funktionen übernehmen (vgl. Schönherr 2018: 568).
Читать дальше