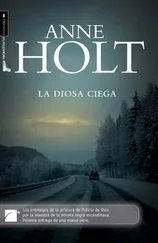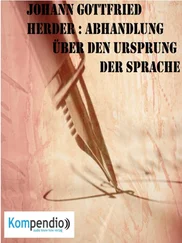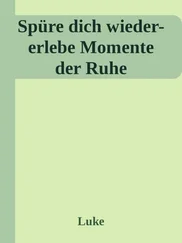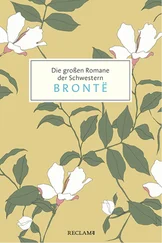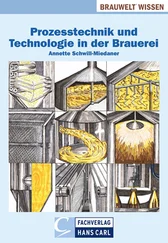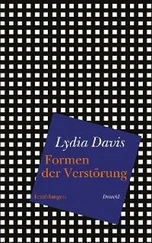(23) Als ich neulich bey meiner gutten Freunde einem im Durchreisen einsprach/ fand ich unter andern seinen Sachen auch diß Gedichte von Glückseligkeit deß Feldlebens/welches ich vor etlichen Jahren/als ich mich noch auff hohen Schulen befunden/sol geschrieben haben. (Martin Opitz: Martini Opitii Lob deß Feldtlebens, 1623, S. 7)
Die Tilgung von Auxiliarverben erfolgt auch zwecks der Vermeidung von repetitiven Verbformen (vgl. Ebert 1993: 442), die ansonsten an der Grenze vom Nebensatz und Hauptsatz zusammenstoßen würden. Ferner kommt die Auslassung der finiten Auxiliare in stark formelhaften Wendungen vor, welche durch einen häufigen Gebrauch zu einer Art Kollokationen geworden sind ( wie oben verordnet, wie oben gemeldet, wie oben im ersten theil dieser ordnung gemeldet [Concept der verbesserten Cammergerichtsordnung, 1753]).
Die Ersparung finiter Verbformen kann schließlich als eine der Bestrebungen angesehen werden, die schriftliche Rede von der mündlichen abzuheben, und somit der geschriebenen Sprachvarietät mehr Autonomie, ja mehr Prestige und Professionalität zu verleihen – kurzum: die Schriftsprache zum neuen, verbindlichen und stabilen Medium der (institutionellen) Kommunikation aufzuwerten. Mit Oskar Reichmann ist dieser Prozess als eine fundamentale Umorientierung der Funktional-, Sozial- und Medialvarianten etc. der Sprache zu verstehen, wobei hier besonders der mediale Übergang von der gesprochenen (Oralität) bis zur geschriebenen Sprachvarietät (Literalität) von Interesse ist. Die Schriftsprache wird von Reichman (2003, 30) als das „von Wissenschaftlern, Schriftstellern, überhaupt Gebildeten in den soziologisch gehobenen bzw. als gehoben betrachteten Kultursystemen als omnivalentes Darstellungs- und Handlungsinstrument zu allen denkbaren Zwecken“ aufgefasst. Diese Umorientierung vollzog sich auch auf der Sprachebene, indem viele sprachinterne Neuerungen bzw. Tendenzen aufkamen, etwa die syntaktische Manier das Verbum Finitum aus Nebensatzkonstruktionen zu eliminieren, und zwar besonders in als hochwertig angesehenen frühneuzeitlichen Kanzleitexten.
Das Phänomen der Verblosigkeit und damit verbundene Erscheinungen der In- bzw. Afinitheit sind – u.a. als strukturinternes Kompressionsmittel – nahezu in jeder natürlichen Sprache vorhanden, auch wenn ihre Verbreitung und Anwendung gewissen Restriktionen unterliegt, die sich von Sprache zu Sprache z.T. stark unterscheiden. Auch diachron gesehen gibt es gewisse Tendenzen, die die Entwicklungsrichtung anzeigen: In der Germania und z.T. in der Slavia ist dies generell eine Entwicklung zur stärkeren Ausprägung finiter Ausdrücke, auch wenn bei bestimmten Textsorten nach wie vor Afinitheit, wenn nicht dominant, so zumindest relativ stark vertreten ist.
Verblose bzw. in- oder afinite Sätze, welche zu „Vollsätzen“ mit dem Verbum finitum ergänzt werden können, sind gemeinhin als Ellipsen einzustufen, auch wenn nicht jede Ergänzungsprozedur eine dem Satz ohne Finitum volläquivalente Proposition ergibt. Ellipsen sind ihrerseits nicht homogen. Bei einer overten Ellipse ist das einzusetzende Verb in aller Regel unspezifiziert und lässt daher eine – wenngleich beschränkte – Wahl bzw. Varianz zu. Eine coverte Ellipse schließt dagegen in aller Regel Varianz aus. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um das nachzutragende Verbum substantivum in Kopulafunktion. Typologisch lassen sich beide Arten der Ellipse lediglich auf die Satzoberfläche beziehen, universalgrammatisch liegen beiden ähnliche Tiefenstrukturen zugrunde.
Nichtelliptische Sätze ohne Finitum haben das Merkmal der Verbalität an der Satzoberfläche in der Form infiniter Verbformen, aber im Gegensatz zu den Ellipsen, bei denen Finitheit generell ableitbar ist, beschränkt sich die „Verbalität“ dieser Satzgebilde auf infinite Verbformen, wodurch sie zu „absoluten“ und damit vergleichbaren nonfiniten Satzstrukturen gezählt werden müssen.
Die angestellten Überlegungen stellen nun das Merkmal der Finitheit als formal gültiges Satzkriterium in Frage und lassen eine Proposition auch dann als vollwertigen Satz einstufen, wenn die dadurch ausgedrückte Prädikation ohne Finitum, ja gar ohne Verb an der Satzoberfläche erscheint.
Dies gilt übrigens auch für die historischen Konstruktionen: Die prädikative Eigenständigkeit der afiniten Nebensätze ist genauso gesichert, wie wenn ein finites Verb vorhanden wäre. So nahe diese Folgerung liegt, so wenig wird sie in der Forschung reflektiert, da man sehr oft davon ausgeht, dass afinite Verbalperiphrasen wohl nur Abbreviaturen einst vollständiger Sätze sind und als solche keiner eingehenden Untersuchung bedürfen. Die Einsicht, dass sie als vollgültige Prädikate fungieren, eröffnet eine neue Sicht auf ihre Entstehungsgeschichte sowie Entwicklungslinien und Wendepunkte.
Der auffällig häufige Gebrauch afiniter Satzstrukturen in frühneuzeitlichen Texten, darunter vor allem Kanzleitexten, deutet darauf hin, dass es neben strukturellen Faktoren auch stilistische und pragmatische Gründe für die Verwendung afiniter Konstruktionen gibt. Zu den Letzteren zählen u.a. die Betonung des besonderen Status des Textes sowie die Tendenz zum ökonomischen Sprachgebrauch, was im Falle der Verwaltungstexte, die ja per se umfangreich sind, von großem praktischem Nutzen ist.
Am häufigsten werden die finiten Hilfsverben in den temporalen Verbalperiphrasen im Perfekt und Plusquamperfekt (Passiv und Aktiv) ausgelassen. Der Anteil anderer Konstruktionstypen ist relativ gering. Nach ihrer Blütezeit im 17. und 18. Jahrhundert ist ein spürbarer Rückgang der Formen zu verzeichnen. In der Gegenwartssprache beobachtet man allerdings, wie bereits erwähnt, eine erneute Tendenz zur Auslassung der Verba finita, auch wenn dies vor allem das Hauptsatzparadigma betrifft und durch völlig andere Gründe (z.B. emphatische oder stilistische Markierung) motiviert ist.
Abraham, Werner, 2008. „Tempus- und Aspektkodierer als Textverketter: Vorder- und Hintergrundierung“. In: Macris-Ehrhard, Anne-Françoise / Krumrey, Evelin / Magnus, Gilbert (Hrsg.). Temporalsemantik und Textkohärenz. Zur Versprachlichung zeitlicher Kategorien im heutigen Deutsch . Tübingen: Stauffenburg, 161–176.
Admoni, Vladimir G., 1967. „Der Umfang und die Gestaltungsmittel des Satzes in der deutschen Literatursprache bis zum Ende des 18. Jahrhunderts“. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur , 89, 144–199.
Admoni, Vladimir G, 1972. Der deutsche Sprachbau . Leningrad: Nauka.
Bär, Jochen A. / Roelcke, Thorsten / Steinhauer, Anja (Hrsg.), 2007. Sprachliche Kürze. Konzeptuelle, strukturelle und pragmatische Aspekte . Berlin / New York: de Gruyter.
Behr, Irmtraud, 1998. „Zur Leistung der Kasus in verblosen Sätzen“. In: Vuillaume, Marcel (Hrsg.). Die Kasus im Deutschen . Tübingen: Stauffenburg, 99–114.
— 2013. „Syntaktisch-grammatische Aspekte von verblosen Sätzen nach dem logisch-semantischen Modell von J.M. Zemb“. In: Günthner, Susanne / Konerding, Klaus-Peter / Liebert, Wolf-Andreas / Roelcke, Thorsten (Hrsg.). Die Ellipse. Neue Perspektiven auf ein altes Phänomen (= Linguistik – Impulse und Tendenzen, 52). Berlin / Boston: de Gruyter, 253–279.
Behr, Irmtraud / Quintin, Hervé, 1996. Verblose Sätze im Deutschen. Zur syntaktischen und semantischen Einbindung verbloser Konstruktionen in Textstrukturen . Tübingen: Stauffenburg.
Darski, Józef P., 2010. Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz . Frankfurt a.M.: Peter Lang.
Ebert, Robert Peter, 1993. „Syntax“. In: Ebert, Robert Peter / Reichmann, Oskar / Solms, Joachim / Wegera Klaus-Peter (Hrsg.). Frühneuhochdeutsche Grammatik . Tübingen: Niemeyer, 313–484.
Читать дальше