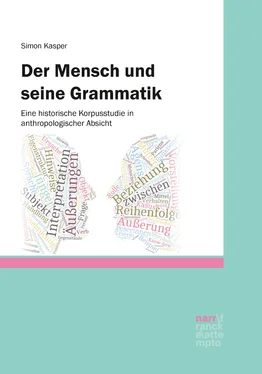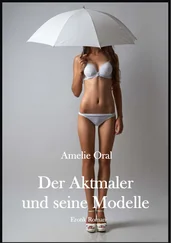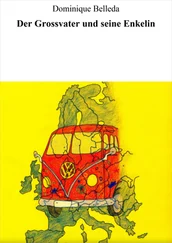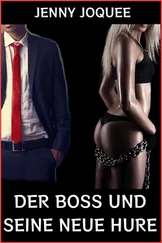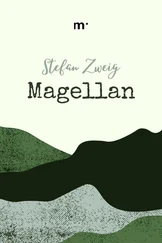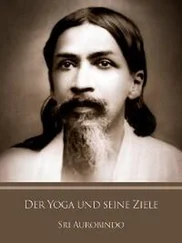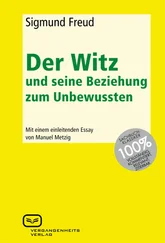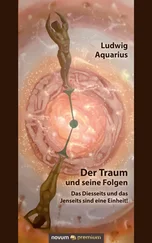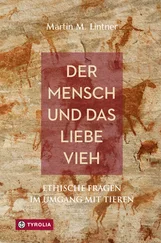Ich gehe davon aus, dass ein solcher Zustand für das Standardenglische in England und das Standarddeutsche im deutschsprachigen Raum gegeben ist. In den entsprechenden Sprachgemeinschaften stellen der Schrift- und die Leseunkundige seit spätestens 1900 die Ausnahmen dar.7 Die weitaus meisten Menschen lernen spätestens in der Schule eine normierte geschriebene Standardsprache und in diesem Zuge auch, sie so zu gebrauchen, dass sie ohne Kontextstützen verstehbarverstehen ist. Die kritische Masse für die Verinnerlichung geschriebensprachlicher Eigenstrukturen war ab diesem Zeitpunkt also gegeben. Unabhängig davon, ob diese geschriebene Standardsprache auch immer die Sprech- oder Schreibweise ist, die von ihren Benutzerinnen in allen möglichen Lebensbereichen und -situationen angestrebt wird, ist sie doch diejenige, an der kaum ein biographischer Weg vorbeiführt. Nimmt man dies mit der Tatsache zusammen, dass unsere Kognition durch die Schrift auch umgeprägt wird, kann es kaum verwundern, wenn die spezifischen eigensprachlichen Regelungen der Schriftsprache schließlich selbst auf die genuin gesprochenen dialektalen, regionalen und umgangssprachlichen Weisen des Sprechens zurückwirken – und das heißt, auf das Know-how Know-how der Sprechenden. „Once a society has become literate, it can never return to ‚authentic‘ orality. Instead orality will be created artificially with the means of literacy.“8
Es lassen sich mehrere Schübe ausmachen, die die Standardisierung des Englischen und Deutschen vorangetrieben haben. Einen Schub an Verbindlichkeit erhielten die NormenSchriftnorm der geschriebenen Sprache durch die ersten weiter verbreiteten Grammatiken ab dem 17. Jahrhundert.9 Im deutschsprachigen Raum avancierte das Deutsch von Luthers Bibelübersetzung von 1545Biblia (1545) dabei vielfach zum Vorbild der Grammatiker.10 Dasselbe lässt sich über die ÜbersetzungÜbersetzung des Teams WycliffeWycliffe-Bibel/Purvey nicht sagen. Die englische Standardsprache ist zum größten Teil aus einem anderen Dialekt hervorgegangen.11 Einen zusätzlichen Schub an Reichweite erfuhr die Entwicklung genuin schriftsprachlicher Konventionen insbesondere durch die Einführung der Schulpflicht (und ihre Durchsetzung) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.12 Und die Rückwirkung der schriftsprachlichen Eigenstrukturen auf die genuin mündlichen Sprechweisen – die den Weg zurück in die „authentische“ Mündlichkeit verstellte – sollte wiederum durch die Etablierung der überregionalen Massenmedien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Schub erhalten haben.13 Unter unseren Bibelübertragungen betreffen diese Entwicklungen trivialerweise die standarddeutsche von 1984, aber potentiell auch die hochalemannischeS Nöi Teschtamänt von 1997 und die nordniederdeutscheDat Nie Testament von 1933, jedoch nicht die historischen Sprachstufen des Deutschen und Englischen. Der Syntax LuthersBiblia (1545) wird „das Gepräge gesprochener Sprache“ bescheinigt.14
Einen hohen Grad an SyntaktifizierungSyntaktifizierung mit genuin schriftsprachlichen Eigenstrukturen können wir für einen neuhochdeutschenNeuhochdeutsch Text von 1984, wie ihn die Luther-BibelBibel (1984) darstellt, also sicherlich annehmen. Einen ebenso hohen Ausbaugrad an schriftsprachlicher Eigenstruktur dürfen wir für das moderne HochalemannischeHochalemannisch und NordniederdeutscheNordniederdeutsch aber nicht ohne Weiteres annehmen. Dafür müssten wir argumentieren, dass die geschriebensprachlichen Eigenstrukturen des Standards tatsächlich auf die Dialekte zurückgewirkt haben oder dort unabhängig existieren. Der schweizerische hochalemannische Dialekt und der nordniederdeutsche Dialekt weisen jedoch jeweils ganz andere Gebrauchsbedingungen als die deutsche Standardsprache (und verschiedene im Vergleich zueinander) auf.15 Sie wurden zwischen der Einführung der Schulpflicht und dem Zeitalter der sozialen Medien nämlich nur selten geschrieben.16 Wenn sie doch einmal geschrieben wurden, wie im Falle unserer Bibelübertragungen, dann musste dies ohne Rückgriff auf eigene, kodifizierte Schreibkonventionen geschehen. Dennoch können wir nicht ausschließen, dass in diesen Bibelübertragungen die oben genannten Grenzphänomene von der geschriebensprachlichen Eigenstruktur des Standards gedeckt sind. Dafür muss eine Bedingung erfüllt sein: Die Kenntnis des geschriebenen Standards hat die Kompetenz der Dialektsprecherinnen für ihren gesprochenen Dialekt in Richtung dieser schriftsprachlichen Eigenstrukturen beeinflusst. Den syntaktifiziertenSyntaktifizierung Umgang mit Nullstellen und Pronomen hätten die Dialektnutzerinnen also aus der neuhochdeutschenNeuhochdeutsch Standardsprache übernommen.17 Dies müsste also sowohl für unsere Übersetzer als auch für ihre jeweiligen hochalemannischenHochalemannisch und nordniederdeutschenNordniederdeutsch Leserinnen gelten. Nicht ausreichen würde dagegen der Nachweis, dass zwar die Übersetzer im Zuge ihrer eigenen standardsprachlichen (und altsprachlichen) Bildung gezielt syntaktifiziertenSyntaktifizierung Gebrauch von ihren jeweiligen Dialekten gemacht haben, aber dasselbe nicht für ihre Leserinnen behauptet werden kann. Denn eine KonventionKonvention, die nur von der Hälfte der beteiligten Parteien befolgt wird, besitzt keine Geltung. Ob diese Bedingung erfüllt ist, kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht entschieden werden und würde eine gesonderte Studie erfordern.18 Ich muss mich daher für einen speziellen methodischen Umgang mit den genannten Grenzphänomenen in den modernen Dialekten entscheiden. Im vorherigen Abschnitt haben wir ihn bereits vorweggenommen: Wir gehen davon aus, dass der Grad an Syntaktifizierung in Bezug auf den Umgang mit Nullstellen derjenige des modernen Standarddeutschen ist!
Für die älteren Sprachstufen des Deutschen und Englischen gehe ich davon aus, dass ihre Syntaktifizierung noch nicht so weit fortgeschritten war, weil sich für die geschriebene Sprache noch keine breitenwirksamen, überregionalen und rückwirkenden, dezidiert schriftsprachlichen KonventionenKonvention dafür entwickelt hatten, wie mit freier handhabbaren Phänomenen wie Pronomen und Nullstellen umzugehen wäre. Wenn es Regelungen gegeben hat, so waren sie auf den geringsten Teil der Sprachbenutzerinnen begrenzt. Wir haben es in diesen Sprachstufen eher mit Geschriebenem zu tun, das durch die Merkmale gesprochener Sprache gekennzeichnet ist, als mit Schriftlichkeit, die auch eine spezifische (monologische, distanzierte und so weiter) Konzeption von Sprache erfordert, wie es in den modernen geschriebenen Standardsprachen der Fall ist.19
Das Ganze hat eine intellektuell herausfordernde Konsequenz: Ich werde nachher aus der morphologischen und syntaktischen Klassifikation der deutschen und englischen Bibelübertragungen ableiten, welche Äußerungen in ihnen morphologisch und syntaktisch mehrdeutig sind, um mich schließlich der Frage zuwenden zu können, wie Interpretinnen die mehrdeutigen Äußerungen verstehen können. Bei der Klassifikation von Ein- beziehungsweise Mehrdeutigkeit ist nach den obigen Ausführungen beispielsweise damit zu rechnen, dass eine neuhochdeutsche Äußerung syntaktisch eindeutigeindeutigsyntaktisch ist, während ihr althochdeutsches Pendant, das morphologisch gleich aussieht, syntaktisch mehrdeutigmehrdeutigsyntaktisch ist. Wiese die neuhochdeutsche Übertragung also beispielsweise das Pendant zu dem althochdeutschen Satz in (18) auf, also Da gingen seine Jünger und [ Ø ] bereiteten die Ostern (‚das Osterlamm‘),20 müsste ich sagen, die Interpretation der Nullstelle als imaginäres Subjekt wäre im neuhochdeutschenNeuhochdeutsch Standard eigenstrukturell geregelt, während dies im AlthochdeutschenAlthochdeutsch nicht der Fall wäre.
2.3.4 Zu den morphologischenMorphologie Eigenstrukturen in den Sprach(stuf)eSprach(stuf)en
Читать дальше