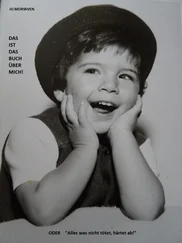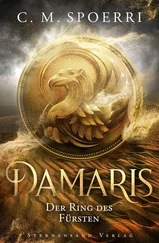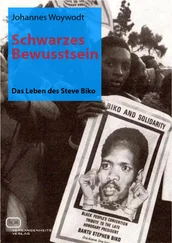Juli begann, den Mund hin und her zu bewegen, ein Zeichen, dass sie genug von der Brust hatte. Hedwig nahm sie ab und legte sie an die andere. Es dauerte nicht lange, da hörte Juli auf zu schmatzen und zu saugen und schlief ein. Hedwig legte sie auf ihren Schoß und schloss ihre Kleidung. Was nun? Sollte sie etwas sagen oder besser den Mund halten? Die Männer schienen sich von ihr entfernt zu haben, still war es, nur das Feuer knackte und knisterte. Schließlich hielt sie es nicht aus, sie verharrte in ihrer abgewandten Haltung und wagte zu fragen: „Warum haltet Ihr mich gefangen? Mein Mann und ich sind nicht reich. Wir können Euch nichts bezahlen.“
„Du bist auf andere Weise nützlich.“
„Wie kann ich Euch nützlich sein?“
„Frag nicht so viel!“
Dieser ölige Widerling, schon beim Klang seiner klebrigen Stimme spürte sie seine schleimige Zunge im Ohr. Sie fühlte sich hilflos ausgeliefert, und die Tränen kamen erneut. „Bitte“, flehte sie. „Mir ist kalt, ich habe eine kleine Tochter, ich …“ Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen und schluchzte. Sie war ein Weib, und man hatte sie in einer bestimmten Absicht hierher gebracht. Es war bedeutungslos, was sie sagte, worum sie flehte. Aber sie konnte ihre Angst nicht bezähmen, und so fragte sie mit tränenschwerer Stimme: „Mein Mann, weiß er, dass ich hier bin? Wartet Ihr auf ihn?“
„Mädchen, halt’s Maul.“
Was hatten sie mit Philipp getan?
„Aber was nur wollt Ihr von uns?“, rief sie so verzweifelt, dass Juli aufwachte und zu weinen begann.
Sie tastete nach dem Kind, hob es an den Busen, wiegte es.
„Himmelarsch, mach, dass es Ruhe gibt, Weib!“
Sie küsste das warme Gesichtchen ihrer Tochter, benetzte es mit ihren Tränen. Sie müsste sie frisch wickeln. Juli stank. Das hatte sie zu Hause tun wollen. Doch sie war nicht zu Hause. Sie wusste nicht, wo sie war. Sie wusste nicht, warum sie hier war. Sie wusste nicht, was ihr bevorstand. Die Angst saß in ihren Eingeweiden wie ein Ungeheuer. Sie hörte das Knacken des Feuers, das Grummeln der Männer. Was hatte der eine zuvor gesagt? Sie sei nützlich? Wie konnte sie nützlich sein? Sie grübelte, und als sie vor lauter Angst nicht mehr weiterkam, wagte sie schließlich zu fragen: „Welchen Nutzen versprecht Ihr Euch durch mich?“
Sie hörte Schritte, war dennoch nicht auf den Schlag gefasst.
Unter der Wucht wurde ihr Kopf in den Nacken geschleudert, die heftige Bewegung verursachte ein lautes Knacken. Heiß schossen ihr die Tränen aus den Augen.
Juli begann zu schreien.
„Eindeutig redest du zu viel, Holde! Halt’s Maul.“
Hedwig rutschte vor dem Mann mit der Blechstimme zurück, Strohhalme stachen ihr in die Handballen, dann spürte sie die Wand im Rücken. Sie lehnte sich dagegen und presste ihr Kind an die Brust.
Geräusche, Bewegung und ein eiskalter Luftzug ließen sie aus dem Schlummer hochfahren. Schneewaldgeruch.
„Er kommt.“
Juli begann zu weinen. Sie krähte, sie plärrte, sie hatte Hunger, und sie war schon viel zu lange eingewickelt. Hedwig tastete nach ihr, hob sie an die Brust, wiegte sie. „Scht, scht.“
Sie begann zu zittern. Vor Kälte. Und vor Hunger. Durstig war sie ebenfalls.
Eilige Schritte, die näherkamen. „Mach, dass es still ist!“, befahl die Blechstimme.
„Ich sag ja, das Balg erschwert die Sache.“
„Dass dich der Teufel schände, bring es zum Schweigen!“
Aber Juli schwieg nicht.
„Herr, ich …“
Der Schlag war so hart, dass sie sich in die Wangenfalte biss. Juli weinte nun noch lauter, obwohl Hedwig sie fest an den Busen gedrückt hielt. Von dort wurde sie ihr unsanft entrissen. „Nein, lasst mein Kind!“, schrie Hedwig. Die Furcht ließ ihren Herzschlag aussetzen. Juli brüllte. Und in ihr Gebrüll hinein schrie sie selbst: „Gebt sie mir. Lasst mich sie auswickeln, dann wird sie Ruhe geben.“ Oh Gott, was tat er mit ihr? Ihr Kind greinte umso lauter, je mehr es dem Grobian ausgeliefert war und Hedwigs Angst spürte.
Hedwig taumelte auf die Beine. Eine verzweifelte Kraft trieb sie an. „Bitte!“, flehte sie und streckte die Arme suchend aus.
„Was geht hier vor sich?!“
Eine neue Stimme. Hart und befehlsgewohnt. Ein weiterer Mann. Die Tür schlug zu.
Juli gab erstickte Laute von sich.
„Was treibst du da?!“
Fast besinnungslos vor Angst torkelte Hedwig umher, wimmerte, wehklagte.
Ein weiterer Schlag ließ sie zusammenbrechen.
Als sie wieder zu sich kam, spürte sie zunächst nur die Härte des Untergrundes und die Kälte. Dann das Loch im Bauch, das von Hunger und Angst gleichermaßen kam.
Sie hörte das Knacken von brennenden Holzscheiten. Ein Husten. Rascheln von Papier- oder Pergamentseiten. Und ein anderes, ein wohlvertrautes Geräusch dicht neben sich, ein Säuglingsschmatzen. Sie weinte vor Erleichterung, als sie das warme Gesichtchen ihrer Tochter ertastete, Juli aufnahm und an ihr Herz drückte.
Die Tür ging, kalte Luft wehte heran.
„Gehst verdammt oft austreten, Vetter.“
Das war die neue Stimme, die des dritten Mannes.
„Wo viel reinläuft, muss auch viel raus“, gab der andere zurück und lachte, so, als glaube er seine Worte selbst nicht.
„Sie ist bei Sinnen. Gib ihr Brot.“
Das klang fast fürsorglich.
„Wozu sie füttern?“, hörte sie die ekelhafte, ölige Stimme.
Scheinbar hatte der neu Hinzugekommene das Sagen, denn er erwiderte nichts, und trotzdem ergänzte der andere gleich darauf mürrisch: „Mein ja bloß.“
Etwas wurde ihr in den Schoß geworfen. Sie nahm es und biss hinein. Juli begann zu weinen.
„Da hört ihr es. Wieder plärrt das Balg. Lass nur jemand in der Nähe sein, der zu neugierig ist und meint, nach dem Rechten schauen zu müssen.“
„Quatsch nicht. Mach weiter.“
Das Brot war trocken, Hedwig schluckte hart an dem zerkauten Brei, sie nahm ihren Mut zusammen und sagte erstickt: „Herr, lasst mich sie auswickeln. Nehmt mir die Binde ab. Ich schaue auch gewiss nicht zu euch.“ Ihr Herz raste. Sie hatte es immerhin versucht.
Sie erhielt keine Antwort. Nichts geschah.
Juli weinte und stank, und Hedwig wünschte, sie hätte Honig und Mohn zur Hand, um sie zum Schlafen zu bringen, wie sie dies von Tante Barbara gelernt hatte, die ihre Tochter Sophia ebenfalls auf diese Art besänftigte, wenn sie nicht aufhörte zu plärren. Ihre Base war eineinhalb Jahre alt, und beim Gedanken an sie und ihre Familie stiegen die Tränen erneut in ihr hoch. Dann war einer dicht bei ihr, drückte ihren Kopf unsanft nach unten und band ihr den Lappen von den Augen.
Hedwig blinzelte. Der Raum schien in Licht getaucht – im Vergleich zu der Schwärze, welche sie die ganze Zeit umgeben hatte. Sie wagte nicht aufzusehen.
„Sieh zu, dass sie Ruhe gibt!“, befahl jener, der neu hinzugekommen war, aus dem gegenüberliegenden Winkel.
Der ihr die Augenbinde abgenommen hatte, stand noch schräg hinter ihr. Sie zwang sich dazu, ihn nicht wahrzunehmen, bemerkte nur helle lederne Hosen und Stulpenstiefel. Dahinter flackerte Feuer in einer Feuerstelle. Zusätzlich musste es Laternen geben, denn die Ecke, in der die beiden anderen Männer saßen, lag in gelbem Lichtschein. Hedwig schaute auf Juli, die sich in ihrem Schaffell und den Windeln, in die sie geschnürt war, nicht rühren konnte. Deshalb weinte sie so ausdauernd. Sie wollte die Ärmchen bewegen, mit den Beinen strampeln. Also begann sie, auf Juli einzuflüstern, sie sah nicht auf dabei, wusste den Mann noch immer hinter sich, gewahrte die dunkle Hüttenwand rechts von sich, die aus Lehm zu sein schien, hörte dahinter den Wind durch die Nacht streichen. Jetzt sah sie auch, dass sie auf einer verschlissenen Wolldecke kauerte, die auf dünn ausgestreutem altem Stroh lag.
Sie versuchte, das Augenmerk einzig auf das Auswickeln ihrer Tochter zu richten, nahm das Schaffell weg, das wollene Tuch. Dabei flüsterte sie mit Juli, die nur noch in Schüben keckerte, da sie die Augen ihrer Mutter sah, die die ihren festhielten, da sie die Stimme ihrer Mutter vernahm, die beruhigend auf sie einsprach, da sie merkte, dass das geschah, wonach sie so lauthals verlangt hatte. Hedwig löste die Windelschnur, mit der Juli von den Schultern ab bis zu den Beinchen umwickelt war. Dann nahm sie die Außenwindel fort, Juli krähte geplagt, strampelte. Der Gestank wurde beißender. Ohne aufzuschauen sagte Hedwig: „Bitte Wasser … und vielleicht … Ich hatte ein Bündel …“
Читать дальше