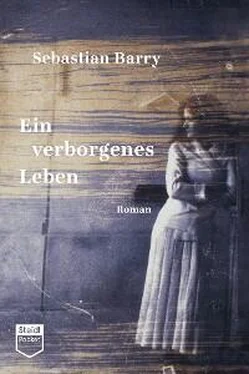»Hältst du auch genügend Abstand, liebstes Kind?«
»Ich halte genügend Abstand, Papa«, rief ich, ich schrie es fast, so weit mussten meine Worte nach oben steigen, und so klein war das Fenster, durch das sie hindurch mussten, um an seine Ohren zu dringen.
»Dann lass ich den Sack jetzt los. Pass auf, pass auf!«, rief er.
»Ja, Papa, ich passe auf!«
So gut er konnte, lockerte er mit den Fingern einer Hand die Öffnung des Sacks und schüttete den Inhalt aus. Ich hatte gesehen, was er hineingetan hatte. Eine Handvoll Federn aus dem Federkissen ihres Bettes, die er gegen den kreischenden Einspruch seiner Frau herausgerupft hatte, und zwei Maurerhämmer, die er verwahrte, um die Mäuerchen und Grabsteine der Gräber instand zu setzen.
Unverwandt starrte ich hinauf. Vielleicht hörte ich ja eine wundersame Musik. Das Kja-kja der Dohlen und das Rrrah-rrrah der Saatkrähen in den großen Buchen dort vereinte sich in meinem Kopf zu einer Melodie. Ich verrenkte mir den Hals, so gespannt war ich, das Ergebnis dieses eleganten Experiments zu beobachten, ein Ergebnis, das mir meinem Vater zufolge im Leben noch gute Dienste erweisen würde: als Grundlage einer eigenständigen Philosophie.
Obwohl nicht der leiseste Windhauch ging, schwebten die Federn sogleich davon, verstreuten sich wie bei einer kleinen Explosion, stoben sogar grau zu den grauen Wolken auf und waren fast nicht mehr zu sehen. Die Federn schwebten, schwebten davon.
Vom Turm rief mein Vater, rief in hellster Aufregung: »Was siehst du, was siehst du?«
Was sah ich, was wusste ich? Manchmal glaube ich, es ist der Hang zur Lächerlichkeit bei einem Menschen, zu einer womöglich aus Verzweiflung geborenen Lächerlichkeit, wie sie auch Eneas McNulty – noch wissen Sie nicht, wer das ist – so viele Jahre später an den Tag legen sollte, der einen mit Liebe zu diesem Menschen geradezu durchbohrt. Das alles: nicht wissen, nicht sehen, ist Liebe. Für immer stehe ich dort, verrenke mir den Hals, um zu sehen, spähe und recke meinen steifen Nacken, und sei es aus keinem anderen Grund als aus Liebe zu ihm. Die Federn schweben davon, schweben und wirbeln davon. Mein Vater ruft und ruft. Mein Herz schlägt ihm entgegen. Die Hämmer fallen noch immer.
Liebe Leserin, lieber Leser! Wenn Sie sanft- und gutmütig sind, wünschte ich, ich könnte Ihnen die Hand drücken. Ich wünsche mir – allerlei Unmögliches. Doch auch wenn ich Sie nicht um mich habe, so habe ich doch andere Dinge. Es gibt Augenblicke, da ich von einer unerklärlichen Freude durchdrungen bin, als besäße ich, indem ich gar nichts besitze, die ganze Welt. Als hätte ich, indem ich bis in diesen Raum vorgedrungen bin, das Vorzimmer zum Paradies gefunden, und bald wird es sich mir öffnen, und ich werde ins Paradies eingehen wie eine Frau, die für ihre Schmerzen entschädigt wird, eingehen in diese grünen Wiesen und hingeschmiegten Gehöfte. So grün, dass das Gras geradezu leuchtet!
Heute Morgen kam Dr. Grene herein, und hastig musste ich meine Blätter zusammenraffen und verstecken. Denn ich wollte nicht, dass er sie sieht oder mich ausfragt, denn dies hier enthält bereits Geheimnisse, und meine Geheimnisse sind mein Glück und mein Heil. Gottlob hörte ich ihn schon von weitem den Gang entlangkommen, denn er hat Eisenbeschläge unter den Absätzen. Gottlob leide ich auch kein bisschen an Rheumatismus oder sonst irgendeinem Gebrechen, das mit meinem Alter zu tun hat, zumindest nicht in den Beinen. Meine Hände, meine Hände sind leider nicht mehr, was sie mal waren, aber die Beine halten sich wacker. Die Mäuse, die hinter der Scheuerleiste entlanghuschen, sind zwar schneller, aber das waren sie schließlich schon immer. Eine Maus ist eine fantastische Athletin, wenn’s drauf ankommt, da gibt’s kein Vertun. Aber bei Dr. Grene war ich schnell genug.
Er klopfte an, was schon mal ein Fortschritt ist gegenüber dem armen Teufel, der mein Zimmer putzt, John Kane, falls sein Name so geschrieben wird – ich schreibe ihn zum ersten Mal auf –, und als er die Tür endlich öffnete, saß ich an einem leeren Tisch.
Da ich Dr. Grene nicht für einen schlechten Menschen halte, lächelte ich.
Es war ein Morgen von beträchtlicher Kälte, und auf alles im Zimmer hatte sich ein Frostschleier gelegt. Alles schimmerte. Ich selbst hatte mich in meine vier Kleider gemummt, und mir war mollig warm.
»Hmm, hmm«, sagte er. »Roseanne. Hmm. Wie geht es Ihnen denn so, Mrs McNulty?«
»Mir geht es sehr gut, Dr. Grene«, sagte ich. »Das ist aber freundlich von Ihnen, mich zu besuchen.«
»Es ist meine Pflicht, Sie zu besuchen«, entgegnete er. »Ist das Zimmer heute schon geputzt worden?«
»Nein«, antwortete ich. »Aber John wird bestimmt bald hier sein.«
»Das nehme ich auch an«, sagte Dr. Grene.
Dann durchquerte er das Zimmer und sah aus dem Fens ter.
»Heute ist der bislang kälteste Tag des Jahres«, sagte er.
»Bislang«, sagte ich.
»Und haben Sie alles, was Sie brauchen?«
»Im Großen und Ganzen ja«, antwortete ich.
Dann setzte er sich auf mein Bett, als sei es das reinlichste Bett der Christenheit, was ich zu bezweifeln wage, streckte die Beine aus und betrachtete seine Schuhe. Sein langer, ergrauender Bart war scharf wie eine Eisenaxt. Gestutzt wie eine Hecke. Der Bart eines Heiligen. Neben ihm auf dem Bett stand ein Teller, auf dem sich noch die verschmierten Überreste der Bohnen vom Vorabend befanden.
»Pythagoras«, sagte er, »glaubte an die Seelenwanderung und hat uns den Genuss von Bohnen untersagt, damit wir nicht die Seele unserer Großmutter verspeisen.«
»Oh«, machte ich.
»Das kann man bei Horaz nachlesen«, sagte er.
»Gebackene Bohnen von Batchelor?«
»Vermutlich nicht.«
Dr. Grene beantwortete meine Frage mit gewohnt ernster Miene. Das Schöne an Dr. Grene ist, dass er überhaupt keinen Sinn für Humor hat, was ihn fast schon wieder humorvoll wirken lässt. Glauben Sie mir, an einem Ort wie diesem ist das eine schätzenswerte Eigenschaft.
»Also«, sagte er, »Ihnen geht es so weit ganz gut?«
»Ja.«
»Wie alt sind Sie inzwischen, Roseanne?«
»Hundert, glaube ich.«
»Finden Sie es nicht bemerkenswert, dass es Ihnen mit hundert noch so gut geht?«, fragte er, als hätte er zu diesem Umstand irgendwie beigetragen, was er ja vielleicht auch hat. Immerhin bin ich schon seit rund dreißig Jahren, vielleicht noch länger, in seiner Obhut. Dabei ist er selbst alt geworden, wenn auch nicht so alt wie ich.
»Ich finde es äußerst bemerkenswert. Aber, Herr Doktor, ich finde so viele Dinge bemerkenswert. Ich finde Mäuse bemerkenswert, ich finde die seltsamen grünen Sonnenstrahlen bemerkenswert, die durchs Fenster herein klettern. Auch Ihren heutigen Besuch finde ich bemerkenswert.«
»Es tut mir leid zu hören, dass Sie noch immer Mäuse haben.«
»Hier wird es immer Mäuse geben.«
»Aber stellt John denn keine Fallen auf?«
»Das schon, aber er spannt die Sprungfedern nicht richtig, und die Mäuse können den Käse problemlos fressen und entwischen wie Jesse James und sein Bruder Frank.«
Jetzt nahm Dr. Grene seine Augenbrauen zwischen zwei Finger seiner rechten Hand und massierte sie eine Weile. Danach rieb er sich die Nase und stöhnte. Das Stöhnen enthielt all die Jahre, die er in dieser Anstalt verbracht hatte, all die Vormittage seines Lebens hier, all das sinnlose Geschwätz über Mäuse, Behandlungsmethoden und Alter.
»Wissen Sie, Roseanne«, sagte er, »da ich mich unlängst mit der rechtlichen Position aller unserer Insassen befassen musste, von der in der Öffentlichkeit so viel die Rede ist, habe ich mir noch einmal Ihre Aufnahmepapiere angeschaut, und ich muss gestehen –«
All dies sagte er in denkbar gelassenem Tonfall.
Читать дальше