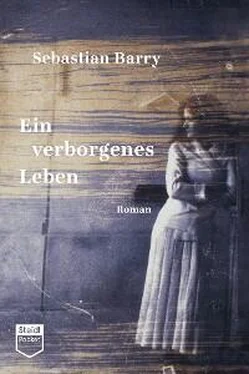In Southampton trug sich eines der wahrhaft majestätischen oder doch eines der wichtigsten Ereignisse seines Lebens zu, insofern er nämlich meine Mutter Cissy kennenlernte, die Zimmermädchen in dem Seemannsheim war, in dem er bevorzugt übernachtete.
Er pflegte eine seltsame Geschichte über Southampton zu erzählen, und als Kind nahm ich sie jedes Mal für bare Münze. Und sie mochte auch durchaus wahr sein.
Als er einmal in den Hafen einlief, fand er in seinem Lieblingsheim kein freies Bett vor und musste die windige Ödnis der Häuserzeilen und Schilder durchstreifen, bis er auf ein einsames Haus stieß, das mit dem Schild »Zimmer frei« Gäste anlockte.
Er ging hinein und wurde von einer graugesichtigen Frau mittleren Alters empfangen, die ihm ein Bett im Keller ihres Hauses anwies.
Mitten in der Nacht wachte er auf, denn er meinte, im Zimmer jemanden atmen gehört zu haben. Erschrocken und in jenem hellwachen Zustand, der eine solche Panik begleitet, vernahm er ein Stöhnen, und neben ihm im Dunkeln lag jemand auf dem Bett.
Mit Hilfe der Zunderbüchse entzündete er seine Kerze. Es war niemand zu sehen. Dann aber sah er, dass die Bettwäsche und die Matratze eingedellt waren, als hätte eine schwere Person darauf gelegen. Er sprang aus dem Bett und rief, bekam aber keine Antwort. Da erst verspürte er in den Tiefen seiner Eingeweide ein grässliches Hungergefühl, wie es seit der Großen Hungersnot noch keinen Iren befallen hatte. Er stürzte zur Tür, die zu seiner Verblüffung jedoch abgeschlossen war. Jetzt war er vollends empört. »Lassen Sie mich raus, lassen Sie mich raus!«, rief er ebenso entsetzt wie entrüstet. Wie konnte die alte Vettel es wagen, ihn einzusperren! Immer wieder hämmerte er gegen die Tür, und schließlich kam die Wirtin und schloss sie in aller Ruhe auf. Sie entschuldigte sich und gab an, sie müsse sie wohl versehentlich gegen Diebe verriegelt haben. Er berichtete ihr von der Störung seiner Nachtruhe, doch sie lächelte ihn nur an, erwiderte nichts und ging wieder zurück in ihre Wohnung. Er hatte den Eindruck, einen eigenartigen Geruch nach Laub, Gestrüpp und Unterholz von ihr aufgefangen zu haben, als wäre sie durch einen Wald gekrochen. Dann trat wieder Stille ein, und er löschte seine Kerze und versuchte zu schlafen.
Kurze Zeit später wiederholte sich der Vorfall. Wieder sprang er auf, entzündete seine Kerze und ging zur Tür. Wieder war sie abgeschlossen! Und wieder dieser tiefe, nagende Hunger in seinem Bauch. Aus irgendeinem Grund, vielleicht wegen ihrer auffallenden Absonderlichkeit, konnte er sich nicht dazu durchringen, die Wirtin herbeizurufen, und schwitzend verbrachte er eine beschwerliche Nacht im Sessel.
Als der Morgen graute, wachte er auf, kleidete sich an und ging zur Tür. Sie war unverschlossen. Er nahm seinen Seesack und ging nach oben. Da erst fiel ihm der heruntergekommene Zustand des Hauses auf, der ihm im freundlicheren Dunkel der Nacht nicht so deutlich gewesen war. Er konnte die Wirtin nicht aus dem Bett holen, und da sein Schiff segelfertig war, musste er das Haus verlassen, ohne sie noch einmal gesehen zu haben. Beim Hinausgehen warf er ein paar Shilling-Münzen auf den Garderobentisch.
Als er draußen auf der Straße noch einmal zum Haus zurückblickte, war er sehr beunruhigt, weil so viele Fensterscheiben zerbrochen waren und auf dem eingesackten Dach Schieferplatten fehlten.
Um im Gespräch mit einem anderen Menschen die Fassung wiederzugewinnen, ging er in den Laden an der Ecke und erkundigte sich bei dem Besitzer nach dem Haus. In dem Haus, sagte dieser, würden bereits seit etlichen Jahren keine Zimmer mehr vermietet, es stünde leer. Eigentlich gehöre es abgerissen, aber es sei eben Bestandteil der Häuserzeile. Er könne die Nacht gar nicht dort zugebracht haben, sagte der Ladenbesitzer. Niemand wohne darin, und niemand würde auch nur im Traum daran denken, es zu kaufen, aus dem einfachen Grund, dass eine Frau dort ihren Ehemann umgebracht hatte, indem sie ihn in einen Kellerraum sperrte und verhungern ließ. Die Frau selbst sei vor Gericht gestellt und wegen Mordes gehenkt worden.
Mein Vater erzählte mir und meiner Mutter diese Geschichte mit der heftigen Gemütsbewegung eines Menschen, der sie beim Erzählen erneut durchlebt. Vor seinem inneren Auge zogen das düstere Haus, die graue Frau, der stöhnende Geist vorüber.
»Nur gut, Joe, dass wir Platz hatten, als du das nächste Mal im Hafen warst«, sagte meine Mutter in ihrem nüchternsten Tonfall.
»Bei Gott, bei Gott, ja«, erwiderte mein Vater.
Eine kleine Geschichte aus dem Leben, eine Matrosengeschichte, die die damit kontrastierende Schönheit meiner Mutter einbezog und die ungeheure Verlockung, die sie damals und auf Dauer für ihn darstellte.
Denn ihre Schönheit war die Schönheit der dunkelhaarigen, dunkelhäutigen Spanierin, mit grünen Augen wie amerikanische Smaragde, gegen die kein Mann gefeit ist.
Und er heiratete sie und nahm sie mit nach Sligo, und fortan verbrachte sie ihr Leben dort. Sie war in diesem Dunkel nicht aufgewachsen, sondern wirkte wie ein verlorener Shilling auf einem Lehmboden, ein Shilling, der verzweifelt glänzt. Ein schöneres Mädchen hatte Sligo nie gesehen, sie hatte federweiche Haut und warme, üppige Brüste wie köstliches, frisch gebackenes Brot.
Die größte Freude meines jungen Lebens bestand darin, bei Einbruch der Dunkelheit mit meiner Mutter auf die Straßen Sligos hinauszulaufen, denn sie ging meinem Vater auf seinem Heimweg von der Arbeit im Friedhof gern entgegen. Erst viele Jahre später, als ich schon größer war, wurde mir im Rückblick klar, dass diesen Gängen eine gewisse Ängstlichkeit innewohnte, als vertraue sie nicht darauf, dass die Zeit und der gewöhnliche Verlauf der Dinge ihn wieder nach Hause führten. Denn ich glaube, eigenartigerweise litt meine Mutter unter dem Nimbus ihrer Schönheit.
Wie ich bereits sagte, war er dort Aufseher, er trug eine blaue Uniform und eine Dienstmütze mit einem Schirm, schwarz wie das Gefieder einer Amsel.
Das war zu der Zeit, als der Erste Weltkrieg tobte und die Stadt so voller Soldaten war, als wäre Sligo selbst ein Schlachtfeld, was natürlich nicht der Fall war. Es waren lediglich Männer auf Heimaturlaub, die wir dort sahen. Aber in ihren Uniformen ähnelten sie durchaus meinem Vater – sodass er, wenn meine Mutter und ich des Wegs kamen und ich ebenso begierig nach ihm Ausschau hielt wie sie, überall in den Straßen aufzutauchen schien. Meine Freude war erst vollkommen, wenn am Ende tatsächlich er es war, der da, etwa an dunklen Winterabenden, vom Friedhof nach Hause geschlittert kam. Und wenn er mich erblickte, spielte er immer mit mir und kasperte herum wie ein Kind. Da erntete er so manchen schiefen Blick, und vielleicht ließ sich sein Verhalten ja auch wirklich nicht mit seiner Würde als Aufseher der Toten von Sligo vereinbaren. Aber er besaß jene seltene Fähigkeit, in Gesellschaft eines Kindes alle Sorgen abzustreifen und in dem fahlen Licht fröhlich und albern zu sein.
Er war Grabwächter, aber er war auch dort er selbst. Mit seiner Schirmmütze und seiner blauen Uniform konnte er jemanden mit hinreichend feierlicher Würde zu der Grabstelle geleiten, in der ein Verwandter oder Freund lag. War er jedoch allein in seinem Friedhofswärterhaus, einem kleinen Tempel aus Beton, so konnte man ihn mit schöner Stimme die Romanze »Im Traume sah ich mich im Marmorsaal« aus Michael Balfes Die Zigeunerin, einer seiner Lieblingsoperetten, singen hören.
Und an freien Tagen schwang er sich auf sein Matchless-Motorrad, um die tückischen Straßen Irlands entlangzurasen. Wenn die Eroberung meiner Mutter als majestätisches Ereignis gelten kann, so war die Tatsache, dass er in einem wirklichen Glücksjahr, etwa um die Zeit meiner Geburt, auf seinem schönen Motorrad die kurze Rennstrecke auf der Isle of Man zurückgelegt hatte, dabei am Leben geblieben, ja sogar auf einem beachtlichen Platz im Mittelfeld gelandet war, eine Quelle unaufhörlicher Erinnerung und Freude und tröstete ihn, da bin ich mir sicher, in seinem von all den schlummernden Seelen umgebenen Betontempel über die trüben Zeiten des irischen Winters hinweg.
Читать дальше