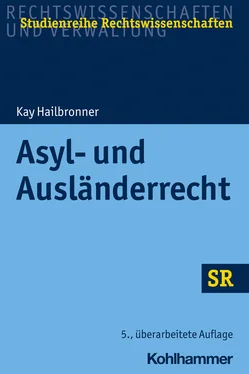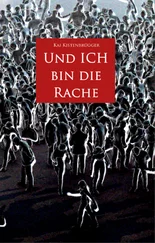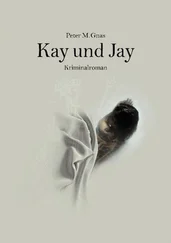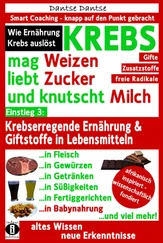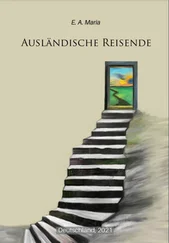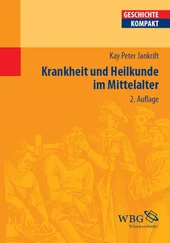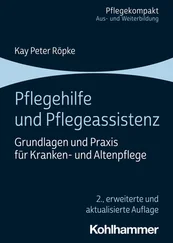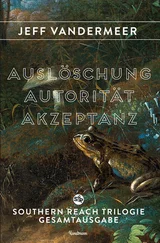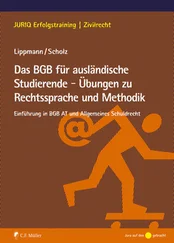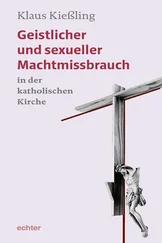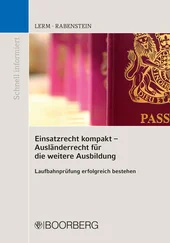VI.Das auf türkische Staatsangehörige anwendbare Recht
28Grundsätzlich fallen türkische Staatsangehörige als Drittstaatsangehörige in den Anwendungsbereich des AufenthG. Allerdings genießen sie nach Maßgabe des Assoziationsabkommens der Türkei mit der EWG und ihren Mitgliedstaaten v. 12.9.1963 1, des Zusatzprotokolls v. 23.11.1970 2und der hierauf ergangenen Assoziationsratsbeschlüsse (ARB) Nr. 1/80 und Nr. 2/76 eine privilegierte aufenthaltsrechtliche Stellung 3. Insbesondere die vom Europäischen Gerichtshof vertretene Auslegung des ARB Nr. 1/80 4über die Entwicklung der Assoziation hat für türkische Staatsangehörige, die mindestens ein Jahr auf dem deutschen Arbeitsmarkt ordnungsgemäß als Arbeitnehmer beschäftigt waren, zu einer weitgehenden aufenthaltsrechtlichen Besserstellung geführt. Nach der Rechtsprechung des EuGH sind die Vorschriften des ARB Nr. 1/80 integraler Bestandteil des Gemeinschaftsrechts und haben daher Vorrang vor dem staatlichen Gesetzesrecht und damit auch Vorrang vor dem AufenthG. Folglich richtet sich die Rechtsstellung der oben genannten türkischen Staatsangehörigen weitgehend nach Assoziationsrecht, soweit sich hieraus Änderungen gegenüber den allgemeinen ausländerrechtlichen Vorschriften ergeben. Zwar enthält ARB Nr. 1/80 unmittelbar keine aufenthaltsrechtlichen Vorschriften, sondern regelt einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt für diejenigen türkischen Arbeitnehmer, die dem „regulären Arbeitsmarkt“ eines Mitgliedstaates angehören. Nach der Rechtsprechung des EuGH folgt hieraus jedoch ein „implizites Aufenthaltsrecht“, das den Vorschriften des allgemeinen Ausländerrechts in Bezug auf die Erteilung befristeter Aufenthaltstitel und aufenthaltsbeendende Maßnahmen vorgeht. Daraus ergeben sich auch wesentliche Änderungen des Rechts der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen gegenüber türkischen Staatsangehörigen, da insoweit nach Auffassung des EuGH weitgehend die für Unionsbürger geltenden Grundsätze über die Beschränkung der Freizügigkeit aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Anwendung finden.
VII.Das Verhältnis der verschiedenen Rechtsquellen zueinander und die Einwirkungen des Völkerrechts auf das innerstaatliche Recht
29Das Verhältnis der verschiedenen Rechtsquellen des Ausländerrechts beurteilt sich nach den allgemeinen Grundsätzen des Verfassungsrechts. Verfassungsrechtliche Prinzipien, insbesondere der Schutz von Ehe und Familie, und rechtsstaatliche Grundsätze wie z. B. das Verhältnismäßigkeitsprinzip gehen anderen ausländerrechtlichen Normen vor. Die in der ausländerrechtlichen Praxis wichtigen Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Länder (Erlasse, Bekanntmachungen, Richtlinien, Rundschreiben) sind keine Rechtsnormen im engeren Sinne, sondern innerdienstliche Anweisungen vorgesetzter Behörden, die im Ausländerrecht vor allem eine einheitliche und gleichmäßige Handhabung der Ermessensvorschriften des AufenthG sicherstellen sollen. Zum AufenthG hat das Bundesministerium des Innern mit Wirkung zum 31.10.2009 die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz (AVwV) 1mit Zustimmung des Bundesrats erlassen. Zum 3. November 2009 traten darüber hinaus die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Freizügigkeitsgesetz/EU 2sowie die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Ausländerzentralregistergesetz 3in Kraft. Die AVwV AufenthG ist aufgrund der zahlreichen Änderungen des Aufenthaltsgesetzes, zuletzt durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz v. 15.8.2019 und das Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht v. 15.8.2019 in weiten Teilen überholt und daher nur noch partiell für die Gesetzesanwendung aussagekräftig. Mangels verbindlicher bundeseinheitlicher Verwaltungsvorschriften sind im Bereich der Länderkompetenzen zur Anwendung des Aufenthaltsgesetzes vielfach Verwaltungsvorschriften für einzelne Bereiche des Ausländerrechts erlassen worden, die im Rahmen der bundesrechtlichen Regelungspielräume die Gesetzesanwendung durch die Ausländerbehörden verbindlich festlegen. Für die Ausländerbehörden der Länder nicht verbindlich sind die Vorläufigen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Inneren, Bau und Heimat zur Anwendung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und zur Umsetzung des Austrittabkommens Vereinigtes Königreich – Europäische Union und diejenigen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Anwendung beschäftigungsrechtlicher Vorschriften, insbesondere zur Ausbildungsduldung und Beschäftigungsduldung.
30Völkerrechtliche Verträge werden regelmäßig nach Art. 59 Abs. 2 GG durch ein Zustimmungsgesetz in das innerstaatliche Recht transformiert und gelten mit dem gleichen Rang wie jedes andere Bundesgesetz. Ausländerrechtlich relevante Regelungen in völkerrechtlichen Verträgen, die in innerstaatliches Recht transformiert worden sind, sind unmittelbar anwendbar, sofern sie hinreichend genau und unbedingt sind, es sei denn, die innerstaatliche Anwendbarkeit ist ausdrücklich ausgeschlossen oder deshalb nicht möglich, weil die Vorschrift nicht hinreichend konkret ist. Im Verhältnis zu Gesetzen ist zunächst zu beachten, dass innerstaatliche Normen im Zweifel im Sinne völkerrechtlicher Verträge auszulegen sind. Es gilt der Grundsatz, dass im Zweifel der Gesetzgeber keinen Konflikt mit völkerrechtlichen Verträgen beabsichtigt. Ist eine vertragskonforme Auslegung nicht möglich, so hat nach allgemeinen Grundsätzen das spätere Gesetz vor dem früheren und das speziellere vor dem allgemeinen Gesetz Vorrang 4. Ausländerrechtliche Bestimmungen enthalten gelegentlich Bestimmungen, wonach abweichende Regelungen in völkerrechtlichen Verträgen unberührt bleiben. Auch das AufenthG lässt eine den Angehörigen von Vertragsstaaten völkerrechtlicher Verträge eingeräumte günstigere Rechtsposition grundsätzlich unberührt.
31Im Verhältnis zum Recht der Europäischen Union gilt der Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts vor allen innerstaatlichen ausländerrechtlichen Vorschriften, insbesondere des AufenthG und des FreizügG/EU. Soweit das FreizügG/EU für Unionsbürger spezifische Regelungen trifft, gelten diese im Allgemeinen als Umsetzung der in einschlägigen Verordnungen und Richtlinien niedergelegten unionsrechtlichen Vorschriften und gehen den allgemeinen Vorschriften vor. Ein Konflikt mit dem Unionsrecht kann sich allerdings daraus ergeben, dass innerstaatliche Vorschriften einschließlich des FreizügG/EU, sei es aufgrund der Bestimmungen der Verträge über die Unionsbürgerschaft oder die Arbeitnehmer-Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit, sei es aufgrund sekundärer Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit von Unionsbürgern, wie sie z. B. in der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38 niedergelegt sind, nicht mehr mit den Anforderungen des Unionsrechts oder einer Entscheidung des EuGH hierzu übereinstimmen. Zwar haben EuGH-Entscheidungen keine über die Parteien des Rechtsstreits hinausgehende unmittelbar bindende Wirkung. Zu beachten ist allerdings, dass der EuGH als authentischer Interpret des Unionsrechts angerufen werden kann, um in einem Vorlage- oder Vertragsverletzungsverfahren über die Vereinbarkeit innerstaatlicher Vorschriften mit dem Unionsrecht verbindlich zu entscheiden. Faktisch ergeben sich daraus Bindungen der Ausländerbehörden und Gerichte, im Einklang mit der EuGH-Rechtsprechung die Vorschriften des deutschen Ausländerrechts jeweils so auszulegen, dass sie dem aktuellen Stand der EuGH-Rechtsprechung entsprechen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass unionsrechtliche Vorschriften des sekundären (abgeleiteten) Rechts mit der EU – Grundrechtecharta und dem sog. primären EU-Recht insbes. dem EU-Vertrag übereinstimmen müssen und im Zweifelsfall in Übereinstimmung mit den für alle EU-Mitgliedstaaten bindenden völkerrechtlichen Vorgaben aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention auszulegen sind 5.
Читать дальше