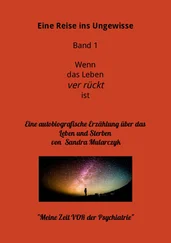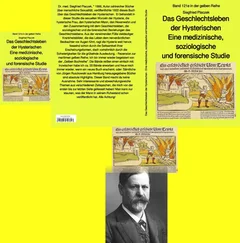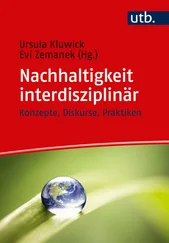Das wohl anerkannteste Merkmal der philosophischen Ethik ist die Universalisierbarkeit einer Norm bzw. des Verfahrens der Erarbeitung von Normen (Singer 1975). Es hat durch Kant (1748–1804) im kategorischen Imperativ die wohl bekannteste Formulierung erfahren: »Handle so, dass die Maxime Deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne« (Kant 1945, S. 42, § 7 Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft). Der kategorische Imperativ ist unabhängig von den daraus resultierenden Folgen anzuwenden, denn dieser zielt auf die Achtung der Interessen und Rechte anderer ab und sichert zu, dass ein jeder darauf zu achten hat. Ein Lügner z. B. behandelt andere Menschen bloß als Mittel und nicht als Zweck. Das ist für Kant nichts anderes als die »Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde«. Jede noch so kleine Notlüge ist ein Anschlag auf das ganz ethische Gebäude eines Staates. Lässt man auch nur eine Annahme zu, bricht alles zusammen. Kants berühmtestes Beispiel lässt deutlich werden, was die Konsequenzen dieses Handelns sein können: Ein Mann, der fürchtet, ermordet zu werden, flüchtet sich in das Haus seines besten Freundes. Plötzlich steht der potenzielle Mörder vor der Tür und fragt den besten Freund, ob der Mann anwesend sei. Folgt man Kant, muss der Freund auch in dieser Situation wahrhaftig, also mit einem »Ja« antworten, was rechtlich nicht haltbar ist (Kant 1797). Damit gilt der kategorische Imperativ, ohne auf die Konsequenzen zu achten, und ist keine empirische Erkenntnis. Er gilt a priori aus Vernunftgründen. Die Verbote zu töten, zu lügen usw. gelten, weil ohne sie kein Zusammenleben in sozialen Systemen möglich wäre. Dennoch gibt es Ausnahmesituationen, in denen diese allgemeinen Maximen nicht angewandt werden dürfen, und das bedarf einer guten Begründung (Gert 1983).
Demgegenüber haben Jeremy (1748–1832) und John (1806–1873) einen utilitaristischen Ansatz als Form einer zweckorientierten Ethik entwickelt und das empirische Kriterium der Maximierung des Gemeinwohls für die Etablierung von Normen vorgeschlagen. Die Maximierung des Gemeinwohls meint die Summe aller individuellen hedonistischen Folgen und kann anhand von Lust und Leid oder Nutzen und Kosten ermittelt werden. D. h., es geht nicht in erster Linie um die Richtigkeit der Handlung, sondern um die Folgen oder die Ergebnisse der Handlung. In der Weiterentwicklung des Utilitarismus ist wiederum das Universalisierbarkeitsprinzip der Gerechtigkeit integriert worden, das verhindern soll, dass die Maximierung des Gemeinwohls auf Kosten von Einzelnen einer sozialen Gruppe oder Minderheiten gehen soll. Vilfredo Pareto (1848–1923) forderte auf dieser Basis eine Wirtschaftsordnung, die niemanden schlechter stellen darf (Posner 1987).
In der Theorie der Gerechtigkeit geht es um die Konzeption einer sozialpolitischen Grundordnung, die auf dem Wert der Gleichheit beruht. John Rawls (1921–2002) war amerikanischer Philosoph und gilt als einer der wichtigsten Vertreter dieser Theorie des egalitären Liberalismus. Darin versucht Rawls, liberale und wohlfahrtsstaatliche Gedanken miteinander zu verknüpfen, und wendet sich damit gegen den Utilitarismus. Stattdessen beschreibt er zwei Grundsätze (Rawls 1979):
1. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.
2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheitensind so zu gestalten, dass (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offenstehen.
Die Diskurstheorien, die u. a. von Jürgen Habermas (*1929) entwickelt und vertreten wurden, wollen das Gute bzw. das Richtige nicht inhaltlich bestimmen, sondern basieren auf der Annahme, dass in einem idealen Diskurs das moralisch Richtige konsensuell gefunden wird. Für diesen Diskurs sind universalistisch begründete normative Voraussetzungen der Diskursteilnehmer und Verfahrensweisen definiert. Dazu gehören z. B. der Verzicht auf Herrschafts- und Autoritätsansprüche, die Beschränkung der Einflussnahme auf die Darlegung von Argumenten, die Verständigungsbereitschaft und Informiertheit der Teilnehmer, die in der Lage und bereit sein müssen, alle vorgetragenen Argumente und Optionen zu verstehen (Montada 2002).
Vor diesem Hintergrund lässt sich sagen, dass moralische Systeme ineinandergreifende Zusammenstellungen von Werten, Tugenden, Normen, Gebräuchen, Identitäten, Institutionen, Technologien und entwickelten psychischen Mechanismen sind. Diese wirken zusammen, um Selbstsucht zu unterdrücken oder zu regulieren und soziales Leben zu ermöglichen (Haidt 2010). Trotz einiger kultureller Unterschiede haben diese wohl universellen Charakter und sind in folgende Moralmodule einteilbar (Haidt & Joseph 2004):
• Leiden (Es ist gut, anderen zu helfen und ihnen nicht zu schaden)
• Gegenseitigkeit (dieses führt zu einem Sinn für Fairness)
• Rangordnung (Respekt vor Älteren und legitimen Autoritätspersonen)
• Bündnisse (Loyalität gegenüber der eigenen Gruppe)
• Reinheit (Lob der Sauberkeit, Vermeidung von Verunreinigung).
Bezogen darauf handelt nur der Mensch moralisch, welcher Werte und moralische Normen als wichtige Facetten seines Selbstbildes erworben hat und sich dazu emotional verhalten kann. Erst dann werden diese handlungsleitend. Damit ist moralisches Engagement auch im Längsschnitt des Lebens verlässlich, wenn es der persönlichen Identität entspricht, und kann kontextabhängig eingesetzt werden (Montada 2002).
Die Hauptaufgabe der Rechtsphilosophie ist die Klärung, was das Recht eigentlich ist, und hat ihre Anfänge in der Antike. Seitdem stehen sich zwei große Denkrichtungen, die die Voraussetzungen für eine Rechtsordnung definieren, gegenüber. Die Naturrechtstheorie geht von der Existenz eines von menschlichen Interessen und Idealen vorgegebenen, absolut geltenden Sittengesetzes aus (  Kap. 2.4.1). Die zweite Richtung, und zwar die des Rechtspositivismus, betrachtet Rechtsnorm und Rechtsordnung primär als empirische Gegebenheiten der sozialen Wirklichkeit. Dabei nehmen die Vertreter dieser Richtung eine begriffliche Trennung zwischen Recht und Moral vor. Ob eine bestimmte Norm mit gewissen moralischen Anforderungen übereinstimmt, erscheint ihnen für ihren Rechtscharakter unerheblich (Hoerster 2016). Wenn man allerdings Recht und Moral nicht miteinander in Beziehung setzen möchte, muss man sich als Rechtspositivist mit Begriffen wie Macht, Zwang und Gewalt auseinandersetzen, wobei innerhalb der Denkrichtung keine Einigkeit besteht. Drei Hauptvertreter dieser Richtung sind John Austin (1790–1859), Hans Kelsen (1881–1973) und H.L.A. Hart (*1907). Allen dreien gemeinsam war die Idee, zu der naturrechtlich-moralbehafteten Konzeption des Rechtsbegriffs eine konstruktive Alternative auszuarbeiten. Bei John Austin nahm der Begriff des Befehls in der Analyse des Rechtsbegriffs eine zentrale Rolle ein. Für ihn sind alle Rechtsnormen Befehle eines politischen Souveräns und Befehle sind mit einer Übelandrohung verbundene Willensäußerungen. Da unklar blieb, wie aus einem Befehl als eine rechtliche Verbindlichkeit ein Sollen abzuleiten ist, modifizierte Hans Kelsen die Befehlstheorie. Er schlussfolgerte, dass die Gültigkeit oder Verbindlichkeit einer Norm durch nichts anderes als eine weitere, höherrangige Norm begründet werden kann. So kam er zu dem Ergebnis einer höchsten, hierarchisch aufgebauten Rechtsordnung, die als ganze legitimierende Grundnorm gelten kann. Allerdings ist in seinem Denkmodell der Zwang zur Charakterisierung des Rechts nicht weniger wichtig. Hier richten sich die einzelnen Rechtsnormen nicht allgemein an den Bürger (indem sie ihm unter Androhung eines Zwangsaktes ein bestimmtes Verhalten abverlangen), sondern an die staatliche Amtsperson (indem sie ihr zum Vollzug eines Zwangsaktes ein Gebot oder eine Ermächtigung erteilen). H.L.A. Hart führt dazu aus, dass sich eine Rechtsordnung im Normalfall nur als System von zwei sehr unterschiedlichen Typen von Normen adäquat verstehen lässt. Es gibt für ihn die primären Normen, die jemanden zu etwas verpflichten und die sekundären Normen, die jemanden zu etwas Befugnis verleihen. An der Spitze steht in diesem System immer eine sekundäre Norm, die ein bestimmtes Organ zum Erlass weiterer Normen befugt oder ermächtigt. Diese höchste Norm einer Rechtsordnung gilt jedoch nicht Kraft einer vorausgesetzten Grundnorm wie bei John Austin, sondern einfach aus dem Grund, weil sie de facto innerhalb der betreffenden Gesellschaft von den Amtspersonen zur Regelung des Rechtslebens akzeptiert wird (Hoerster 2016).
Kap. 2.4.1). Die zweite Richtung, und zwar die des Rechtspositivismus, betrachtet Rechtsnorm und Rechtsordnung primär als empirische Gegebenheiten der sozialen Wirklichkeit. Dabei nehmen die Vertreter dieser Richtung eine begriffliche Trennung zwischen Recht und Moral vor. Ob eine bestimmte Norm mit gewissen moralischen Anforderungen übereinstimmt, erscheint ihnen für ihren Rechtscharakter unerheblich (Hoerster 2016). Wenn man allerdings Recht und Moral nicht miteinander in Beziehung setzen möchte, muss man sich als Rechtspositivist mit Begriffen wie Macht, Zwang und Gewalt auseinandersetzen, wobei innerhalb der Denkrichtung keine Einigkeit besteht. Drei Hauptvertreter dieser Richtung sind John Austin (1790–1859), Hans Kelsen (1881–1973) und H.L.A. Hart (*1907). Allen dreien gemeinsam war die Idee, zu der naturrechtlich-moralbehafteten Konzeption des Rechtsbegriffs eine konstruktive Alternative auszuarbeiten. Bei John Austin nahm der Begriff des Befehls in der Analyse des Rechtsbegriffs eine zentrale Rolle ein. Für ihn sind alle Rechtsnormen Befehle eines politischen Souveräns und Befehle sind mit einer Übelandrohung verbundene Willensäußerungen. Da unklar blieb, wie aus einem Befehl als eine rechtliche Verbindlichkeit ein Sollen abzuleiten ist, modifizierte Hans Kelsen die Befehlstheorie. Er schlussfolgerte, dass die Gültigkeit oder Verbindlichkeit einer Norm durch nichts anderes als eine weitere, höherrangige Norm begründet werden kann. So kam er zu dem Ergebnis einer höchsten, hierarchisch aufgebauten Rechtsordnung, die als ganze legitimierende Grundnorm gelten kann. Allerdings ist in seinem Denkmodell der Zwang zur Charakterisierung des Rechts nicht weniger wichtig. Hier richten sich die einzelnen Rechtsnormen nicht allgemein an den Bürger (indem sie ihm unter Androhung eines Zwangsaktes ein bestimmtes Verhalten abverlangen), sondern an die staatliche Amtsperson (indem sie ihr zum Vollzug eines Zwangsaktes ein Gebot oder eine Ermächtigung erteilen). H.L.A. Hart führt dazu aus, dass sich eine Rechtsordnung im Normalfall nur als System von zwei sehr unterschiedlichen Typen von Normen adäquat verstehen lässt. Es gibt für ihn die primären Normen, die jemanden zu etwas verpflichten und die sekundären Normen, die jemanden zu etwas Befugnis verleihen. An der Spitze steht in diesem System immer eine sekundäre Norm, die ein bestimmtes Organ zum Erlass weiterer Normen befugt oder ermächtigt. Diese höchste Norm einer Rechtsordnung gilt jedoch nicht Kraft einer vorausgesetzten Grundnorm wie bei John Austin, sondern einfach aus dem Grund, weil sie de facto innerhalb der betreffenden Gesellschaft von den Amtspersonen zur Regelung des Rechtslebens akzeptiert wird (Hoerster 2016).
Читать дальше
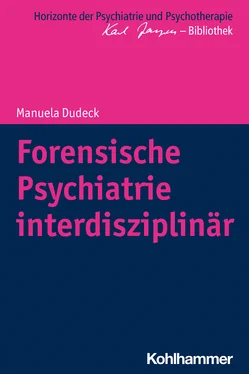
 Kap. 2.4.1). Die zweite Richtung, und zwar die des Rechtspositivismus, betrachtet Rechtsnorm und Rechtsordnung primär als empirische Gegebenheiten der sozialen Wirklichkeit. Dabei nehmen die Vertreter dieser Richtung eine begriffliche Trennung zwischen Recht und Moral vor. Ob eine bestimmte Norm mit gewissen moralischen Anforderungen übereinstimmt, erscheint ihnen für ihren Rechtscharakter unerheblich (Hoerster 2016). Wenn man allerdings Recht und Moral nicht miteinander in Beziehung setzen möchte, muss man sich als Rechtspositivist mit Begriffen wie Macht, Zwang und Gewalt auseinandersetzen, wobei innerhalb der Denkrichtung keine Einigkeit besteht. Drei Hauptvertreter dieser Richtung sind John Austin (1790–1859), Hans Kelsen (1881–1973) und H.L.A. Hart (*1907). Allen dreien gemeinsam war die Idee, zu der naturrechtlich-moralbehafteten Konzeption des Rechtsbegriffs eine konstruktive Alternative auszuarbeiten. Bei John Austin nahm der Begriff des Befehls in der Analyse des Rechtsbegriffs eine zentrale Rolle ein. Für ihn sind alle Rechtsnormen Befehle eines politischen Souveräns und Befehle sind mit einer Übelandrohung verbundene Willensäußerungen. Da unklar blieb, wie aus einem Befehl als eine rechtliche Verbindlichkeit ein Sollen abzuleiten ist, modifizierte Hans Kelsen die Befehlstheorie. Er schlussfolgerte, dass die Gültigkeit oder Verbindlichkeit einer Norm durch nichts anderes als eine weitere, höherrangige Norm begründet werden kann. So kam er zu dem Ergebnis einer höchsten, hierarchisch aufgebauten Rechtsordnung, die als ganze legitimierende Grundnorm gelten kann. Allerdings ist in seinem Denkmodell der Zwang zur Charakterisierung des Rechts nicht weniger wichtig. Hier richten sich die einzelnen Rechtsnormen nicht allgemein an den Bürger (indem sie ihm unter Androhung eines Zwangsaktes ein bestimmtes Verhalten abverlangen), sondern an die staatliche Amtsperson (indem sie ihr zum Vollzug eines Zwangsaktes ein Gebot oder eine Ermächtigung erteilen). H.L.A. Hart führt dazu aus, dass sich eine Rechtsordnung im Normalfall nur als System von zwei sehr unterschiedlichen Typen von Normen adäquat verstehen lässt. Es gibt für ihn die primären Normen, die jemanden zu etwas verpflichten und die sekundären Normen, die jemanden zu etwas Befugnis verleihen. An der Spitze steht in diesem System immer eine sekundäre Norm, die ein bestimmtes Organ zum Erlass weiterer Normen befugt oder ermächtigt. Diese höchste Norm einer Rechtsordnung gilt jedoch nicht Kraft einer vorausgesetzten Grundnorm wie bei John Austin, sondern einfach aus dem Grund, weil sie de facto innerhalb der betreffenden Gesellschaft von den Amtspersonen zur Regelung des Rechtslebens akzeptiert wird (Hoerster 2016).
Kap. 2.4.1). Die zweite Richtung, und zwar die des Rechtspositivismus, betrachtet Rechtsnorm und Rechtsordnung primär als empirische Gegebenheiten der sozialen Wirklichkeit. Dabei nehmen die Vertreter dieser Richtung eine begriffliche Trennung zwischen Recht und Moral vor. Ob eine bestimmte Norm mit gewissen moralischen Anforderungen übereinstimmt, erscheint ihnen für ihren Rechtscharakter unerheblich (Hoerster 2016). Wenn man allerdings Recht und Moral nicht miteinander in Beziehung setzen möchte, muss man sich als Rechtspositivist mit Begriffen wie Macht, Zwang und Gewalt auseinandersetzen, wobei innerhalb der Denkrichtung keine Einigkeit besteht. Drei Hauptvertreter dieser Richtung sind John Austin (1790–1859), Hans Kelsen (1881–1973) und H.L.A. Hart (*1907). Allen dreien gemeinsam war die Idee, zu der naturrechtlich-moralbehafteten Konzeption des Rechtsbegriffs eine konstruktive Alternative auszuarbeiten. Bei John Austin nahm der Begriff des Befehls in der Analyse des Rechtsbegriffs eine zentrale Rolle ein. Für ihn sind alle Rechtsnormen Befehle eines politischen Souveräns und Befehle sind mit einer Übelandrohung verbundene Willensäußerungen. Da unklar blieb, wie aus einem Befehl als eine rechtliche Verbindlichkeit ein Sollen abzuleiten ist, modifizierte Hans Kelsen die Befehlstheorie. Er schlussfolgerte, dass die Gültigkeit oder Verbindlichkeit einer Norm durch nichts anderes als eine weitere, höherrangige Norm begründet werden kann. So kam er zu dem Ergebnis einer höchsten, hierarchisch aufgebauten Rechtsordnung, die als ganze legitimierende Grundnorm gelten kann. Allerdings ist in seinem Denkmodell der Zwang zur Charakterisierung des Rechts nicht weniger wichtig. Hier richten sich die einzelnen Rechtsnormen nicht allgemein an den Bürger (indem sie ihm unter Androhung eines Zwangsaktes ein bestimmtes Verhalten abverlangen), sondern an die staatliche Amtsperson (indem sie ihr zum Vollzug eines Zwangsaktes ein Gebot oder eine Ermächtigung erteilen). H.L.A. Hart führt dazu aus, dass sich eine Rechtsordnung im Normalfall nur als System von zwei sehr unterschiedlichen Typen von Normen adäquat verstehen lässt. Es gibt für ihn die primären Normen, die jemanden zu etwas verpflichten und die sekundären Normen, die jemanden zu etwas Befugnis verleihen. An der Spitze steht in diesem System immer eine sekundäre Norm, die ein bestimmtes Organ zum Erlass weiterer Normen befugt oder ermächtigt. Diese höchste Norm einer Rechtsordnung gilt jedoch nicht Kraft einer vorausgesetzten Grundnorm wie bei John Austin, sondern einfach aus dem Grund, weil sie de facto innerhalb der betreffenden Gesellschaft von den Amtspersonen zur Regelung des Rechtslebens akzeptiert wird (Hoerster 2016).