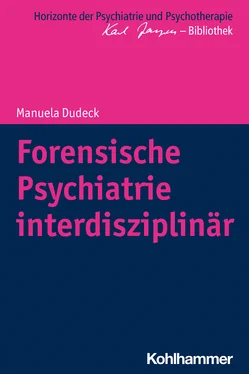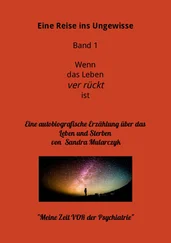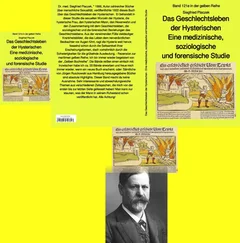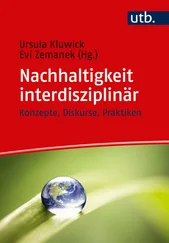Manuela Dudeck - Forensische Psychiatrie interdisziplinär
Здесь есть возможность читать онлайн «Manuela Dudeck - Forensische Psychiatrie interdisziplinär» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Forensische Psychiatrie interdisziplinär
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Forensische Psychiatrie interdisziplinär: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Forensische Psychiatrie interdisziplinär»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Forensische Psychiatrie interdisziplinär — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Forensische Psychiatrie interdisziplinär», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
2.3 Die Funktion von Ritualen, Religion und Religiosität
2.3.1 Rituale
Der religiöse Glaube und die dazugehörigen Rituale scheinen Anpassungen zu sein, deren Nutzen in der augenblicklichen Integration des Individuums in der Gruppe besteht, die ihm Bestrafungen erspart, die diejenigen widerfahren, die von den Bräuchen abweichen. Das sind in der Regel Menschen mit antisozialen Verhaltensweisen, die im Interesse der Gruppe kontrolliert werden müssen.
Das Wort Ritual wird etymologisch auf Lateinisch ritualis zurückgeführt (Dücker 2007). Der Terminus des Rituals ist in der abendländischen Kultur ein verbindlich festgelegter Begriff, der in lateinischer Form im religiösen Bereich für symbolisches Handeln steht. Besonders bekannt war er in allen katholischen Ländern durch seinen Einsatz als Überschrift einer kirchenrechtlich verbindlichen Regelsammlung Rituale romanum von 1614 (Flores Arcas & Sodi 2004). Rituale werden von Ritualwissenschaftlern erforscht, die die deskriptiven und funktionalen Merkmale zusammenstellen. Dazu gehört zuerst die Sequenzierung, d. h. der gesamte rituelle Prozess wird in Makro- und Mikrorituale aufgeschlüsselt. Durch ein starres Ablaufschema, das an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden kann, entsteht eine Stereotypie. Sprechhandlungen in feststehenden Wendungen, z. B. Gebete, geben dem Ritual die gewollte Formalität. Durch die Reduktion von Komplexität und die Verdichtung insbesondere auch durch Redundanz wird das Ritual auf eine einzige Wertekategorie festgelegt und der Einzelne darauf eingeschworen. Das rituelle Bewusstsein wird durch die Feierlichkeit unterstützt, die wiederum durch die Wahl des Ortes und der Kleidung bedient wird. Indem die rituellen Handlungen immer wieder aus den gleichen Anlässen wiederholt werden, werden die Rituale repetitiv eingeschliffen und jedes Individuum lernt diese so kennen und auch sich daran zu halten. Rituale müssen, wenn sie wirksam sein sollen, öffentlich und jedem zugänglich sein. Die dramatische Struktur eines Rituals und die Teilnahme aller in einer Gruppe mit den dazugehörigen Rollen bedingt eine Zugehörigkeit zur Gruppe. Rituale sind grundsätzlich selbstreferentiell, denn sie werden von Teilnehmern für die Teilnehmer inszeniert und gelten sowohl für die, die Rituale vollziehen und für die, die diese inszenieren. Zusammengefasst haben Rituale auch eine ästhetische Dimension und stellen die Schnittstelle zwischen Kollektiv und dem Individuum dar. So dienen sie zur Herstellung von Gemeinschaft, zur Vermittlung von Dispositionen zu Anschlusshandlungen in der Zukunft im nichtrituellen Bereich (Tambiah 1979, Braungart 1992, Humphrey & Laidlaw 1994).
Ritualtheoretisch kann man intentionales von nichtintentionalem Handeln unterscheiden (Humphrey & Laidlaw 1994). Als intentional gilt der Entschluss eines Individuums, ein Ritual auszuführen oder daran teilzunehmen; nicht intentional sind Handlungen, die allein durch die Teilnahme erforderlich sind, weil diese schon immer festliegen.
Dadurch, dass Rituale die Werte der eigenen Gemeinschaft mit dem Gestus von Bestätigung und Verpflichtung sichtbar machen, fördern diese auf der einen Seite deren Zusammenhalt und Kontinuität (Binnenintegration), auf der anderen Seite markieren sie notwendig eine Grenze nach innen (Regelverstöße) und gegenüber anderen Formationen nach außen. Insofern gehören Integration und Abgrenzung zu den zentralen Funktionen ritueller und ritualisierter Handlungsformen.
Rituale sind also Ausdruck symbolischen Handelns, werden als diese auch genutzt und stellen darüber hinaus einen kulturellen Ordnungsfaktor dar. Aus ritualwissenschaftlicher Perspektive werden Rituale für die Herstellung, Gestaltung und Erhaltung kollektiv anerkannter und verbindlicher symbolischer Ordnungssysteme von Interessengruppen genutzt. Symbolische Handlungen sollen einen konfliktfreien Ablauf des sozialen Lebens einer Gemeinschaft und deren Fortbestand gewährleisten, aber auch den dafür erforderlichen Bedarf an Dynamik und Transformation bereitstellen. Diese sollen zu bestimmten Anschlusshandlungen motivieren und andere verhindern. Zu den wohl ordnungspolitisch sensibelsten Aufgaben gehören dabei die Wahl von Repräsentanten wie Häuptling, Kaiser, Stadtrat, Richter etc. Darüber hinaus muss die Versorgung und die Reproduktion des Nachwuchses gesichert werden. Krankheiten müssen abgewehrt und die Gesundheit einer Gruppe muss wiederhergestellt werden. Über allem steht die Sicherung der inneren und äußeren Souveränität der Gruppe. Alles das bedarf einer Vielzahl von Ritualen. Rituelle Handlungen legitimieren so zweckrationale Handlungen, indem sie diese durch die Anrufung einer Werteinstanz überhöhen und ihnen so die Grundlage kollektiver Verbindlichkeit geben. Daher sind sie in Gesellschaften mit kodifiziertem Recht zwar fakultativ, was aber ihrer Anwendung in der Regel keinen Abbruch tut. So hat der »erste Spatenstich« für den Bau eines Gefängnisses weder eine juristische noch eine sachliche Bedeutung, wohl aber die der sichtbar gemachten Legitimation des Projektes selbst (Dücker 2007). Rituale sind Handlungen, die man auf allen Sinnesebenen wahrnehmen kann (wie hören, sehen, fühlen), insofern haben sie Einfluss auf das Individuum und machen die gewählte Ordnung einer Gesellschaft sichtbar und erfahrbar. Den Akteuren bieten Rituale die Gelegenheit, sich in gewünschter Art und Weise darzustellen und sie versichern die Öffentlichkeit der Kontinuität der Ordnung. Letztendlich vollziehen sie die Geschichte einer Gruppe. Rituale machen also keinen Sinn, sie sind der Sinn (Braungart 1992). Zwischen rituellen Handlungen und Werten besteht eine sehr enge Verknüpfung. Dementsprechend dienen diese direkt der Nutzen- und Normenvermittlung. Aus soziologischer Sicht ist Handeln im sozialen System an Normen gebunden, welche durch Rituale immer und immer wieder überprüft werden können. Am Ende sind Rituale auch ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor und haben eine große ökonomische Bedeutung, die bereits im Alten Testament sichtbar wurde. In der aktuellen Politik werden für Gipfeltreffen Millionen im zweistelligen Bereich ausgegeben und sichern die Macht der Souveräne.
2.3.2 Religion und Religiosität
Obwohl eine der provokantesten Prognosen der Moderne besagt, dass Religion als das in der Menschheitsgeschichte erste »primitive« Stadium bald verschwinden werde, zeigt sich, dass Religion nach wie vor einen Mechanismus darstellt, einen prosozialen Verhaltenskodex zu definieren (Montada 2002, Sosis 2004). Religiosität beschreibt das subjektive Erleben des Einzelnen in Bezug auf eine Religion. Forschungsergebnisse konnten zeigen, dass ein höherer Grad an Religiosität mit einer stärker ausgeprägten Selbstkontrolle zusammenhängen kann (Laird 2011, Reisig 2012, Rounding 2012). Es besteht weitestgehend Einigkeit darüber, dass ein höheres Maß an Religiosität (ob nun durch verhaltensbasierte Messinstrumente oder durch Selbstberichte erfasst) in einem negativen Zusammenhang mit Delinquenz und strafrechtlich relevantem Verhalten wie Drogenkonsum steht, obwohl fast ausschließlich Heranwachsende untersucht wurden (Chitwood et al. 2008, Johnson & Jang 2011, Kelly et al. 2015). Franke und Kollegen konnten anhand einer Stichprobe männlicher, suchtkranker Maßregelpatienten zeigen, dass das Ausmaß an Religiösität auch hier negativ mit der Einstellung gegenüber appetitiver Aggression korreliert, leider aber nicht mit dem tatsächlichen Verhalten. In der Stichprobe weiblicher, suchtkranker Maßregelpatientenwurden keinerlei signifikante Zusammenhänge gefunden (Franke et al. 2019).
Evolutionär betrachtet, stellt sich im Hinblick auf Religion zunächst die Frage, warum diese überhaupt existiert und sich über alle Zeiten hinweg als kulturelle Variable identifizieren lässt (Boyer & Bergstrom 2008). Offensichtlich stellt diese einen Nutzen für die Angepasstheit von Menschen in einer sozialen Gruppe dar (McCullough & Carter 2013). Religion stärkt die soziale Kohäsion, indem eine emotionale, kognitive und kulturelle Synchronisation erfolgt. Nebenher wird die soziale Kooperation gefördert und die Konkurrenzfähigkeit nach außen gefestigt. Religiöse Glaubenssysteme, Institutionen und Rituale ko-evolvierten mit der Entstehung von Gesellschaften, die größer waren als die in der Periode der Jäger und Sammler üblichen blutsverwandten Stämme, welche selten eine Zahl von 150 Mitgliedern überschritten (Dunbar 2003, Norenzayan & Shariff 2008, Henrich et al. 2010). McCullough und Carter (2013, 2014) argumentierten, dass der Übergang vom nomadischen Jäger- und Sammler-Lebenswandel in kleinen Gruppen zum sesshaften Siedler- und Ackerbauer-Lebenswandel in großen, dauerhaften Siedlungen einen evolutionären Druck erzeugte, das eigene Verhalten stärker zu kontrollieren. Nur durch die Entwicklung von Fähigkeiten wie Kooperieren, Tolerieren und Warten konnte eine gewisse Ordnung hergestellt und aufrechterhalten werden. Eine Kooperation in großen Gruppen, die nicht ausschließlich aus Blutsverwandten zusammengesetzt ist, erfordert zwingend die Lösung für das sogenannte Trittbrettfahrerproblem (Gintis et al. 2003, McNamara 2006). Trittbrettfahrer bzw. Nutznießer sind Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft, welche die durch die Kooperation erzeugten Vorteile zwar nutzen, aber selbst nichts zur Kooperation beitragen (McNamara 2006). Trittbrettfahren ist überall dort von Bedeutung, wo es öffentliche Güter gibt. Beispiele für öffentliche Güter waren früher Deiche, etwaige Befestigungsanlagen einer Siedlung oder der Zugang zum Wildbestand in einem bestimmten Gebiet (vorausgesetzt, die Jagd war jedem gestattet). Die Bereitstellung öffentlicher Güter kann als grundlegendste Aufgabe einer Gesellschaft angesehen werden (Olson 1968), sie stellt einen wesentlichen Faktor dar, der, evolutionär gesehen, die Entwicklung vom Nomaden zum Siedler ermöglicht hat. Öffentliche Güter zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass von ihrer Nutzung kein Mitglied der Gesellschaft ausgeschlossen werden kann (Samuelson 1954). Hieraus ergibt sich, dass dem Käufer dieses Gutes kein Eigentumsrecht daran zugewiesen wird; jedes andere Mitglied der betreffenden Gesellschaft kann das Gut ebenfalls nutzen, weil es Teil der Gesellschaft ist (Olson 1968). Diese Eigenschaft ermöglicht erst das Trittbrettfahren und ist im eigentlichen Sinne antisozial. Je größer eine Gruppe ist, desto weniger wird das Trittbrettfahren kontrollierbar und desto häufiger wird es beobachtet (Ledyard 1995).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Forensische Psychiatrie interdisziplinär»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Forensische Psychiatrie interdisziplinär» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Forensische Psychiatrie interdisziplinär» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.