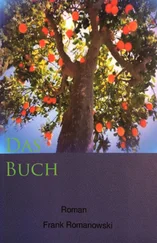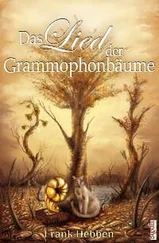Der Mann fuhr beim Ausruf seines Namens zusammen. »Wer zum Teufel bist du?«, fragte er.
Damion dehnte die Pause aus. Dann sagte er: »Ein Freund, Ángel.«
»Was willst du?«
»Dir ein Angebot unterbreiten.«
Ein Söldner trat aus dem Schatten hervor und fluchte. »Der Typ nervt. Machen wir ihn kalt.«
Ángel schleuderte ihn zurück. Seine Augen glichen tiefen Gräben, aus deren Dunkel Blitze aufschossen. »Nein«, keifte er. »Ich will wissen, was er zu sagen hat.«
EIN LUFTZUG wehte Fernanda eine Strähne aus der Stirn. Sie blickte zum felsigen Eingang einer unterirdischen Höhle, dann in das missmutige Gesicht ihres Gegenübers, forschte nach einer kurzen Notiz, einem Nicken, nach etwas, das sie darin bestärkt hätte, weitergehen zu können. Sie war aufgeregt. Allein bis hierher hatte sich der Weg als recht beschwerlich erwiesen. Vor drei Tagen hatte ihr Begleiter, Adrian Chan Sánchez, ein die Kultur der Maya ehrender Wissenschaftler der Universität Oriente in Valladolid, eine Korallenschlange vor der Kalksteinhöhle gesichtet. »Jeder Eingang hat einen eigenen Wächter«, hallte sein Orakelspruch in ihr nach. Drei Nächte hatten sie im Dschungel kampiert und Zeremonien zur Besänftigung der Geister abgehalten. Den Mayas galten die Unterwasserhöhlen als heilig, sie verehrten die Cenotes als Tore zur Unterwelt, das wusste Fernanda. Dennoch war sie erstaunt darüber, wie viel Ehrfurcht der Wissenschaftler dem auserkorenen Wächter entgegengebracht hatte.
»Die Passage ist offen«, erklärte Adrian, und nickte ihr zu. Ein kleiner Lustschauer rieselte ihr über den Rücken, wohl Ausdruck des menschlichen Instinkts, wie sie glaubte, wenn es eine Schwelle zu überqueren gilt, ohne dass man die Folgen überblicken kann. Sie schulterten ihre Rucksäcke mit den Tauchgeräten und gingen durch den steinernen Korridor auf die kreisrunde Cenote zu. Die Sonne drang dünn durch den Spalt im Felsen ein, ihre Kraft verlor sich, die Farben verdämmerten. Die Enge der Felsenschlucht presste die beiden vorwärts, bis sie eine Senke erreichten. Vor ihnen tat sich ein mit türkisfarbenem Wasser gefülltes Erdloch auf. Es ähnelte einem überdimensionalen marmornen Taufbecken, war von Pflanzen und Wurzeln umwuchert. Wortlos zogen sie ihre Ausrüstung über, glitten ins Wasser; eine letzte Kontrolle, dann sanken beide in die Tiefe. Stufe um Stufe drang Stille in Fernanda ein. Nur wenige Meter vergingen, schon hielt die Cenote sie gefangen. Fernanda hatte das Gefühl, hinter die Zeit zu gelangen. Sie folgte dem verlockenden Ruf der Höhle, tauchte an Steinen, Schatten und versunkenen Bäumen vorbei; folgte den engen, sich stets weiterverzweigenden Röhren im Gestein und tastete sich voller Lust immer tiefer hinein in den Bauch der Höhle, vorbei an weiteren Öffnungen, die sich plötzlich über ihr auftaten und das grandiose Spiel des Lichtes aufblitzen ließen. Nie hatte sie sich der menschlichen Sphäre ferner gefühlt. Schwerelos, schwebend, endlich undefiniert: ein kleines Nichts im Weltenraum.
Plötzlich flimmerte ihre Lampe und erlosch. Etwas Glitschiges streifte ihr Gesicht, ihr Atem beschleunigte sich, ging flacher. Sie geriet in Panik, glaubte, dass es ihr an Luft fehle, sie schlug um sich, biss auf den Bügel in ihrem Mund. Ihre Bewegungen wurden hastiger, sie ermahnte sich, kontrollierter zu atmen – tiefer – und die Luft aus der Lunge zu pressen, sie tauchte in vollkommener Dunkelheit weiter vorwärts und konzentrierte sich auf einen einzigen Gedanken: keine Panik! Langsam, Atemzug für Atemzug, schwamm sie in dem unterirdischen Gang Meter um Meter in der Hoffnung weiter, dass sich wieder eine der typischen Öffnungen im Erdboden zeigen würde, wo sie auftauchen könnte. Der fahle Lichtschein, den Adrians Lampe in ihre Richtung warf, beruhigte sie. Minuten später zeigte sich tatsächlich das fantastische Schauspiel eindringenden Sonnenlichts über ihr im Wasser. Die aufblühende Farbenpracht zwischen tiefblauen und helltürkisen Tönen, das Glitzern im Gestein verhießen mehr als nur Rettung: Die eben noch verspürte Angst wich einem Staunen über das unfassbar Schöne vor ihr. Sie tauchte auf, hievte ihren Körper aus dem Wasser, streifte sich die Taucherbrille ab und spuckte den Atemregler aus. Sie keuchte: die Höhle, das Wasser, das Licht, der intensive erste Atemzug an freier Luft. Sie lächelte. Mit ihrer Geburt hatte sie für eine Enttäuschung gesorgt, die bittere Enttäuschung bei ihrem Vater, nur ein Mädchen zu sein, kein Junge. Ein halbes Leben lang hatte sie versucht, ihren Wert unter Beweis zu stellen. Jetzt streifte sie sich mit der Hand über die Wange und lachte befreit auf.
Vor ihr schlugen Bläschen hoch, gefolgt von Adrians Kopf. Mit einem Ruck saß er neben ihr und nahm seinerseits die Taucherbrille ab. »Alles in Ordnung?«
Sie zuckte mit den Achseln, als wäre nichts passiert.
»Glauben Sie jetzt, dass es hier spukt?«
»Ich glaube, Sie hätten die Schlange etwas höflicher bitten sollen.«
Adrian nickte belustigt und erklärte ihr dann, sich noch einmal in eine Meditation begeben zu wollen, um die Geister in der Höhle zu besänftigen.
Minutenlang saßen sie nebeneinander da, Minuten, in denen Fernanda einfach nur schwieg. Schließlich wandte er ihr seinen Kopf zu: »Bereit?«
»Ja. Aber haben Sie gefunden, wonach wir suchen?«, fragte sie vorsichtig.
»Seit Urzeiten gebiert das Wasser Leben«, murmelte er und löste zwei Behälter vom Tauchgurt, hielt die Proben gegen das Licht der einfallenden Sonne. Die Flüssigkeit wies eine geleeartige Konsistenz auf. »Plastikpartikel sind durch das Gestein eingedrungen«, stellte er trocken fest und deutete mit ernster Miene auf die Felswände. »Der Stein auf der gesamten Halbinsel ist porös. Der Regen sickert durch den Boden und sammelt sich in den Unterwasserhöhlen. Sie sind über Hunderte von Kilometern miteinander verbunden.« Seine Stimme hatte den dozierenden Klang eines Akademikers angenommen. »Über uns befinden sich Müllkippen, die meisten davon sind illegal. Der Abfall hat sich den Weg in die Tiefe gebahnt – und wird das Grundwasser einer gesamten Region verseuchen.«
»Wie schlimm ist es?«, fragte sie.
»Ich kann es nicht sagen, ich muss die Proben untersuchen lassen.« Adrian verstaute die Behälter wieder an seinem Gurt und überprüfte die Gerätschaften. »Ohne das Licht Ihrer Lampe halten Sie sich dicht an meinen Füßen, haben Sie keine Angst.«
Bevor die beiden ihre Taucherbrille über den Kopf stülpten, verweilte ihr Blick noch auf dem Wasser. Die Landschaft wandelte sich vor ihrem inneren Auge. Sie sah verrottenden Müll am heiligen Ort, menschengemachtes Treibgut: Flaschen, zerfasernde Binden und klebriges Plastik. Die Schönheit, die sie verspürt hatte, war dem Eindruck eines nassen Grabes gewichen. Sie brauchten eine gute Stunde, um an den Eingang der Höhle zurückzuschwimmen.
Später dann, auf der Küstenstraße nach Tulum, ihrem Zielort, sprachen sie kein Wort miteinander. Nur einmal geriet Adrian aus der Fassung und schlug mit der Hand aufs Lenkrad. Sie wusste, dass sein ohnmächtiger Ärger der fortschreitenden Zerstörung der Schutzgebiete geschuldet war. Sie blickte aus dem Fenster. Als sie Tulum das erste Mal besucht hatte, hatte es friedlich im Dornröschenschlaf eines Fischerdörfchens gelegen. Unberührte Strände, kristallklares Wasser, ein Idyll der mexikanischen Karibik. Nur ein paar Hütten in Meeresnähe, sonst nichts. Einmal hatte sie in den Ruinen der Maya-Stätte übernachtet, unter freiem Sternenhimmel. Sie bat Adrian, sie dort aussteigen zu lassen, sie wollte die wenigen Kilometer zum Treffpunkt zu Fuß gehen. Sie winkte dem weiterfahrenden Kollegen kurz nach und drehte sich dem Meer zu.
Was ist mit den Orten meiner Erinnerungen geschehen?, dachte sie und schlenderte los. Am Strand stieß sie auf Schamanen, die Touristen mit Kakao reinigten. Sie traf auf Männer in Tangas und auf traurig streunende Hunde. Ein Hotel reihte sich an das nächste. Weiter hinten an einer Felsgruppe sah sie Frauen in Federn gekleidet, die sich in Trance tanzten, umringt von ratternden Dieselmotoren, die dem hiesigen Treiben den notwendigen Strom lieferten. Sie roch Benzin und den Gestank roher Eier, der einem Wall in der Sonne verfaulender brauner Algen entwich. Ein Arbeiter kehrte den Strand, versuchte ihn piekfein und postkartenweiß zu halten; eine absurde Sisyphusarbeit, bei der er die Algen aufhäufte, mit einer Schubkarre wegbrachte, während die Wellen wieder und wieder den dunklen Schlamm an Land spülten. Das Wasser, ehemals türkisfarben, wirkte wie dünner Kaffee.
Читать дальше