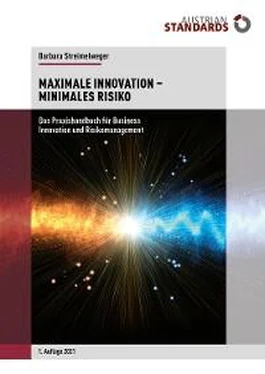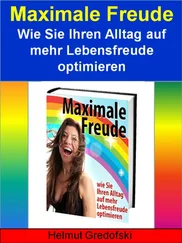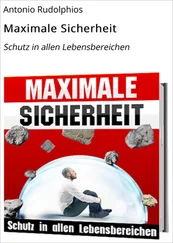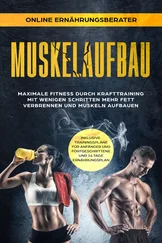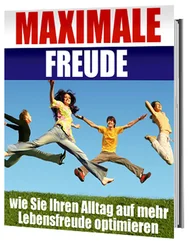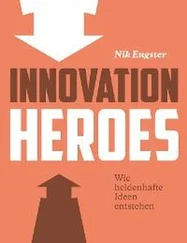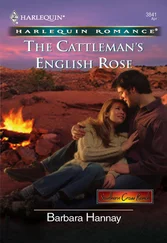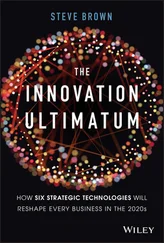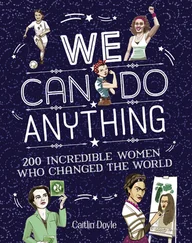2.2.1 Entwicklung des Begriffs Globalisierung 2.2.1 Entwicklung des Begriffs Globalisierung Um den Begriff Globalisierung besser verstehen zu können, soll die Frage „Was kann man sich unter Globalisierung vorstellen und wann hat sie eingesetzt?“ betrachtet werden. Globalisierung bezeichnet den Vorgang, dass in vielen Bereichen wie beispielsweise der Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt sowie Kommunikation die weltweiten Verflechtungen zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten zunehmen. Nach Nayan entstand der Begriff Globalisierung in den 1960er-Jahren[2]. Menzel hingegen gibt mehrere mögliche Antworten auf die Frage, wann die Globalisierung eingesetzt hat. Eine Antwort bezieht sich auf die Industrielle Revolution, wonach es heißt: „Globalisierung beginnt mit der Industriellen Revolution, als erstmals eine industrielle Massenfertigung auf mechanischer und nicht mehr nur handwerklicher Basis betrieben wurde, die einen wachsenden Rohstoffbedarf (zum Beispiel Baumwolle) erzeugte und die auch für den Export bestimmt war“.[3] Eine weitere Antwort nach Menzel, der zufolge die Globalisierung weitaus länger zurückgehen würde, lautet „Globalisierung beginnt mit der europäischen Welteroberung am Ende des 15. Jahrhundert[s], als Kolumbus 1492 vermeintlich und Vasco da Gama 1498 tatsächlich den Seeweg nach Indien gefunden haben. Die Folge war der Vertrag von Tordesillas aus dem Jahre 1494, der erste Vertrag der Weltgeschichte mit globaler Reichweite“[4]. Menzel zeigt in seinem Bericht, dass sich der Begriff in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hat und seither auch in unterschiedlichem Kontext angewendet wird.
2.2.2 Treiber und Auswirkungen 2.2.2 Treiber und Auswirkungen Heute halten digitale Technologien Einzug in unser tägliches Leben und prägen unser Tun und Handeln und in der Folge den Welthandel. Die Globalisierung ist gefordert, den Wandel mitzugehen und mitzugestalten. Während der Handel mit Waren stagniert, ist der Handel mit globalen Dienstleistungen, insbesondere digital gestützten Diensten, am Wachsen. Die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit ändern sich dadurch. Das rasante Wachstum der digitalen Plattformen macht Landesgrenzen überflüssig und der Ruf nach neuen Geschäftsmodellen ist unüberhörbar. Doch ist es wirklich sinnvoll, nur noch global zu denken und sich global auszurichten, die eigene Produktion ins Ausland zu verlagern und den Bedarf durch Importe abzudecken? Die Corona-Pandemie (Covid19-Krise) hat uns allen gezeigt, dass der Fokus auf Globalisierung hohe Risiken birgt und schwerwiegende Folgen mit sich bringen kann. Wird jegliche Produktion ins Ausland verlagert und müssen letztendlich diese Waren anschließend importiert werden, der Warenverkehr jedoch krisenbedingt auf annähernd Null reduziert und Grenzen sogar geschlossen werden, dann entstehen Engpässe, die sich durchaus lebensbedrohlich äußern können. Als Beispiel seien hier Produkte aus dem Bereich der Schutzausrüstung genannt, wie Nasen-Mund-Schutzmasken der Kategorie FFP3 und FFP2 oder Einweghandschuhe, wie sie in der Medizin verwendet werden. Aus jeder Krise kann ein Unternehmen beziehungsweise eine Organisation gestärkt hervorgehen. Das zeigt auch die Corona-Krise. Plötzlich wird wieder von Nationalisierung sowie Regionalität gesprochen. Produkte werden kurzerhand wieder im eigenen Land produziert, im Lebensmittelbereich setzt man auf regionale Produkte und bevorzugt beispielsweise hochqualitative regionale Produkte gegenüber oftmals billigen Importprodukten. Dadurch schaffen Verantwortliche in etablierten Unternehmen neue Geschäftsmodelle, und Startups werden gegründet. Doch da, wo es Gewinner gibt, die gestärkt aus Krisen hervorgehen und nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern agieren oder auch auf die Situation als solche aktiv reagieren, anstatt zu resignieren, gibt es auf der anderen Seite Verlierer. Dazu zählen jene, die in Schockstarre verfallen, den Kopf in den Sand stecken und letztendlich oftmals resignieren.
2.3 DIGITALISIERUNG 2.3 DIGITALISIERUNG Digitalisierung und die daraus folgende digitale Transformation lässt sich mittlerweile in allen gesellschaftlichen Bereichen erkennen. Wie sich die Digitalisierung entwickelt hat und wo wir derzeit stehen, zeigt die folgende schematische Darstellung ( Abbildung 2 ). ABBILDUNG 2 ENTWICKLUNG DER DIGITALISIERUNG (QUELLE: STREIMELWEGER B. UND HAGE R.[5])
2.3.1 Digitalisierung versus Automatisierung
2.3.2 Das digitale Zeitalter und die Entwicklung hin zur Digitalisierung
2.3.3 Treiber und Auswirkungen der Digitalisierung
2.4 REGULATORIEN – REGLEMENTIERUNG
2.4.1 Rechtliche Vorgaben
2.4.2 Standards und Frameworks
2.5 INNOVATION
2.5.1 Innovation bedeutet Veränderung
2.5.2 Ansätze in Veränderungsprozessen
3 Business Innovation Management
3.1 GRUNDLAGEN DES INNOVATIONSMANAGEMENTS
3.1.1 Was ist Innovation?
3.1.2 Innovationsmanagement
3.1.3 Innovation im Unternehmen
3.1.4 Innovationskultur
3.2 INNOVATIONSTYPEN UND KLASSIFIZIERUNG VON INNOVATIONEN
3.2.1 Innovationstypen nach dem Innovationsgrad
3.2.2 Innovationstypen nach dem Innovationsgegenstand
3.2.3 10-Typen-der-Innovation-Framework
3.3 INNOVATIONSSTRATEGIEN
3.3.1 Strategietypen
3.3.2 Perspektive der Innovationsstrategie
3.4 INNOVATIONSPROZESS
3.4.1 Generischer Innovationsprozess
3.4.2 5-Stage-Gate-Prozess
3.5 KLASSISCHE/AGILE/HYBRIDE METHODEN IM INNOVATIONSMANAGEMENT
3.5.1 Business Model Canvas
3.5.2 Lean Innovation
3.5.3 Blue-Ocean-Strategie
3.5.4 Frugale Innovation
3.5.5 Design Thinking
3.5.6 Lean Startups
3.5.7 Sonstige bekannte Methoden
3.6 INNOVATIONSCONTROLLING
3.6.1 Controlling als Funktion, Prozess und Institution
3.6.2 Innovationscontrolling und Innovationsprozesse
3.6.3 Überblick Controllinginstrumente
3.7 LEADERSHIP SKILLS
3.7.1 Vanity versus Actionable Metrics – oder die Verlockung der Eitelkeit
3.7.2 Objectives and Key Results (OKR)
3.7.3 Ambidextrie/Ambidexterität
3.7.4 Effectuation
3.7.5 Strategische Voraussicht mit Szenarioplanung und Werte-Szenarien
4 Risikomanagement
4.1 BEDEUTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS
4.1.1 Unterschiedliche Sichtweisen auf das Riskmanagement
4.1.2 Risikomanagement als Prävention
4.2 DIE SICH ÄNDERNDE NATUR VON RISIKEN (THE CHANGING NATURE OF RISKS)
4.2.1 Risiken verstehen
4.2.2 Risiken in sozio-technischen Systemen
4.2.3 Risiken und der Ansatz des menschlichen Fehlers (Human Error Approach)
4.2.4 Risiko versus Problem
4.3 WESENTLICHE BEGRIFFE IM RISIKOMANAGEMENT
4.3.1 Formale Darstellung des Risikos
4.3.2 Risikomanagement versus Notfall-, Krisen- und Kontinuitätsmanagement
4.4 KONTEXT DES RISIKOMANAGEMENTS
4.4.1 Externer Kontext
4.4.2 Interner Kontext
4.4.3 Externen und internen Kontext analysieren
4.4.4 Risikomanagement-Kontext
4.5 GRUNDSÄTZE DES RISIKOMANAGEMENTS
4.5.1 Die 3 Säulen des Risikomanagements
4.5.2 Umfang des Risikomanagements
4.5.3 Risikomanagementaktivitäten
4.5.4 Risikopräferenz
4.5.5 Risikokultur
4.6 ANWENDUNG DES RISIKOMANAGEMENTS
4.6.1 Unternehmensrisikomanagement
4.6.2 Risikomanagementaktivitäten im Rahmen des Projektmanagements
4.6.3 Risikomanagement im Bereich IT, OT und Informationssicherheit
4.6.4 Risikomanagement für Medizinprodukte
4.6.5 Risikomanagement im Finanzsektor
4.6.6 Risikomanagement in der Industrie
4.7 RISIKOMANAGEMENT AUF UNTERSCHIEDLICHEN EBENEN
4.8 RISIKOKLASSIFIZIERUNG UND RISIKOINDIKATOREN
4.8.1 Risikokriterien und Risikoakzeptanzkriterien
4.8.2 Risikoklassifizierung intern versus extern
Читать дальше