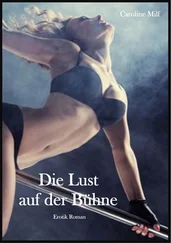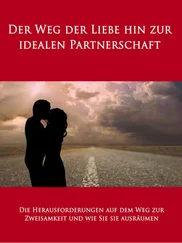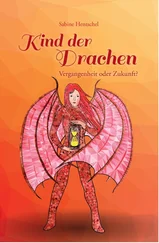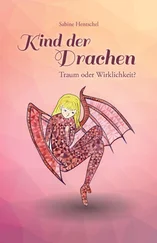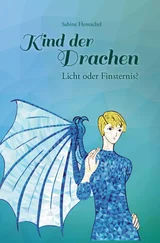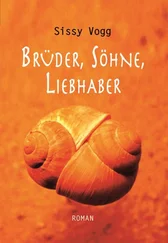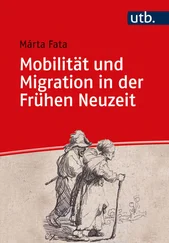2.1 Spielen bzw. Play – die Tätigkeit des spielenden Subjekts
Spielen ist nicht nur bei Menschen zu beobachten. Es ist zwar eine »anthropologische Konstante« und lässt sich sogar als ein grundlegendes Bedürfnis einordnen, denn »zu allen Zeiten haben Menschen in allen Kulturen gespielt« (Stenger 2012, S. 52). Sein universelles Vorkommen in menschlichen Kulturen ist jedoch nicht unabhängig von Rahmenbedingungen, denn »in modernen Gesellschaften und in Hirtengesellschaften« wird häufiger gespielt als etwa in »Sammlerkulturen« (Hauser 2013, S. 134). Zudem ist Spielen keine ausschließlich menschliche Tätigkeit. Auch Tiere spielen, wie bereits der Philosoph und Psychologe Karl Groos (1861–1946) in einer eindrucksvollen Beobachtungsstudie beschrieben hat (vgl. Groos 1896). Sie tun dies vor allem in Situationen, die von keinem Mangel bestimmt sind (z. B. Hunger oder Durst). Groos konnte bestätigen, was schon Friedrich Schiller (1759–1805) in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen zum Spielen notiert hatte: »Das Tier arbeitet, wenn ein Mangel die Triebfeder seiner Tätigkeit ist, und es spielt, wenn der Reichtum der Kraft diese Triebfeder ist, wenn das überflüssige Leben sich selbst zur Tätigkeit stachelt« (Schiller 1795/1913, S. 109). Wichtig ist diese Einsicht auch für das Spielen bei uns Menschen, denn dieses scheint nicht nur selbst ein Grundbedürfnis und Bedingung für ein gutes Leben zu sein. Als Bedingung dafür, dass Spielen überhaupt stattfinden kann, müssen – bei Menschen wie bei Tieren – andere Bedürfnisse zunächst erfüllt sein. Diese Bedürfnisse sind jedoch nicht nur Hunger und Durst, sondern betreffen auch andere körperlich-emotionale Zustände (vgl. Nussbaum 2018). Ein Kind spielt z. B. nicht, wenn es Schmerzen hat. Und es spielt auch nicht, wenn es Angst hat. Es muss im wahrsten Sinne des Wortes ›frei‹ von einschränkenden physischen und psychischen Zuständen sein, damit Spielen möglich wird.
Besonders gut untersucht ist das Spielen bei Säugetieren. Phylogenetische Studien – darunter vor allem Verhaltensbeobachtungen und experimentelle Versuche – an Beuteltieren, Nagetieren, Herbivoren, Carnivoren, Delphinen, Affen und Hominiden zeigen, dass diese auf verschiedenste Arten spielend tätig sind (vgl. Papoušek 2003, S. 19). 2
Doch welche Merkmale kennzeichnen nun das menschliche Spiel, wenn alle notwendigen Bedürfnisse befriedigt sind und ein Kind tatsächlich eine Spieltätigkeit beginnt? Laut dem Entwicklungspsychologen Rolf Oerter lässt sich Spielen durch drei zentrale Merkmale kennzeichnen (vgl. Oerter 2008, S. 237): Erstens besitzt es immer einen »Selbstzweck«, d. h. im Spiel ist das spielende Kind immer »um der Handlung willen« (ebd.) tätig. Zweitens findet in der Spieltätigkeit immer ein »Wechsel des Realitätsbezuges« (ebd.) statt. Dies geschieht dadurch, dass Situationen fiktiv vom spielenden Kind konstruiert werden. Zudem zeigen sich drittens in allen Spielformen potenziell »Wiederholungen von Handlungen« (ebd.), die vom spielenden Subjekt zum Teil sogar exzessiv und ritualisiert betrieben werden.
2.2 Spiele bzw. Games – Versuche einer kulturellen Institutionalisierung des Spiels
Auch wenn die Spieltätigkeit eines Kindes und bestimmte Spielangebote im Ereignis des Spielens zusammenfallen können (vor allem bei Regelspielen, sofern die spielenden Kinder die Regeln tatsächlich befolgen), so herrscht dennoch eine systematische Differenz. Kinder spielen schließlich auch ohne Angebote, indem sie Alltags- oder Naturgegenstände umfunktionieren und umnutzen (  Kap. 5). Daher sind Spiele als kulturelle Angebote von der Spieltätigkeit des Kindes zu unterscheiden.
Kap. 5). Daher sind Spiele als kulturelle Angebote von der Spieltätigkeit des Kindes zu unterscheiden.
Bei uns Primaten bilden Spiele im Vergleich zur Spieltätigkeit der Tiere die »differenzierteste Ebene« des Spielens, das »in variationsreichen, frei gestalteten Formen« stattfindet (Papoušek 2003, S. 24). Diese verschiedenen Formen der Spieltätigkeit, die bestimmte Merkmale aufweisen, die sich gruppieren lassen und die sogar Regeln folgen, werden gemeinhin als Spiele bzw. im angloamerikanischen Sprachraum als Games bezeichnet. Sie werden nicht durchweg von Kindern in einer freien Spieltätigkeit – quasi durch explorierende Entdeckung – selbst entwickelt, sondern bilden aus einer (meist erwachsenen) Beobachtungsperspektive jeweils bestimmte Verhaltensmuster, die sich etwa in Konstruktionsspiele, Rollenspiele, Regelspiele und weitere Spiele gliedern lassen (  Kap. 4). Solche Spiele überhaupt festzustellen, lässt sich bereits als eine Form der kulturellen Institutionalisierung des Spielens bezeichnen, die dann ihren pädagogischen Höhepunkt findet, wenn Spiele absichtsvoll entwickelt und Kindern aus didaktischen Gründen angeboten werden. Das beste Beispiel für eine solche intendierte Schaffung von Spielen ist Spielzeug. Als Mittel zur geplanten Einwirkung auf Kinder und Jugendliche haben die Spielmittel eine lange Tradition, die in der Menschheitsgeschichte Jahrtausende zurückreicht (vgl. Retter 1979). In der Pädagogik der frühen Kindheit gelten Fröbels Spiel- und Beschäftigungsmittel (
Kap. 4). Solche Spiele überhaupt festzustellen, lässt sich bereits als eine Form der kulturellen Institutionalisierung des Spielens bezeichnen, die dann ihren pädagogischen Höhepunkt findet, wenn Spiele absichtsvoll entwickelt und Kindern aus didaktischen Gründen angeboten werden. Das beste Beispiel für eine solche intendierte Schaffung von Spielen ist Spielzeug. Als Mittel zur geplanten Einwirkung auf Kinder und Jugendliche haben die Spielmittel eine lange Tradition, die in der Menschheitsgeschichte Jahrtausende zurückreicht (vgl. Retter 1979). In der Pädagogik der frühen Kindheit gelten Fröbels Spiel- und Beschäftigungsmittel (  Kap. 3) oder auch Maria Montessoris Lern- und Entwicklungsmaterialien entsprechend als ›klassisch‹.
Kap. 3) oder auch Maria Montessoris Lern- und Entwicklungsmaterialien entsprechend als ›klassisch‹.
Doch nicht nur Erwachsene bieten Kindern bestimmte Spielformate an, auch innerhalb von Kinderkulturen werden bestimmte Spiele weitergegeben. Dies meint keine Kultur für Kinder, die von Erwachsenen intentional geschaffen und z. T. geschäftsmäßig beworben wird, sondern eine Kultur von Kindern für Kinder. Ein wichtiges, wenn nicht sogar das zentrale Element einer solchen Idee von Kinderkultur ist das Spielen selbst: »Dabei lernen sie über sich und die Welt, und dies in eigener Regie und ohne Pädagogik« (Wegener-Spöhring 2011, S. 27). Diese besondere Form der Games entsteht quasi zur reinen Unterhaltung und Freizeitbeschäftigung, sprich: um des Spielens selbst willen.
Während im 20. Jahrhundert Nachbarschaften und Schulhöfe entsprechende Orte der Weitergabe und Vermittlung verschiedenster Kinderspiele von Kindern für Kinder waren (vgl. Friedl 2015), so haben wir es heute jedoch mit einer deutlich komplexeren Situation zu tun. 3 Gegenwärtig besteht in modernen Industrienationen eine deutlich breitere Auswahl und Vielfalt an verfügbaren Spielangeboten – auch und gerade in der frühen Kindheit. Hinzugetreten sind gänzlich neue Spiele, darunter auch die digitalen Spiele auf festen und tragbaren Spielkonsolen, Tablets und Smartphones (bei denen im Übrigen ebenso wie bei Spielen an Straßen, in Höfen und auf Schulhöfen eine Weitergabe von Spielhandlungen und -techniken von Kind zu Kind vermutet werden darf).
Es ist allerdings auch festzuhalten: Dem spielenden Subjekt sind solche Gliederungen von Spielangeboten und Verhaltensweisen in der tatsächlichen Handlung des Spielens wahrscheinlich ziemlich gleichgültig. Für das spielende Kind sind Lusterfüllung oder Spannung in der Spieltätigkeit entscheidende Aspekte für Beginn, Durchführung und Dauer des Spielens (vgl. Hauser 2013).
2.3 Was bleibt außer der Vielfalt an Begriffen und einer gewissen Unschärfe?
Die oben vorgenommene Unterscheidung zwischen Spielen (als subjektive Spieltätigkeit) und Spiel (als kulturelles Angebot von Spielhandlungen und/oder -materialien) ist insbesondere für pädagogische Situationen zwischen den Generationen relevant: Was ein Kind spielt bzw. was für Kinder tatsächlich ein Spiel ist, sieht für Pädagoginnen und Pädagogen nicht immer nach einem Spiel aus. Die wohl bekannteste und am meisten diskutierte Spielform, die hierfür als Beispiel dienen kann, ist das im Einzelfall gar nicht so leicht einzuschätzende Rough-and-Tumble-Play, bei dem Kinder körperliche Auseinandersetzungen simulieren, die aber auch an der Grenze zur körperlichen Gewalt stattfinden können. Gerade dies scheint aus Sicht von Kindern aber auch der Reiz solcher Spiele zu sein, die von Erwachsenen nicht selten unterbrochen werden, weil sie aus deren Sicht eben nicht als Spiele gelten. Auf der anderen Seite machen sich Erwachsene nicht selten viel Mühe, das kindliche Spielen absichtsvoll zu initiieren. Erfahrungsgemäß führt dies aufseiten von Kindern aber nicht zwangsläufig zu einer Spieltätigkeit.
Читать дальше
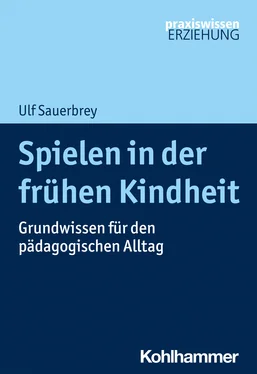
 Kap. 5). Daher sind Spiele als kulturelle Angebote von der Spieltätigkeit des Kindes zu unterscheiden.
Kap. 5). Daher sind Spiele als kulturelle Angebote von der Spieltätigkeit des Kindes zu unterscheiden.