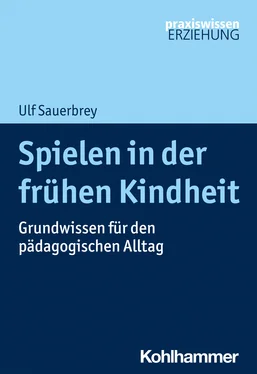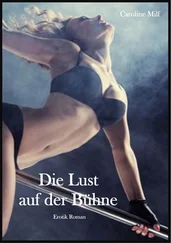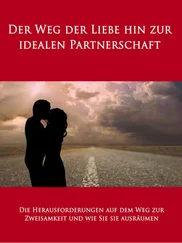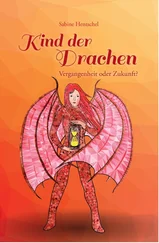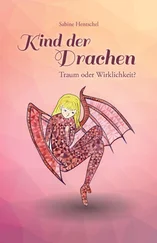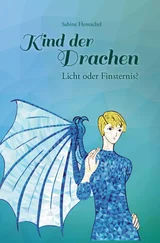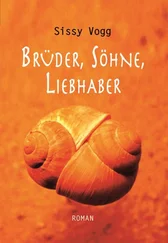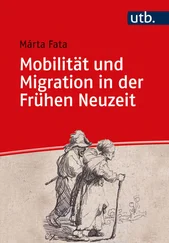Ulf Sauerbrey - Spielen in der frühen Kindheit
Здесь есть возможность читать онлайн «Ulf Sauerbrey - Spielen in der frühen Kindheit» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Spielen in der frühen Kindheit
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Spielen in der frühen Kindheit: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Spielen in der frühen Kindheit»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Spielen in der frühen Kindheit — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Spielen in der frühen Kindheit», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Widmen möchte ich das Buch meinen Kindern Edith und Elise. Sie sorgen mit ihrem wunderbaren Spiel- und Beschäftigungstrieb dafür, dass ich das Spielen nicht nur als wissenschaftliches Forschungsobjekt analysieren, sondern vielmehr alltäglich als ein spannendes Ereignis miterleben darf, in dem Neues und Unerwartetes geschieht und in dem sich das Innere der Kinder zeigt – darunter vieles, das wir Erwachsene ihnen vorleben.
Neubrandenburg, im Februar 2021
Ulf Sauerbrey
1Zugunsten der Lesbarkeit habe ich in diesem Buch nur wenige Fußnoten gesetzt. An dieser Stelle ist eine biografische Anmerkung jedoch geboten: Janusz Korczak, Geburtsname Henryk Goldszmit (1878/79–1942), entstammte einer jüdischen Familie, lebte in Polen und wurde zu Lebzeiten bekannt als Arzt und Pädagoge. Er leitete ein jüdisches Waisenhaus im Warschauer Ghetto. 1942 wurde er mit 200 Kindern aus dem Waisenhaus nach Treblinka deportiert, wo die Kinder und ihr Erzieher ermordet wurden. Er ist einer der wichtigsten und zugleich einer der bislang zu wenig beachteten Pädagogen des 20. Jahrhunderts.
1
Spielen in der frühen Kindheit – ein anderer Blick auf Lernen
In seinem vielfach aufgelegten Standardwerk »Spielen – Lernen. Praxis und Deutung des Kinderspiels« hat der Erziehungswissenschaftler Andreas Flitner (1922–2016) sich umfassend mit dem Phänomen des Spielens beschäftigt. Der Anlass für sein 1972 erstmals erschienenes Werk war der Umstand, dass am Beginn der 1970er Jahre viele Akteurinnen und Akteure unter Bezugnahme auf Erkenntnisse aus der Lernpsychologie sich bemühten, »Spiel und Spielzeug in ›Training‹ und ›Lernzeug‹ zu verwandeln« (Flitner 1996, S. 9). Gegenüber dieser pädagogisch-didaktischen Technisierung des Spielens wies Flitner auf Basis von Untersuchungen auch aus der internationalen Forschung nach, dass die Frage nach dem kindlichen Lernen durch Spiel »nur einer der möglichen Zugänge« sei; andere Zugänge erforschten etwa, was Kinder im Spiel erleben, »was sie an Glück und Ängsten erfahren, was sie ›verarbeiten‹ an Eindrücken und Problemen und wie ihnen die Welt sich öffnet im Spiel« (ebd., S. 190).
Hier soll an Flitners Differenzierung des Kinderspiels als Forschungsgegenstand erinnert und zugleich angeknüpft werden, denn erstens liegen uns inzwischen neuere Erkenntnisse zum Spielen in verschiedenen frühkindlichen Lebenswelten vor, zweitens haben sich diese Lebenswelten seit den 1970er Jahren noch einmal grundlegend verändert und drittens hat sich jedoch die von Flitner diagnostizierte Situation gegenüber dem Spiel nach einem halben Jahrhundert keineswegs grundlegend gewandelt:
»Teile der Wirtschaft, aber auch aus Lern- und Hirnforschung werfen der herkömmlichen Kombination von Kindergarten und Schule vor, Lernpotenziale der jungen Kinder zu wenig zu nutzen und Kinder massiv zu unterfordern. Deren Tenor lautet: Wir vergeuden zu viel Zeit mit (sinnlosem) Spielen und ›bewirtschaften‹ das kindliche Lernpotenzial zu wenig« (Hauser 2013, S. 11, Hervorhebung U. S.).
Deutlich festzustellen ist ein Streben, das kindliche Spielen aus der Perspektive Erwachsener sinnvoll (was auch immer dies bedeuten mag) und vor allem absichtsvoll zu gestalten – und dies betrifft heute nicht nur die Lern- und Hirnforschung bzw. ihre Rezeption in der Pädagogik. Mit Blick auf die Bildungsforschung insgesamt lässt sich eine Dichotomisierung zwischen Spielen und Lernen feststellen (vgl. vor allem für die USA: Spiewak Toub et al. 2016; für weitere Nationen vgl. auch: Hauser 2013, S. 12 ff.). Besonders durch Akteurinnen und Akteure des so genannten Global Education Reform Movements (GERM) wurde das Spielen im frühen Kindesalter wiederholt grundlegend infrage gestellt. Das GERM – Begriff und Akronym wurden vom finnischen Erziehungswissenschaftler Pavi Sahlberg geprägt – besteht aus verschiedenen weltweit vernetzten Institutionen, die vorrangig aus wirtschaftlichen und finanzpolitischen Gründen ausgewählte Kompetenzdimensionen von Heranwachsenden untersuchen und auf dieser Basis Empfehlungen an die Politik geben. Die wahrscheinlich prominenteste dieser Institutionen ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die in regelmäßigen Abständen die seit der Jahrtausendwende bekannt gewordenen PISA-Tests durchführt. Seit einigen Jahren plant die OECD eine International Early Learning and Child Well-being Study (IELS), in der die sprachliche und die mathematische Bildung, sozial-emotionale Fähigkeiten sowie die Regulationsfähigkeit von Kindern getestet werden (vgl. zur Übersicht: Knauf 2017). In jeder teilnehmenden Nation sollen ca. 3000 vier- bis fünfjährige Kinder untersucht werden – die Daten sollen später auch in Bezug zu den PISA-Daten gesetzt werden.
In ihrer Broschüre zur Durchführung der IELS-Studie mit dem Titel ›Early Learning Matters‹ verweist die OECD jedoch erstaunlicherweise mit keiner Silbe auf das Spielen von Kindern (vgl. OECD 2018). In der Broschüre ist lediglich die Rede von kindlichen Aktivitäten, die erfasst und beurteilt werden sollen. Spielen und Lernen erscheinen dabei als voneinander getrennt. Dies konnte zwar als notwendig operationalisierte Sprache einer empirischen Bildungsforschung verstanden werden, die durch PISA wie durch kaum eine andere großangelegte Studie repräsentiert wird. Problematisch ist jedoch, dass eine Delegation der OECD in Verhandlungen mit Nationen, die Interesse an einer Teilnahme an der IELS-Studie haben, Kinderspiele als ›verschwendete Aktivitäten‹ bezeichnet – Mathias Urban hat eine solche Rückmeldung eines Kollegen, der allerdings anonym bleiben wollte, in der Fachliteratur dokumentiert (vgl. Urban 2017, S. 20).
Bislang hat die IELS-Studie vergleichsweise eher wenig Zuspruch aus der wissenschaftlichen Frühpädagogik erhalten (vgl. Urban & Swandener 2016) und künftige Entwicklung bleiben abzuwarten (vgl. auch Wasmuth & Nitecki 2018). Auch könnte man diese Seitenblicke auf die OECD für übertrieben halten. Jedoch ist es inzwischen in den wissenschaftlichen Disziplinen, die das Feld Bildungsforschung formen, unbestritten, dass Institutionen wie die OECD, aber auch die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds einen starken Einfluss auf die Bildung in verschiedenen Nationen haben und eine Privatisierung sowie eine enge Form der Ökonomisierung des Bildungswesens fördern (vgl. Lohmann 2014; Münch 2018). Wenngleich es sich hier nur um ein ausgewähltes Beispiel handelt, bei dessen Einschätzung die Urteile in der Fachwelt unterschiedlich ausfallen: Bereits die skizzierte Diskussion um ›frühkindliche Kompetenzen‹ zeigt, dass es das Kinderspiel in jedem Fall verdient, hinsichtlich seines pädagogischen Sinns in der frühen Kindheit weiterhin beleuchtet zu werden. Dies ist vor allem notwendig, da die Auseinandersetzung mit dem Spielen allzu rasch in den Strudel der einen und stark selektiven Frage danach gerät, welche gesellschaftlich bedeutsamen Kompetenzen sich Kinder denn dabei genau aneignen. Diese Frage darf und muss zweifelsohne gestellt werden, insbesondere von Pädagoginnen und Pädagogen, die ihr Tun begründen müssen. Doch erstens ist die Frage nach dem Kompetenzerwerb im Spiel nur im Einzelfall mit Blick auf ein konkretes Spiel beantwortbar (und übrigens wird dabei viel zu selten die Perspektive der spielenden Kinder einbezogen). Und zweitens darf sie nicht die einzige Frage bleiben. Zu beachten ist auch, auf welche Art und Weise das Spielen gesellschaftlich in Anspruch genommen wird. Notwendig zu stellen ist auch die Frage nach der Veränderung der Kinderspiele, allzumal vor dem Hintergrund der rasanten technisch-kulturellen Weiterentwicklung digitaler Medien, die heute einen nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil des Aufwachsens von Kindern in den modernen Industrienationen bilden. Zentral ist schlussendlich auch die Frage nach den Orten und Sozialisationsfeldern, an bzw. in denen Kinder spielen. Denn allzu oft richtet sich der Blick auf das Kinderspiel einseitig auf Kindertageseinrichtungen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Spielen in der frühen Kindheit»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Spielen in der frühen Kindheit» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Spielen in der frühen Kindheit» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.