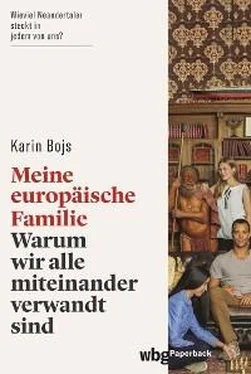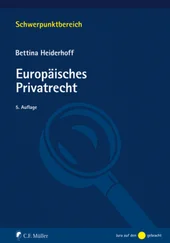Laugerie Haute ist einer der ergiebigsten Fundplätze für all jene Kulturen, die in einem Zeitraum von mindestens 20.000 Jahren in dieser Gegend existiert haben. Archäologen haben 42 Schichten ausgegraben, vom Aurignacien über das Solutréen bis zum darauf folgenden Magdalénien.
Der riesige Felsüberhang scheint ein Sammellager gewesen zu sein, ein Platz, an dem sich mehrere kleine Gruppen zu bestimmten Zeiten trafen – vor allem im Herbst, wenn das Tiervorkommen am größten war.
Ungefähr einhundert Personen scheinen hier gleichzeitig gelebt zu haben. Das entspricht drei bis fünf kleineren Gruppen. Warum sie gerade diesen Ort auswählten, ist leicht nachzuvollziehen. Er bietet viel Platz, denn die geschützte Fläche unter dem Überhang ist so groß wie zwei Tennisplätze. Mittlerweile ist der größte Teil des Daches herabgestürzt und gigantische Felsbrocken liegen auf der Erde.
Wie viele andere eiszeitliche Wohnplätze liegt auch Laugerie Haute nur wenige Meter von einem Fluss entfernt. Die Menschen, die sich hier aufhielten, genossen sowohl Abendsonne als auch Aussicht über das Wasser, wie in den gefragtesten Objekten heutiger Wohnungsmakler.
Man kann darüber spekulieren, wie es den Menschen des Solutréen hier während der kältesten Periode der Eiszeit ergangen ist. Ich stelle mir vor, dass sie gerne hierherkamen. Sicher lebten die Kleingruppen die meiste Zeit des Jahres isoliert und waren durch die grimmige Kälte eingeschränkt. In Laugerie Haute begegneten sie anderen Menschen, feierten Feste und hielten Zeremonien ab. Die jungen Erwachsenen konnten einen Partner finden, man saß um die Feuer und tauschte Erfahrungen aus und alle hatten genug zu essen.
Die Nahrung bestand zum größten Teil aus Fleisch und Knochenmark vom Rentier. Andere Beutetiere wie Pferde wurden selten, als die Kälte in dieser Region ihren Höhepunkt erreichte.
Natürlich aßen die eiszeitlichen Menschen auch pflanzliche Kost, wie unter anderem mikroskopisch kleine Reste an ihren Zähnen belegen. Doch die Vegetationsperiode war kurz, vor allem im kalten Solutréen.
Grabungen und Steinwerkzeuge in allen Ehren, doch der eigentliche Grund, warum jedes Jahr Hunderttausende Touristen Les Eyzies besuchen, sind die Höhlenmalereien. Auch ich begebe mich auf eine Kunstwanderung zu den hiesigen Höhlen.

Laugerie Haute erscheint mir wie der riesige Festplatz, auf dem meine vorzeitlichen Verwandten ihre größten Partys gefeiert haben. Abri Cap Blanc, sechs Kilometer weiter östlich, vermittelt eine intimere Atmosphäre. Hier fühle ich mich, als wäre ich bei einer Familie zu Besuch und bewunderte ihre Einrichtung.
Nur sechs Personen warten mit ihren vorab reservierten Eintrittskarten in dem kleinen Museum. Für mehr ist kein Platz. Für kurze Zeit werden wir eingelassen und dürfen den Wohnplatz besichtigen. Die Führerin kontrolliert gewissenhaft, dass keiner eine Kamera eingeschmuggelt hat, dann schließt sie eine schwere Eisentür auf.
Unter Archäologen war es lange umstritten, wann die entlang der Felswand verlaufenden Friese eigentlich erschaffen wurden. Mittlerweile werden sie dem Solutréen zugerechnet. Sie sind außergewöhnlich gut erhaltene Beispiele dafür, wie die Eiszeitmenschen die Stätten dekorierten, an denen sie dauerhaft wohnten. An den meisten anderen Orten sind die Felswände, auf denen sich die Dekorationen ursprünglich befanden, durch Verwitterung zerstört.
Die Friese in Cap Blanc bestehen aus Reliefs, die in den Fels gemeißelt wurden: eine ganze Prozession aus Pferden und Bisons. Paradoxerweise standen diese beiden Tierarten nur selten auf dem Speisezettel der Menschen. Das belegen die hier entdeckten Tierknochen. Fast 95 Prozent der Knochen stammen von Rentieren, der häufigsten Jagdbeute während der kältesten Zeiten. Offenbar wurde aber Pferden und Bisons eine größere emotionale Bedeutung beigemessen. Die Künstler der Eiszeit wählten für ihre Bilder oft ganz andere Tiere als die, die sie tagtäglich jagten.
Aus der familiären Umgebung in Cap Blanc begebe ich mich ins Tal hinunter nach Font de Gaume. Das ist eine völlig andere Erfahrung, gar nicht alltäglich, sondern beinahe schon sakral. Tief im Innern einer Höhle sehe ich exklusive Kunstwerke. Die Künstler hinter diesen Bildern müssen die eiszeitliche Entsprechung von Meistern wie Rembrandt oder Leonardo da Vinci gewesen sein.
Gemeinsam mit einer französischsprachigen Gruppe von etwa zehn Personen trete ich ein. Nach nur wenigen Schritten in den Berg hinein haben wir schon alle Eindrücke der Außenwelt hinter uns gelassen. Das Sonnenlicht verschwindet. Wir hören keine Vögel mehr und auch nicht das Geräusch des Windes. Die Haut registriert nur noch Kälte und Feuchtigkeit. In meinem Kopf entsteht ein schwaches Summen, als der Gehörsinn versucht, die Stille des Berges zu kompensieren. Ich blinzele, um mich an die Dunkelheit zu gewöhnen.
Die Gänge in der Höhle von Font de Gaume sind eng, aber heutzutage kann man als Besucher zumindest aufrecht gehen, da der Fußboden zu unserer Bequemlichkeit abgesenkt worden ist. Außerdem gibt es elektrische Lampen, die unsere Führerin löscht, sobald wir einen Bereich der Höhle verlassen. Sie will die Bilder so gut als möglich schützen, sowohl vor dem elektrischen Licht als auch vor unserer Atemluft.
Die Künstler der Eiszeit waren hier teilweise noch gezwungen zu kriechen. Doch als sie die Bilder in der Höhle malten, half ihnen eine neue und bedeutende Erfindung: Sie hatten Lampen. Sie brauchten sich nicht länger mit einfachen Holzfackeln zu begnügen wie frühere Generationen. Die Künstler in Font de Gaume erleuchteten ihre Umgebung mithilfe von ausgehöhlten Steinen. In der Vertiefung verbrannten sie tierisches Fett und Dochte aus Pflanzenfasern.
Font de Gaume, am Rande von Les Eyzies, wurde vor ungefähr 17.000 Jahren während des Magdalénien genutzt. Diese Kultur folgte nach einer unspektakulären Übergangsphase auf das Solutréen. Die Werkzeuge wurden etwas ausgereifter, doch die Menschen scheinen weitgehend die gleichen geblieben zu sein. Die Kälte der Eiszeit begann allmählich abzunehmen und das Klima wurde ein wenig wärmer.
Die Meister in Font de Gaume malten ihre Bilder mit gemischten Pigmenten: Gelb, Rot, Braun und Schwarz und viele Nuancen dazwischen. Sie stellten die Farben aus rötlichen Eisenoxiden und schwarzem Manganoxid aus den umliegenden Bergen her. Manchmal brannten sie die Steine, um spezielle Farbnuancen zu erzielen. Sie zerstießen die Pigmente in Mörsern und mischten die Farben auf Paletten, genau wie heutige Künstler. Um die Farben auf die Höhlenwände aufzubringen, verwendeten sie verschiedene Methoden: ihre Finger, Stöckchen und Pinsel aus Tierhaaren oder Vogelfedern. Sie bliesen das Farbpulver auch direkt auf die angefeuchtete Unterlage, so wie die Freskenmaler der Renaissance.
Das häufigste Motiv in Font de Gaume ist der Bison. Mehr als achtzig Tiere sind hier verewigt, jedes mit seinen besonderen Eigentümlichkeiten. Den Künstlern war ganz offensichtlich bewusst, ob sie ein weibliches oder ein männliches Tier malten, wie alt das Tier war, in welcher Jahreszeit und in welcher konkreten Situation es sich befand. Geschickt und wohlüberlegt nutzten sie die Form der Felswände, um dreidimensionale Effekte zu erzielen. In einer der Höhlen befinden sich einige Abbildungen fünf Meter über dem Boden. Um dort oben zu malen, muss der Künstler auf den Schultern der anderen gestanden haben.
Mehrfarbige Malereien existieren nur in wenigen eiszeitlichen Höhlen, deren bekannteste die im spanischen Altamira, Lascaux in der Nähe von Les Eyzies und Chauvet in den Bergen westlich von Lyon sind. Diese Höhlen sind für die Allgemeinheit nicht mehr zugänglich, Besucher müssen sich daher mit Kopien der Gemälde begnügen.
Читать дальше